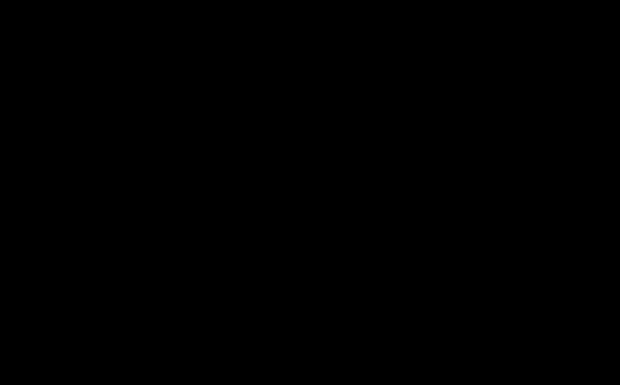Eric Pfeils Pop-Tagebuch: Transzendenz in gelber Bluse oder Stayin‘ In with Bob
Hätte man Eric Pfeil vor ein paar Jahren gesagt, dass er mal den Satz "Es folgt der Höhepunkt: Ron Wood" schreiben würde - er hätte wohl irgendetwas gesagt, was ihm gerade nicht einfällt. Bei "Bob Dylan – The 30th Anniversary Concert Celebration" tut er das aber.
Folge 45
Wer hören will, muss sehen.
Derart ZDF-Kampagnen-doof dachte kürzlich Ihr ergebener Chronist, legte die im März erschienene DVD „Bob Dylan – The 30th Anniversary Concert Celebration“ ein, öffnete eine Schachtel Knabbergebäck und erlebte einen wonnevollen Abend vor dem Bildschirm. Für Uneingeweihte: Am 16. Oktober 1992 versammelten sich zahlreiche hochrangige Rockmusikanten im Madison Square Garden und spielten zu Ehren des Meisters ein denkwürdiges Konzert, das nun erstmals in seiner Gesamtheit kommerziell veröffentlicht wird.
Sagen wir so: Wenn Sie mal große Lust haben, nahezu alle Dinosaurier-Rockstars auf einer Bühne zu erleben, dann sollten Sie sich dieses Produkt ganz dringend zu Ostern schenken. Es geht ziemlich gruselig los: Etliche Musiker um John Mellencamp (mit Weste auf nackter Haut) bieten eine schauderhafte Version von „Like A Rolling Stone“ dar. Die Schauderhaftigkeit gründet sich weniger auf Mellencamp oder der Weste, sondern auf einer mir nicht bekannten Co-Sängerin, die sich so ziemlich aller Pseudo-Soul-Verbrechen schuldig macht, die in den frühen Neunzigern noch häufig zu besichtigen waren. Ist es eigentlich Amy Winehouse zu verdanken, dass blödes Herumgeröhre heute nicht mehr mit Soul verwechselt wird? Wie auch immer: Was die Dame hier veranstaltet, sollte man gesehen haben; es ist dazu geeignet, ganzen Generationen angehender Soul-Sänger zu demonstrieren, wie man es nicht machen sollte! Auch Al Kooper tut mit, er wird sogar vorher groß angekündigt, dennoch hält es die Bildregie nicht für nötig, ihn auch nur eine Sekunde lang zu zeigen. Tja.
Es folgt Stevie Wonder mit einer Version von „Blowin‘ In The Wind“ („The ants, my friend, are blowin‘ in the wind“, wie mein Keyboarder Felix Hedderich zu sagen pflegt). Ich würde gerne jetzt etwas ganz Tolles über Stevie Wonder schreiben. Das ist nach dieser Version leider nicht so recht möglich, deshalb schnell zum Gegenteil von Stevie Wonder, zu Lou Reed (Leser: „Lou Reed, das Gegenteil von Stevie Wonder? Eine steile These“. Pfeil: „Ich weiß, aber mein Management drängt mich zu steilen Thesen“).
Lou Reed telepromptert eine Fassung des 80er-Outtakes „Foot Of Pride“ ins Rund, die, so scheint es zu Beginn, an Hüftsteifheit nicht zu überbieten ist, die aber, je länger sie währt, immer großartiger wird. Wie ein Bildhauer meißelt Reed aus dem stumpfen Bluesrock-Klotz etwas heraus, das mit dem Wort „erhaben“ nur unzureichend beschrieben ist. Hier nun hat der faszinierte Zuschauer erstmals die Gelegenheit, die tolle Backingband zu bewundern, die von nun an sämtliche auftretenden Künstler begleiten wird und die für sich genommen schon eine Supergroup darstellt: An der Rhythmusgitarre wirkt Steve Cropper, den Bass exekutiert der leider inzwischen verstorbene Donald „Duck“ Dunn, und als musical director springt mit neckischer Früh-Neunziger-Frisur G.E. Smith über die Bühne. Gleich zwei Schlagzeuger ackern im Hintergrund: Anton Fig und der unschlagbare Jim Keltner. Wobei: „Geackert“ wird nur von Fig, Keltner ist sein übliches cooles Selbst, trägt Schlagzeughandschuhe, Sonnenbrille und hat fast immer noch eine Rumbarassel in der Hand. Im Bonusmaterial grinst der angeblich ewig übellaunige Reed vor sich hin wie das vielberittene Honigkuchenpferd.
Eddie Vedder (salbungsvoll bis manisch) und Tracy Chapman (Tracy Chapman) überspringe ich jetzt mal. Danach wird der Country-Stadl eröffnet: June Carter Cash und Gatte Johnny betreten die Bühne. Cash hat nicht seinen glücklichsten Abend, aber Gattin June macht das mehr als wett. Es folgt Willie Nelson, dem es mal wieder gelingt mit um die 60 älter auszusehen als mit um die 80, mit einer faszinierend stoischen Fassung von „What Was It You Wanted“. Während man noch mit Meditationen über Haschisch-Konsum im Alter beschäftigt ist, steht schon der nächste Künstler auf der Bühne: Doch auch zu Kris Kristofferson und Johnny Winter fällt mir wenig ein. Doch: Kristofferson sah ich mal vor ein paar Jahren live. Mitten im Konzert zeigte er plötzlich auf einen Typen im Publikum und brüllte freudig: „Hey, you look like me!“. Zu Johnny Winter ist zu sagen, dass er ein streitbares Batik-Leibchen trägt und der dünnste Mensch ist, der an diesem Abend auf der Bühne stehen wird.
Es folgt der Höhepunkt: Ron Wood. Hätte mir vor ein paar Jahren mal jemand gesagt, dass ich mal den Satz „Es folgt der Höhepunkt: Ron Wood“ schreiben würde, ich hätte wohl irgendetwas gesagt, was mir gerade nicht einfällt. Wood ist so aufgekratzt wie zehn Duracell-Häschen auf Speed und erweckt den Eindruck, als habe er das gesamte Rauschgiftvorkommen hinter der Bühne alleine inhaliert. Trotzdem gelingt es ihm, seine ohnehin schon geniale Album-Fassung von Dylans „Seven Days“ noch zu transzendieren. Wie man mit einer gelben Bluse und roten Socken einen Song transzendieren kann, ist mir selbst schleierhaft, aber Wood gelingt es. Er singt übrigens exakt so wie Dylan circa 1977, was sehr ulkig ist.
Und jetzt kommt’s. Der Text läuft aus dem Ruder. Darum kündige ich hiermit einfach mal an, dass es beim nächsten Mal Teil 2 meiner Osterhasen-Geburtstagskonzert-Besprechung (mit u.a. Neil Young, Tom Petty, Sinead O’Connor und George Harrison) gibt. Das nach dem letztwöchigen Pop-Tagebuch-Eintrag geplante Special zum Thema „Neo-Psychedelia der 80er“ (mit The Steppes, Opal, Plasticland und anderen Paisley-Trägern) muss somit verschoben werden. Immer diese Themenvielfalt! Ich wünsche einstweilen einen schönen Karfreitag!