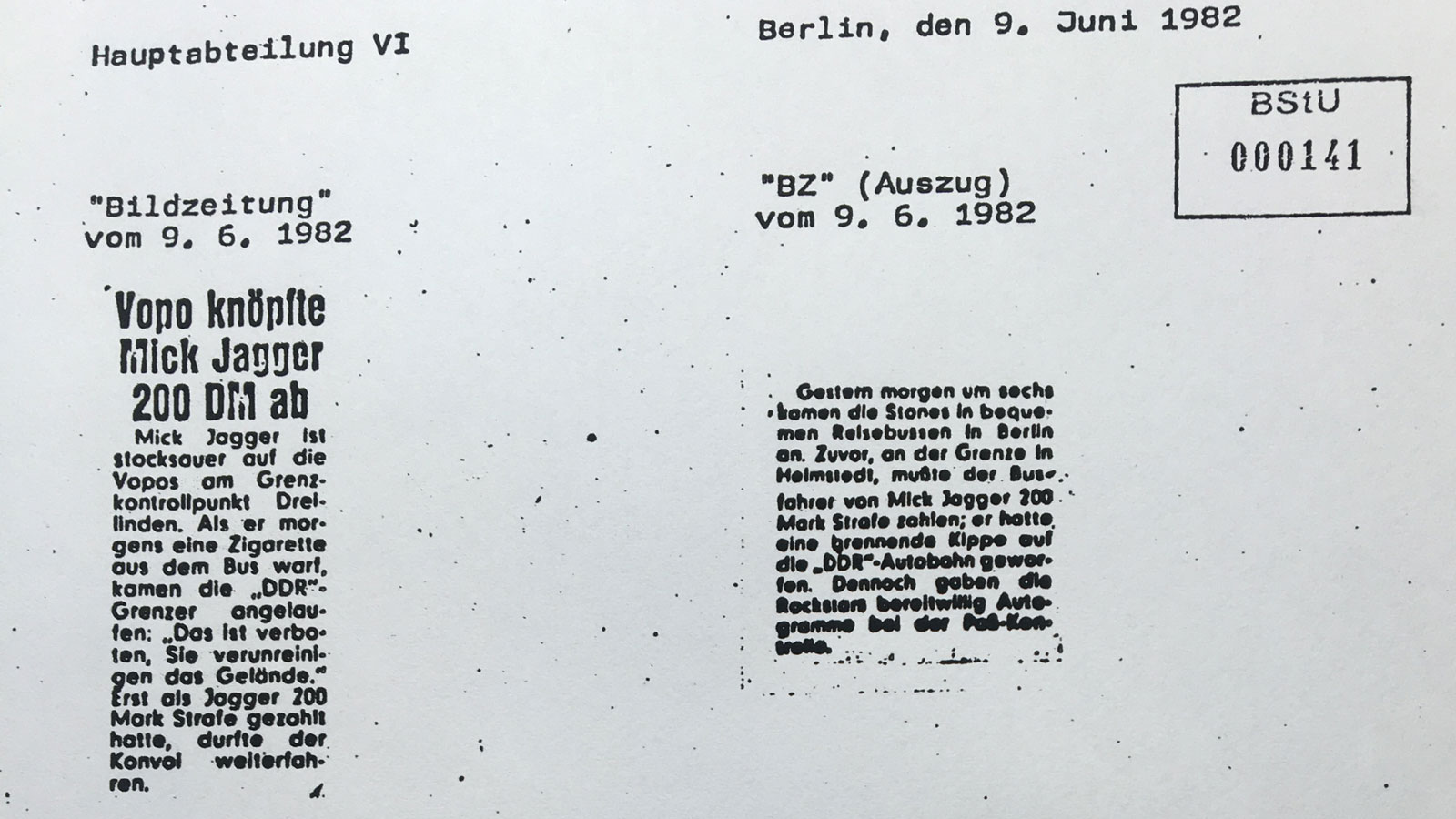I.M. Rock: Was die Stasi mit der Musik der DDR zu tun hatte
Der Arm der Stasi reichte auch in die DDR-Musikszene: In vielen Bands spielten Spitzel mit. Joachim Hentschel begab sich auf die Spurensuche. Zum heutigen Feiertag hier noch mal sein ausführlicher Report.
Mit 17 hat Thomas Schoppe einmal versucht, über die Berliner Mauer zu klettern. Keine Mutprobe, keine Abenteuerlust. Echte Republikflucht. Politische Gründe. So handfest, wie sie bei einem DDR-Teenager der allerersten Stunde nur sein konnten.
Eines Abends im November 1962 jedenfalls waren Schoppe und sein Freund Hans aus der Heimat Leipzig nach Berlin gereist. Hatten sich im Jazzclub „Kleine Melodie“ Mut angetrunken, waren in der Dunkelheit aufgebrochen. Den richtigen Spot entdeckten sie am Plänterwald in Köpenick, wo der provisorische Zaun – die Mauer war noch nicht fertig – eng an einem Neubau vorbeilief. Handschuhe für den Stacheldraht hatten sie vergessen. Als die zwei, wild entschlossen, trotzdem die Füße ansetzten, ratschte neben ihnen der Verschluss einer Maschinenpistole. Die Stasi-Leute waren ihnen schon vom Club aus gefolgt. Irgendwie hatten sie’s gerochen.
Für Hans kam es richtig bitter. Auf dem Dachboden bei seiner Mutter fanden die Beamten säckeweise Schokolade, Whiskyflaschen und Nylonhemden, die er in einer Postsammelstelle aus Westpaketen geklaut hatte. Vier Jahre Jugendknast. Schoppe hatte Glück. Er war Waise, hatte eine Tante im Westen. Man verlegte ihn in ein anderes Leipziger Heim, mehr nicht.
Gut sieben Jahre später war er Leadsänger der Klaus Renft Combo, der coolsten Band der DDR. Und wurde erst so zum wirklichen Staatsfeind, zum Rocker mit unheimlicher Macht, den die offiziellen Autoritäten schnellstmöglich zum Opfer degradieren mussten. Beim nächsten Gang zur Grenze, im Februar 1978, öffnete sich der Schlagbaum nach Westberlin freiwillig. Sie waren froh, dass er abhaute.
„Wir waren damals naiv, abenteuerlich, ehrenwert. Das hat uns, wenn man so will, die Karriere gekostet“, fasst Thomas Schoppe heute zusammen.
Ein guter Sozialist war er nie. „Schon mit sieben habe ich frohlockt, als ich von Stalins Tod hörte, obwohl Staatstrauer angesagt war.“ Schoppe ist jetzt 66, von der furchterregenden Bärenmähne aus Renft-Zeiten ist noch viel übrig: ein gewaltiger Kerl, ein Feuerkopf. Er serviert Fleisch vom Grill, man hört das Feiertagsgebell der Hunde von Zeulenroda. Hier in Thüringen hat er in schwierigen Zeiten Unterschlupf gefunden, lange nach der Wende. Lebensgefährtin Christine betreibt nebenan ein Zahnlabor, er macht halt weiter Musik. Eine Renft-Band gibt es auch wieder. Oder immer noch. Komplizierte Geschichte.
Schoppe wurde „Monster“ genannt. Weil er diesen Song von Steppenwolf so gut singen konnte. Solche Namen hatten sie fast alle damals: Monster. Maschine. Oschek. Cäsar. Im DDR-Rock’n’Roll war Zupacken gefragt, und die Renfts hatten es besonders schwer. Man galt als renitent, aus den Sechzigern waren Vorfälle überliefert. Irgendwann, glaubt Schoppe, schloss Gruppenchef Klaus Renft dann einen Deal mit der FDJ. Plötzlich verschwanden Widerstände, die Band durfte Platten machen. „Dafür mussten wir aber immer beim ‚Festival des politischen Liedes‘ antanzen. Inklusive Fäusterecken, Angela-Davis-mäßig.“ Schweine-Renft, sagten miesepetrig die alten Fans.
„Dafür mussten wir aber immer beim ‚Festival des politischen Liedes‘ antanzen. Inklusive Fäusterecken, Angela-Davis-mäßig.“
Als im Sommer 1973 die Weltjugendfestspiele in Ostberlin stattfanden und die DDR dem Rest der Welt ganz liberal, debattierfreudig und ausgeflippt daherkam, waren Renft dabei. Live, vor Tausenden auf dem Alexanderplatz und in der Wuhlheide. Und unter spezieller Beobachtung. Schoppe, damals 28, weiß noch, wie ihn einer der Aufpasser ansprach: „Monster, Leute wie dich könnten wir brauchen!“ Und er erinnert sich, wie Gitarrist Peter „Cäsar“ Gläser an einem Nachmittag überraschend verschwand. Er gehe einen Berliner Freund besuchen, meinte er. Schoppe fand das komisch.
Fast 20 Jahre später erfuhr er, dass sein Bandkollege in Wahrheit seinen Stasi-Führungsoffizier getroffen hatte, um zu berichten. Cäsar hieß nicht nur Cäsar, sondern auch IM Klaus Weber, IM für Inoffizieller Mitarbeiter. 1990, als es mit Renft gesamtdeutsch weitergehen sollte, wollte Cäsar lieber nicht mitmachen. Erst da erzählte er den anderen, was los gewesen war.
Später schrieb er alles in sein Buch „Wer die Rose ehrt“: wie er als junger Soldat bei der Stasi unterschrieb, ehrlich überzeugt vom Sozialismus. Wie die lockeren Gespräche immer geheimer wurden, das Drumherum abenteuerlicher. Wie er für die Kinder seines Offiziers den Weihnachtsmann spielte und 1985 beauftragt wurde, in der Tschechei einen ehemaligen Mitmusiker anzuwerben (was im Suff scheiterte). Wie er Angst bekam, wenn am Telefon einer nach Klaus Weber fragte.
Auch ohne die rund 180.000 IMs, die das Ministerium für Staatssicherheit ab Mitte der 70er-Jahre überall im Land einsetzte, hatte das DDR-Kulturministerium das Sicherheitsrisiko Pop eigentlich gut im Griff. Keine Band durfte ohne Arbeitserlaubnis hauptberuflich spielen, Konzerte wurden kontrolliert, Texte gegengelesen. Wer zwischen Konzert- und Gastspieldirektion, Komitee für Unterhaltungskunst, Künstleragentur und staatlicher Plattenfirma für was zuständig war, kapiert heute niemand mehr – aber hier versickerte keine Information. Trotzdem: Was wäre los gewesen, wenn eine Band vor 10.000 Leuten mal eben den Umsturz ausgerufen hätte? Was, wenn die Musiker nach Westreisen alle drüben geblieben wären?
Ein Dilemma: Hätte die DDR ihre Rockszene totreguliert, wären die jungen Leute ihr irgendwann aufs Dach gestiegen. Deshalb brauchte sie heimliche Stasi-IMs in den Gruppen. Mindestens einen in jeder Band, die in den Westen durfte, schätzen einige. Bis zu zwei in allen, sagen andere.
„Ich kannte Cäsar ganz anders“, sagt Thomas Schoppe heute knapp, ohne Zögern. „Der hat niemanden angeschissen.“ Angeschissen, das ist der Fachausdruck. Man könnte auch sagen: Die Renft-Leute brauchten gar keinen, der sie anschiss, weil sie das selbst am besten konnten. Mitte der Siebziger hatte die eine Hälfte der Band keine Lust mehr auf Linientreue. Schoppe erzählt von einem wahnwitzigen Konzert in Berlin, Frühjahr 1975, als man den Sänger, Freund und Regimekritiker Gerulf Pannach auf die Bühne holte, obwohl er Auftrittsverbot hatte. „Plötzlich standen Stasi und Polizei in der Garderobe. Aber wir waren verbal und physisch so kräftig – die hätten uns abführen müssen! Das hätte einen Eklat gegeben.“ Zur Besserung wurden Renft auf Polentour geschickt, zwei Konzerte pro Tag, depressive Stimmung und mieser Rotwein. „Wir waren völlig überfordert. Eines Abends standen plötzlich drei Mädchen da und grüßten uns: ‚Heil Hitler!‘ Und wir: Ist das jetzt die Stasi? Wollen die uns testen oder provozieren?“ Am 22. September 1975 wurde der Klaus Renft Combo vom Leipziger Rat für Kultur mitgeteilt, dass sie offiziell aufgelöst sei. Sagen wir mal: wegen musikalischer Differenzen mit Erich Honecker.
Natürlich wurden sie weiter beschattet. Auch später, nach der Ausreise in den Westen. Beim Nachhausekommen spürten sie, dass jemand in der Wohnung gewesen war. Vorhänge im Nebenhaus schienen sich zu bewegen. Wenn sie reden wollten, gingen sie auf die Straße. „Das Schlimme bei solchen Ängsten ist immer die Frage: Ist das wahr oder träumst du das bloß?“, sagt Schoppe. „Als hätte man einen Mord oder Verkehrsunfall erlebt. Wir haben wie im Wahn gelebt.“ Klaus Renft fand Jahre später in seiner Stasi-Akte detaillierte Berichte, die der befreundete Leipziger Keyboarder Wolf Rüdiger Raschke über ihn geschrieben hatte, sogar über seine Hochzeitsfeier. Einmal zeigte er Schoppe eine Skizze, die Raschke von Renfts Musikzimmer gezeichnet hatte. Mit peniblen Maßangaben. Das war schon wieder lustig.
Wolf Rüdiger Raschke hatte ab Mitte der Siebziger riesigen Erfolg mit der Band Karussell. An der Gitarre: Peter „Cäsar“ Gläser, sein überraschender Anschlussjob nach dem Renft-Aus. Karussell, die Gruppe mit gleich zwei IMs. Die nichts voneinander wussten. Cäsar starb im Oktober 2008 an Krebs, ziemlich genau zwei Jahre nach Klaus Renft.
„Dass die Akten heute alle offen sind, hat eine Kehrseite.“
„Dass die Akten heute alle offen sind, hat eine Kehrseite“, sagt Jens Gieseke, Historiker und Stasi-Experte. „Beim Lesen übernimmt man automatisch die Perspektive der Stasi auf ihre Informanten. Nicht überall, wo IM draufsteht, ist auch IM drin.“ Die DDR war ja auch weit außerhalb der Verhörstuben ein Land der Macher und Drahtzieher, Feilscher und Trick-17-Typen. Und zwanglos ins Gespräch mit einflussreichen Leuten zu kommen, konnte lebenswichtig sein. Erst recht im Musikbusiness, wo man fast alles immer beschaffen musste.
Die Puhdys zum Beispiel, die erfolgreichste, sprichwörtlichste DDR-Rockband, verdanken den besten Teil ihrer Karriere dem Talent des langjährigen Managers und Bassisten Harry Jeske (der Veranstalter mit Schnaps und Bodenfliesen bestach und einen Booker nervte, bis er die Band in die Niederlande einlud). Und Peter Meyer, dem Keyboarder, der 1973 ins DDR-Komitee für Unterhaltungskunst berufen wurde und dort am runden Tisch mit Funktionären saß. Den Puhdys geht es gut heute. 20 Millionen Platten haben sie verkauft, während und nach der DDR-Zeit. Am 13. August, dem Tag des Mauerbau-Jubiläums, spielen sie mit Joe Cocker in der Berliner Waldbühne.
Im Sommer 1993, lange nach dem Mauerfall, drehte der WDR einen Film über die Puhdys. Vor laufender Kamera zog der Interviewer einen Stapel Papier heraus und präsentierte ihn Peter Meyer: die Akte von IM Peter. „Jahrelang hat der Chef der Puhdys als Inoffizieller Mitarbeiter auch bei der Stasi mitgespielt“, schrieb der „Stern“, andere zogen nach. Er habe sich danach kaum mehr auf die Straße getraut, erinnert sich Puhdys-Sänger Dieter „Maschine“ Birr. „Das hat damals eine gewisse Hysterie bedient. Ost-Sportler wurden nicht mehr an Tankstellen bedient und so weiter. Der Frust der Leute gegen die DDR wurde auf populäre Figuren projiziert.“ Aber niemand tat den Puhdys etwas.
Peter Meyer hat zur Sicherheit ein Buch mitgebracht, „Abenteuer Puhdys“, da stehe alles drin, seine Rolle im DDR-Unterhaltungsbusiness betreffend. Für die 800 Rockmusiker habe er im Komitee doch alles nur Denkbare getan: „Ich kann es mir auf die Fahne schreiben, dass sehr viele von ihnen mal rüber in den Westen durften. Dafür habe ich mir wirklich den Arsch aufgerissen.“ Klar gab es Kontakt zu Politikern, zu Kurt Hager vom ZK, Egon Krenz vom Staatsrat. Und sicher wurde oft aufgeschrieben, was er da so sagte. „Aber es hätte doch kein Mensch gewagt, einen von den Puhdys als IM anzuwerben! Die Akte vom WDR, das ist eine Kaderakte ohne Unterschrift. Da steht drin, wie ich heiße und wie man mich einsetzen kann. Es war doch so: Wenn einer in der Straße Telefon hatte, war er gleich bei der Stasi. Wenn einer in den Westen reisen durfte, auch. Und ich sowieso.“ So lebte man nun mal in einem Staat, in dem Freundschaft und Vertrauen so viel wichtiger waren als anderswo, um sich durch den Alltag zu schlawinern. Und in dem gleichzeitig das Sähen von Misstrauen mit zum Systemerhalt gehörte.
Eine großartige Freundschaftsgeschichte ist von der Ostberliner Band Pankow überliefert. Sommer 1985, die erste Westdeutschland-Tour. Man schwor sich heilig, keinen Mist zu machen. Aber nach dem letzten Konzert, in einem Ort bei Hannover, überbrachte der Tourmanager schöne Grüße von Schlagzeuger Frank Hille: Man solle ohne ihn in die DDR heimfahren. Er war schon weg.
Die Übriggebliebenen reagierten schnell: Hinterher! Hille konnte eigentlich nur zu seiner Mutter nach Westberlin, und am Flughafen Hannover stellten sie ihn tatsächlich, wie er gerade in die Maschine nach Tegel steigen wollte. Was tun? Klar: Jetzt mussten alle mit. Um wenigstens noch die Flugzeit dazu zu nutzen, den Kollegen umzustimmen. Es half nichts. Nach der Landung fuhren die anderen zurück in den Osten. Zur Begrüßung hatten die diensthabenden Beamten dann einige Fragen.
Pankow waren schon zweite DDR-Rock-Generation. Trugen kürzere Haare und New-Wave-Hosen, sangen über Sex und Langweile. „Paule Panke“, ihren Songzyklus über einen aufmüpfigen Lehrling, wollte Amiga nicht auf Platte pressen. Bei „Rock für den Frieden“ im Palast der Republik wurde Sänger André Herzberg im Januar 1986 wegen eines Missverständnisses von Saaldienern festgehalten und antwortete, als er es auf die Bühne schaffte, mit einer Tirade gegen die Ordnungsmacht. Im Probenkeller sagten sie zum Spaß immer: Und hinter der Wandverkleidung sitzt der Mann von der Stasi. Der hat schon Spinnweben am Ohr.
Die Wahrheit sollte André Herzberg bald erfahren. Nach der Wiedervereinigung beantragte er bei der Gauck-Behörde Einsicht in seine Akte. Ob er auch die Klarnamen der IMs wissen wolle, die ihn beobachtet hatten, fragte das Amt. Er wollte. Es dauerte. Immer wenn der nächste Name entschlüsselt war, bekam er Post. Nur auf den Brief, den er im Juli 1996 bekam, war er nicht gefasst. IM Peters, stand darin, war Jürgen Ehle. Der Pankow-Gitarrist. Einer seiner engsten Freunde.
Herzberg, heute 55, möchte sich zum Interview in Prenzlauer Berg treffen. Möglichst zum frühen Frühstück, denn auch Pankow gibt es im Jahr 2011 noch oder wieder, und sie nehmen gerade eine Platte auf. Sein Auftritt im Café ist spektakulär, ganz in Künstlerweiß gekleidet, mit halb offenem Hemd und roten Nike-Sneakers. Geht’s jetzt noch mal richtig los mit der Band? „Man hofft immer“, pampt er. „Bis zum Tod hofft man, dass was Neues passiert!“ Mit Jürgen Ehle, dem Ex-IM, spielt Herzberg noch immer zusammen.
„Natürlich war ich verletzt“, erzählt er über den Moment, als er das mit Ehles Stasi-Tätigkeit erfuhr. „Weil er mir das nicht gesagt hatte. Das war sehr, sehr schwer.“ Er rief ihn damals gleich an, kam schnell zum Punkt. „Ich sagte: ‚Erstens, ich werde mit dir darüber reden. Zweitens, ich werde das Ganze an die Öffentlichkeit bringen. Wenn du damit einverstanden bist, können wir den nächsten Schritt machen.‘ Und das war er.“
Zum Deal gehörte ein gemeinsames Interview für die „Berliner Zeitung“. Da erzählte Ehle, wie er ganz harmlos angeworben wurde, zuerst als Gitarrenlehrer für ein Funktionärskind. Wie er bei diversen Katastrophen – unter anderem bei Hilles Flucht und Herzbergs Konzert-Ausraster – seine Kontakte nutzte, um Bestrafungen abzuwenden. Und wie er dafür auch ab und zu sprechen musste. Belangloses, Allgemeines, gab er an. Den Freunden habe er mehr genutzt als geschadet. „Er ist politisch ein bisschen verwirrt“, diktierte er dem Offizier einmal über Herzberg. „Aber eigentlich, in seinem Inneren, steht er für unsere Politik.“
Ein Wort fällt in jedem zweiten Satz, wenn Herzberg sich an die DDR erinnert. Entzauberung. So vieles löste sich nach und nach auf, als die Mauer weg war und man klarer sah. Die Familie, einst stramm rot, driftete auseinander. Sogar die Illusion, ein Rebell gewesen zu sein, musste er sich abschminken. „Ein anderer IM schrieb über mich, ich würde die Westflucht planen“, erzählt er. „Und der Offizier kritzelte daneben: ‚Das stimmt nicht. Der Mann kommt zurück.'“ Er macht Hundeaugen. „Der konnte mich einschätzen. Ein guter Bürokrat.“
Hat er nicht erwartet, dass zumindest Ehle auch persönliche Verantwortung für den Vertrauensbruch an ihm übernehmen würde? „Gute Frage“, stockt Herzberg kurz. „Aber der moralische Aspekt hat mich gar nicht so interessiert. Ich wollte von ihm wissen, wie das ablief. Was er gesagt hat, was seine Motive waren. Natürlich habe ich ihm gegenüber noch heute Emotionen deshalb. Aber dadurch, dass er mir alles erzählt hat und ich das nun ins große Gesamtbild einordnen kann, kann ich weiter mit ihm umgehen.“
Ein bisschen wundert man sich, dass der explosive Charakter das so wahnsinnig versöhnlich sieht. Unter besonders engen Freunden scheint nicht nur der Verrat schwerer zu wiegen, sondern auch die Versöhnung. Wenn keiner vor ihr wegrennt.
Der feinsinnige Metaphoriker Henryk M. Broder schrieb Anfang der Neunziger, der Umgang der Ex-DDR-Bürger mit den Stasi-Gehilfen erinnere ihn an die misshandelte Ehefrau, die den Prügelmann auch noch in Schutz nimmt. Roland Jahn, derzeit Leiter der Unterlagenbehörde, kritisierte erst kürzlich wieder die leichtfertige Vergangenheitsbewältigung in Brandenburg, wo ein Polizeichef als Ex-Stasi-Vernehmer enttarnt wurde und sich einmal mehr der Fall Manfred Stolpe entrollte. Auch wer sich mit den Rock-IMs befasst, stößt immer wieder gegen dieselben Fragen: Wie viel Schaden konnten sie überhaupt anrichten, solange sich Hitzköpfe und Biermann-Fans mit ihren Protestsongs praktisch selbst ans Messer lieferten? Haben sie – wie Puhdys-Meyer und Pankow-Ehle behaupten – nicht sogar Schlimmeres verhindert?
Schön wär’s, aber ernsthaft aufgearbeitet ist auch hier gar nichts. Von wem auch? Was wurde zum Beispiel aus den Leuten von der Platten-VEB Amiga? Keine hilfreichen Standardantworten, keine Kästchen, die man abhaken kann. Nicht überall wo IM drauf steht, ist auch IM drin – aber vielleicht im Töpfchen nebenan. Deshalb ist es für die Beteiligten auch so mühselig, alles immer und immer wieder erzählen zu müssen. Aber es geht nicht anders.
Wie die Musiker die Ost-Vergangenheit rückblickend sehen, ob in grellem oder eher mildem Licht, hat auch viel damit zu tun, wie es ihnen nach der Wende erging. Männern wie „Monster“ Schoppe oder André Herzberg, die brotlose Tage kennenlernten, merkt man an, wie viel Unruhe und offene Rechnungen da noch sind. Die Puhdys, die cleverer waren, wirken viel mehr im Reinen mit sich und ihren alten Ichs zu sein. Auch Wolf Rüdiger Raschke, Gründer und Keyboarder von Karussell. Der Mann, der Klaus Renft damals so intensiv ausgehorcht haben soll. In dessen Konzert Renft-Sänger Schoppe einmal „Raschke – Stasi!“ dazwischenrief (und sich hinterher entschuldigte). Als es nach 1990 mit Karussell vorbei gewesen war, hatte Raschke in Naunhof bei Leipzig ein Hotel gebaut – eine goldene Idee, es gab in der Ex-DDR kaum gehobene Unterkünfte. Der „Rosengarten“ wurde ein großartiges Geschäft, sodass Raschke es sich im Jahr 2007 erlauben konnte, die Band zurück ins Leben zu rufen.
Karussell spielen heute abend in Stralsund. In der rot geziegelten Ostsee-Werftstadt, die zu DDR-Zeiten so richtig schön runtergewirtschaftet wurde, bis nach 1990 die Millionen aus der Städtebauförderung kamen. Am Ende dieses vernieselten Vorsaison-Tages soll die Open-Air-Party stattfinden, unten am Wasser, beim Hotel Hafenresidenz. Dem neuen Vier-Sterne-Haus, das heute die denkmalgeschützten Türen öffnet. Der Chef, ein Leipziger Investor, ist ein alter Freund von Wolf Rüdiger Raschke, er hat den Auftritt arrangiert.
Raschke, 63, braungebrannt, mit Kapitänshemd und leuchtend weißem Bärtchen, muss in der Lobby viele Hände schütteln. „Loslassen“ heißt die neue CD, eine Tour ist gebucht. „Wir wollen das Boot noch mal ganz doll zum Schwimmen bringen“, sagt der Bandchef und glüht vor Stolz und Vorfreude.
Aber wie war das denn nun mit der Stasi? Erst weicht er aus, spricht von den obligatorischen Befragungen nach Westreisen und der Biermann-Ausbürgerung. Aber einen IM-Namen hatte er doch, Wolf Kaiser, oder? „Ja.“ Raschke verstummt. Dann erzählt er. Nicht ausführlich, aber er erzählt.
„Ich war damals bei der NVA. Wir haben uns als junge Leute ja nicht die tiefgründigen Gedanken gemacht wie später nach der Wende. Ich habe unterschrieben, mit 18 Jahren.“ Andere Stasi-Mitarbeiter habe er nie kennengelernt, „ich habe da auch wenig Verbindungen gehabt. Man ist immer auf uns zugekommen, wenn man etwas Spezielles wollte. Das hat’s drei, vier Mal gegeben.“ Auch bei Renfts Hochzeit? Dort gewesen sei er. Ob er einen Bericht geschrieben habe, weiß er nicht mehr.
Klar ist das kein Kaffeeklatsch-Thema. Aber wie die knappen Auskünfte diesen wetterfesten Mann plötzlich aufwühlen, wie seine Augen im Raum umherirren, die Stimme auf einmal belegt klingt – man kann sich vorstellen, was das für Erinnerungen sind. Muss man sich heute für das rechtfertigen, was man damals getan hat? „Ich denke schon, dass man das muss“, seufzt Raschke. „Ich bin kein Verdrängungskünstler. Ich stehe dazu. Ich find’s nicht schön, dass es so war, aber es ging mir nicht allein so. Ein zweites Mal würde ich es bestimmt nicht machen.“
Die Akten beweisen nichts. Nur die Bekenntnisse. Zu befürchten hat Raschke nichts, aber zugute halten muss man es ihm trotzdem: Er weicht nicht mehr aus. Er redet darüber. Vielleicht ist es das, was André Herzberg meint, wenn er sagt, dass die moralische Frage nicht ganz so wichtig sei. Auch ein ehemaliger IM muss erst mal das Schweigen brechen.
Die See bleibt unruhig, aber als Karussell am Abend auftreten, sind über 200 Leute zum Hafen gekommen. Einige waren wohl schon in der DDR dabei, andere hören die alten Rockschlager zum ersten Mal, die neuen sowieso. Der Regen stoppt, als Sänger Reinhard „Oschek“ Huth das berühmteste Stück anstimmt, „Als ich fortging“ von 1987. Eine schwermütige Ballade, die mit demselben Trick funktioniert wie viele Ost-Hits: Im Vordergrund geht es um die Flucht vor einer kaputten Beziehung. In Wahrheit um die enttäuschte Liebe zur DDR.
„Nichts ist von Dauer, wenn’s keiner recht will/ Auch die Trauer wird da sein, schwach und klein.“ Die Traurigen, Schwachen auf der einen Seite, die Gewinnler auf der anderen. Wäre es so simpel, dann hätte sich die Geschichte von der Stasi und ihren Opfern schon längst von selbst erzählt.
Weitere Highlights
- Huey Lewis im Interview: „Die Mundharmonika ist die Antithese zum Techno“
- Xavier Naidoo: Das „Ich bin Rassist“-Interview in voller Länge
- Rolling Stone Playlist: 10 Song-Schätze auf Single-B-Seiten
- Courtney Love: „Kurt wollte sich jeden Tag umbringen“
- Video: „Tagesthemen“ berichtet 1994 über den Tod von Kurt Cobain