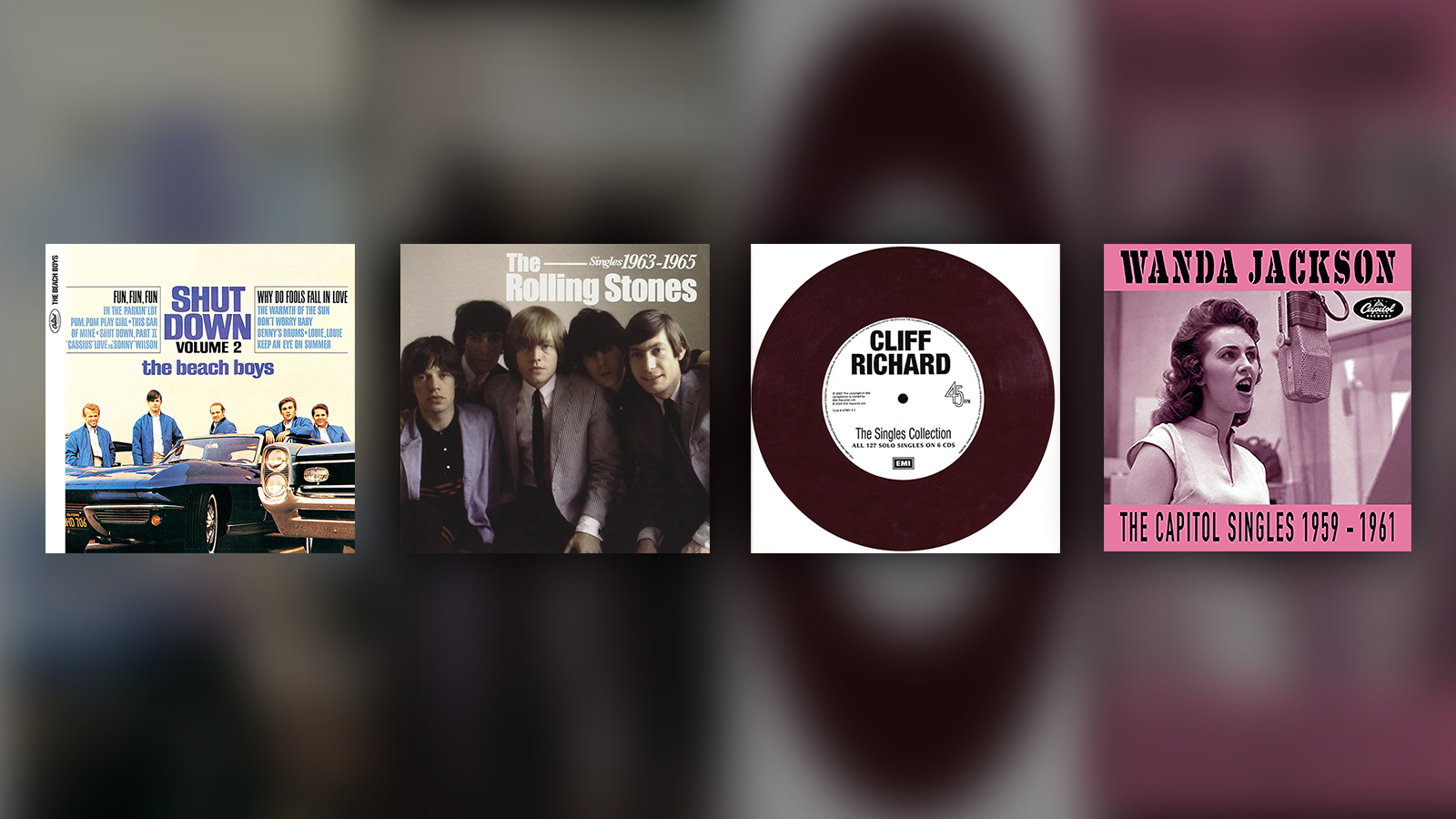UNBEUGSAM
GIBT ES DENN NOCH EINEN GRUND, SICH DIE PLACKEREI anzutun – zu diesem Zeitpunkt ihres Lebens? Könnten sie nicht einfach elegant einen Schlussstrich ziehen – selbst wenn sie ihr Metier mittlerweile so erschreckend perfekt beherrschen? Es ist ein Freitagnachmittag Ende April, und wir befinden uns in einem Probenkeller am Rande von Burbank, Kalifornien. In dem Raum, kaum größer als eine Garage, hat sich Keith Richards direkt vor Charlie Watts‘ Schlagzeug aufgebaut. Watts, inzwischen schlohweiß, verfolgt konzentriert, wie sich Keith durch das sinistre und hochgradig vertrackte Intro zu „Gimme Shelter“ windet, als müsse er einen Schleichweg durch die Hölle finden. Als Richards zum zweiten Mal mit dem Motiv beginnt, steigt Watts auf den Drums ein – immer einen Hauch hinter dem Beat -, während Mick Jagger zu einem markerweichenden Heulen ansetzt. Er klingt wie Charles Dickens‘ Geist der Zukunft, dem man tunlichst aus dem Weg geht, dessen Erscheinen man aber auch bang entgegenfiebert. Und schon stürzt sich die gesamte Band – Richards, Watts, Ronnie Wood, Bassist Darryl Jones und Keyboarder Chuck Leavell – mit beängstigender Intensität auf den Song. Katzengleich tänzelt Jagger durch den Raum, vermeidet dabei jeden Augenkontakt, sondern fixiert einen imaginären Ort jenseits der Wand und artikuliert das Dilemma menschlicher Existenz:“Oh, a storm is threatening/My very life today/If I don’t get some shelter/Oh, yeah, I’m gonna fade away.“
Es ist der beste Jagger-Richards-Song über das nackte Nichts, eine Vision von Verfall und Untergang, aber auch vom Segen der Gnade. Und in diesem Raum, an diesem Nachmittag, in diesen Momenten, in denen sie das Chaos und die Erlösung beschwören, wird einem auch klar, warum diese Männer gar nicht die Möglichkeit haben, ihrem Kollektiv zu entkommen. In diesem Raum sind sie gezwungen, miteinander zu kommunizieren, zu arbeiten, sich gegenseitig zu helfen. „Die individuellen Komponenten dieser Band“, so Produzent Don Was, „verschmelzen zu einem Gebilde, das wir The Rolling Stones nennen. Und wenn diese Kernschmelze einsetzt – Mann, sie produziert eine wahrhaft elementare Kraft. Wenn man nicht mehr die einzelnen Elemente hört, wenn man nicht mehr die Bäume sieht, sondern den Wald, wird man Zeuge einer gewaltigen Explosion.“ Wir befinden uns bei den Proben zur ersten großen Stones-Tournee seit fast sechs Jahren. Im Herbst 2012 gab es bereits Auftritte in Paris, London, Brooklyn und Newark, mit denen das 50-jährige Bestehen der Band gefeiert wurde. Die letztjährigen Konzerte und die anstehende Tour sind beide ein seltener Meilenstein: Nur wenigen Bands war es vergönnt, mit ihrem personellen Nukleus – Jagger, Richards und Watts – zu überleben, geschweige denn sich kontinuierlich zu entwickeln. Watts weist mich darauf hin, dass die einzige Formation des letzten Jahrhunderts, der dieses Kunststück gelang, die Duke Ellington Band war, die der Jazz-Pianist von 1924 bis 1974 leitete – wobei dort allerdings das Personal ständig variierte.
Nach Adam Riese heißt das, dass jeder der anwesenden vier Stones mindestens 65 Jahre alt sein muss – und noch immer eine Musik macht, die eigentlich auf der Spielwiese der rebellischen Jugend zu Hause war. Letztlich waren es sogar die Rolling Stones selbst, die diese Qualität forcierten und in den Vordergrund schoben. Anfang und Mitte der Sechziger personifizierten sie den Look, die Renitenz und die Träume der Rock’n’Roll-Generation -und wurden im Gegenzug mit Ablehnung, Beschimpfungen, Prozessen und gar Verboten bedacht. („Gewöhnlich nicht gerade die idealen Zutaten für die Überlebenschancen einer Band“, meint Richards.) Auch wenn sie inzwischen sichtlich gealtert sind – und sich die Welt in 50 Jahren ganz schön verändert hat -, sind sie noch immer die archetypischste Band, die der Rock’n’Roll je hervorgebracht hat. Noch immer machen sie ihre Musik mit einer Verbissenheit und Risikobereitschaft, als könnten sie die Welt in ihren Grundfesten erschüttern. Sie transformierten ihre kollektive Aufsässigkeit in einen Zustand permanenter Bockigkeit – auch wenn das Kritikern oder selbst Kollegen nicht immer gefiel. „Die Leute gratulieren den Stones dazu, nun schon 112 Jahre zusammen zu spielen“, höhnte John Lennon bereits 1980, kurz vor seinem Tod. „Juchhe!“ Und trotzdem stehen sie auch 2013 noch in der Manege, spielen noch immer mit einer unerschütterlichen Geschlossenheit – und beginnen nun eine Tour, die so ungeduldig erwartet wird wie selten ein musikalisches Ereignis zuvor.
Sicher, sie werden für ihre Arbeit fürstlich entlohnt. Die Ticketpreise in den USA bewegen sich zwischen 150 und mehr als 2000 Dollar. Im April sagte Kid Rock dem ROLLING STONE: „Wir kriegen alle so viel Kohle, dass es schon lächerlich ist. Die Leute gehen nicht mehr zu Konzerten, weil sie’s sich nicht mehr leisten können. Die Stones kosten also nun 600 Dollar! Es macht mich sprachlos. Ich liebe die Stones, aber ich werde mir einen Besuch schenken.“ Als ich Jagger darauf anspreche, wie es sich vereinbaren lässt, dass eine Band, die immer ihr rebellisches Image kultiviert hat, derartige Preise aufrufen kann, sagt er: „Ich weiß es nicht. Ich möchte mich zu dem Thema eigentlich gar nicht äußern Es führt zu dieser ewigen Diskussion über Kunst und Kommerz, Rebellion und, nun ja “ Richards hat keine Probleme mit dem Thema, scheint aber auch von Gewissensbissen nicht sonderlich geplagt zu werden: „Ich sehe es so: Wir geben bekannt, dass wir eine Tour auf die Beine stellen möchten – und bekommen daraufhin verschiedene Angebote, die unterm Strich aber alle gleich aussehen. Wir haben die Preise sogar noch ein klein wenig nach unten gedrückt. Mit anderen Worten: Wir haben uns für das Angebot entschieden, das uns am wenigsten Geld bringt. Aber das sind nun mal Preise, die der Markt diktiert. Ich weiß es nicht. Ich hab mich mit dieser Diskussion nicht übermäßig beschäftigt. Ich möchte nur, dass die Leute uns sehen können – und dass sie das können, ohne dass ihre Babys zu Hause hungern müssen. Das ist schon alles.“
Trotz des kommerziellen Potenzials hatte Jagger – der jedes Detail der Tournee persönlich absegnet – noch im letzten Jahr seine Zweifel, ob das Unternehmen tatsächlich umsetzbar sei. „Letztlich“, gab er damals dem ROLLING STONE zu Protokoll, „sind wir einfach noch nicht so weit.“ Als ich ihn in Los Angeles auf diese Aussage anspreche, sagt er: „Ich habe das damals so formuliert, weil uns alle möglichen Sachen angeboten wurden – die Olympischen Spiele und was weiß ich. Und es war eine willkommene Möglichkeit “ Er macht eine Pause und sucht nach der richtigen Formulierung. „Es stimmt schon: Wir waren damals einfach nicht optimal in Schuss. Und das war für mich ein willkommener Anlass, diese Angebote abzulehnen.“ Aber keine Frage: Es war nicht nur der Mangel an Vorbereitung, der ihnen damals im Weg stand.
Die Band hatte schon immer eine Neigung zu sporadischen Zerwürfnissen und Intrigen – beginnend mit jenen frühen Jahren, als Brian Jones vergeblich versuchte, die wachsende kreative Dominanz von Jagger und Richards zu verhindern. In späteren Jahren war es offenkundig, dass auch Jagger und Richards nicht immer mit offenen Karten spielten – und Richards‘ legendäres Faible für Heroin und Alkohol tat ein Übriges, um die Band an den Rand des Abgrunds zu treiben. Vor drei Jahren wurde ihre Beziehung einer weiteren Belastungsprobe ausgesetzt, als Richards seine Autobiografie „Life“ veröffentlichte. Seine Aussagen zu Jaggers Persönlichkeit sind so despektierlich und brutal ehrlich, dass sich Jagger erst einmal in die Schmollecke verzog.
Als dann der 50. Stones-Geburtstag am Horizont auftauchte, kontaktierte Richards seine Kollegen: „Hallo Jungs. Ich werd langsam kribbelig.“ Aber Jagger war – noch – nicht bereit, Richards öffentlichen Affront so einfach ad acta zu legen.
Meine bislang einzigen Interviews mit Jagger und Richards liegen bereits gut 25 Jahre zurück, datieren also aus der frostigen Halbzeit ihrer 50-jährigen Geschichte – zwischen „Dirty Work“ von 1986 und „Steel Wheels“ von 1989. Es war eine Zeit, die Richards später als den „Dritten Weltkrieg“ bezeichnete – eine dreijährige Phase, in der die Zukunft der Band mehr denn je auf der Kippe stand. Als ich Richards im Frühjahr 1986 in Manhattan traf, um über „Dirty Work“ zu sprechen, kursierten bereits Gerüchte, dass Jagger sich diesmal weigere, mit der Band auf Tour zu gehen. Richards kreuzte mit einer Zwei-Liter-Flasche Jack Daniel’s im Büro seiner Presseagentin auf und kippte ein großes Glas nach dem anderen (schien aber selbst zwei Stunden später noch voll bei Sinnen). Er machte gute Miene zum bösen Spiel und lobte Jaggers Interpretation von „Harlem Shuffle“ (eine Coverversion des R&B-Klassikers von Bob & Earl auf dem Jahr 1963), die gerade als Single ausgekoppelt worden war. Er sprach auch von seiner Hoffnung, sie würden als Band gemeinsam altern – „was bislang noch niemandem gelungen ist“. Es klang fast schon so, als wolle er die Zukunft beschwören.
Jagger war sich da nicht so sicher. Als ich ihn Mitte 1987 in London traf, hatte er bereits sein erstes Soloalbum („She’s The Boss“) veröffentlicht und brachte gerade sein zweites („Primitive Cool“) heraus. Zu diesem Zeitpunkt schien die schiere Möglichkeit, dass Jagger die Stones zu Gunsten einer Solokarriere aufs Abstellgleis schieben könnte, Richards auf die Palme zu treiben. Es wurde gemunkelt, Jagger würde auch ohne die Stones touren -was Richards als finalen Affront verstand, da er die Band schon seit Längerem wieder auf Tour sehen wollte. „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Mick ohne die Stones touren würde“, sagte er später einmal. „Es wäre ein Schlag ins Gesicht, es wäre das Todesurteil für die Stones gewesen.“(Ende der Achtziger tourte Jagger zwar kurz mit seiner eigenen Band, allerdings nur in Japan und Australien, nie in England oder den USA.)
Als ich ihn beim Lunch in einem indischen Restaurant fragte, ob er mir den Stand der Dinge erläutern könne, gab sich Jagger zugeknöpft. „Nein, nicht wirklich“, sagte er. „Es würde nur Öl ins Feuer gießen. Wann immer ich etwas sage – und auch, wenn es nett und verständnisvoll ist -, dreht Keith gleich durch.“ Und dann erläuterte er natürlich doch, wie er sich die Zukunft der Band vorstellte.“Wir hatten Höhen und Tiefen in der Geschichte der Rolling Stones – und momentan sind wir wieder mal ganz unten. Ich hoffe aus ganzem Herzen, dass wir uns wieder berappeln. Gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, dass wir die Möglichkeit haben sollten, unsere kreativen Interessen jenseits der Rolling Stones verfolgen zu können. Ich liebe die Rolling Stones – ich glaube,
dass sie wundervolle Sachen auf die Beine gestellt haben. Aber es kann doch nicht angehen, dass – nach all den Jahren und in meinem Alter – das Leben nur aus den Stones bestehen soll Und wenn ich einen Schritt in eine andere Richtung machen möchte, dann sollte ich auch das Recht dazu haben.“
Bekanntlich berappelten sie sich wieder, um 1989 „Steel Wheels“ aufzunehmen und eine der spektakulärsten und erfolgreichsten Welttourneen der Popgeschichte durchzuziehen. Und doch schien sich etwas grundlegend verändert zu haben – positiv wie negativ. Unten den gigantischen Bühnenkonstruktionen mit ihrer gleißenden Lightshow waren die Stones noch immer eine echte Band -eine Live-Band, die die Höhen und Tiefen menschlicher Existenz ebenso auszuloten versuchte, wie es schon Muddy Waters, Howlin‘ Wolf oder andere Idole vor ihnen getan hatten. Die Band produzierte auch weiterhin Alben -„Voodoo Lounge“ 1994, „Bridges To Babylon“ 1997, „A Bigger Bang“ 2005 -, auf denen Jagger die klangliche Palette erweiterte, während Richards seine Vision des Blues weiter schärfte und aufgekratzter klang denn je. Und trotzdem schien die Stunde des Tandems Jagger-Richards endgültig geschlagen zu haben. Die beiden Freunde und Partner, die den Hass der englischen Obrigkeit auf sich gezogen hatten, die 1967 vor Gericht und knapp vor dem Knast standen, die nach dem berüchtigten Altamont-Konzert beide völlig desillusioniert waren – diese beiden Männer schienen plötzlich nicht mehr dieselben Werte zu teilen. Und es war Jagger, der im Laufe der Jahre die Oberhand zu gewinnen schien. Sein grenzenloser Professionalismus resultierte zwangsläufig in einer Dominanz, die Richards – zwischen Drogenexzessen und demonstrativer Coolness – nicht mehr in Frage stellen konnte. Obendrein lebten sie inzwischen in verschiedenen Städten, ja verschiedenen Ländern, und sprachen oft nur noch miteinander, wenn es geschäftliche Fragen unabdingbar machten. Mehr und mehr schienen sie sich nur noch mit gegenseitigem Unverständnis zu begegnen. „Ich glaube, dass ich seit 20 Jahren nicht mehr in seinem Umkleideraum war“, erzählte Richards von ihrem gemeinsamen Leben auf Tour. „Manchmal vermisse ich einfach einen Freund.“
Es stellte sich allerdings heraus, dass die Ereignisse durchaus nicht spurlos an Richards vorbeigegangen waren. Oft genug hatte er seine Erinnerungen ganz altmodisch in einem Tagebuch notiert – und als er sich nach der Tournee von 2007 daransetzte, mit seinem Co-Autor James Fox diese Erinnerungen zu Papier zu bringen, lieferte „Life“ ein minutiöses Bild aller gemeinsamen Höhen und Tiefen. Wobei Richards manchmal vielleicht einen indiskreten Schritt zu weit ging. Zu Jaggers Album „Goddess In The Doorway“ von 2001 schrieb er etwa, dass es schwerfalle, „das Album nicht in ,Dogshit In The Doorway‘ umzutaufen“. Problematischer -und für Jagger vermutlich verletzender -war aber wohl das generelle Psychogramm, das sich im Verlauf des Buches herauskristallisierte. Richards beschreibt einen Mann, der sich in seinem Leben so sehr verändert hat – vom empathischen Freund zum kalten, ehrgeizigen Kontroll-Freak -, dass man lieber einen weiten Bogen um ihn schlug. „Es geschah Anfang der Achtziger“, schreibt Richards, „als Mick unerträglich wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde er ,Brenda‘ oder ,Her Majesty‘ Wir saßen zusammen und sprachen in seiner Anwesenheit über ,that bitch Brenda‘ – und er bekam’s nicht mal mit.“ Weiterhin schreibt er: „Mick mag niemandem vertrauen und vielleicht ist das der größte Unterschied zwischen uns beiden. Ich wüsste nicht, wie ich es anders beschreiben könnte. Ich vermute, es hat etwas damit zu tun, Mick Jagger zu sein – und der Art und Weise, wie er mit diesem Mick Jagger klarkommt. Er kann einfach nicht aufhören, die ganze Zeit Mick Jagger zu spielen.“ Einige seiner Kommentare konnten eigentlich nicht überraschen. Beide Männer hatten sich im Lauf der Jahre über die Presse so einige Tiefschläge verpasst, nur um dann die Wellen wieder zu glätten. Doch diesmal war die Situation eine andere. Richards hatte sich immer gerühmt, das Wohl der Band über alles zu stellen, doch indem er ihr Aushängeschild als hohl und egozentrisch charakterisierte, stellte er auch das Schicksal der Band infrage.
Als Jagger 2011 bei den Grammys auf die Bühne kam, um an einem Tribut für den verstorbenen Solomon Burke mitzuwirken, lieferte er eine derart perfekte Performance, dass ihm das Publikum eine Standing Ovation gab. Nicht auszuschließen, dass er damit auch ein Signal in Richtung Richards schicken wollte: Er, Mick Jagger, hatte es immer noch drauf, auch ohne Richards oder die Stones über seinen Schatten zu springen. Wäre auch ein Keith Richards dazu in der Lage? Schließlich war es Jagger gewesen, der Richards oft genug unterstützt, auf seine Gesundheit Rücksicht genommen, die Folgen seiner Drogen-Eskapaden toleriert hatte. „Mick war die erste Person, die nie den Glauben an Keith verlor“, bestätigte Richards-Managerin Jane Rose dem Biografen Victor Bockris. Darüber hinaus hatte Jagger die gesamte Stones-Organisation zusammengehalten und die wichtigen Business-Deals ausgehandelt. In all diesen Jahren muss Jagger seinen labilen Kollegen als Hemmschuh empfunden haben, während Richards sich als volksnah inszenierte und seinen Partner als ehrgeizigen Emporkömmling verunglimpfte.
Doch nun, bevor man sich ernsthaft mit einer Jubiläumstour beschäftigen konnte – die Richards unbedingt wollte -, ließ Jagger keinen Zweifel daran, dass er in irgendeiner Form auf Genugtuung bestand. Details über diese Aussprache drangen nie ans Licht der Öffentlichkeit, doch die Atmosphäre zu diesem Zeitpunkt war „gereizt und unangenehm“, wie Ron Wood berichtete. Es gab sogar das Gerücht, dass Richards‘ Position als Leadgitarrist zur Diskussion stünde. Einige Kritiker hatten die Vermutung geäußert, dass er beim Spielen akute Probleme habe – vielleicht weil die fortschreitende Arthritis in seinen Händen oder aber sein Alkoholkonsum eine adäquate Handhabung unmöglich machte. Nach einem kritischen Bericht über seine Performance bei einem Stones-Konzert in Göteborg 2007 verlangte Richards eine öffentliche Entschuldigung von Markus Larsson, dem schwedischen Autor des Artikels. Stattdessen ließ Larsson verlauten, dass er sich bei „einem Rockstar, der kaum noch das Riff von ,Brown Sugar‘ spielen kann“, nicht zu entschuldigen gedenke. Als sich die Stones 2012 in Paris erstmals wieder zu Proben trafen, hätten laut Informationen aus dem Umfeld der Band deshalb nicht nur Proben auf dem Programm gestanden, sondern auch die Frage, ob Richards als Gitarrist überhaupt noch tragbar sei. Jagger habe, so heißt es aus dieser Quelle, bereits einen anderen prominenten Gitarristen im Auge gehabt, falls Richards tatsächlich ausgefallen wäre.
Mitte April habe ich knapp eine Stunde Gelegenheit, mich mit Jagger zu unterhalten, natürlich auch zu diesem Thema. „Ich habe nicht die leiseste Ahnung, worüber Sie überhaupt mit mir sprechen wollen“, sagt er lächelnd und nimmt am Esstisch seiner Suite im Beverly Hills Hotel Platz. Ich erinnere mich daran, was einmal die Frau von Gitarrist Waddy Wachtel sagte:“Wenn Mick Jagger lächelt, hat man das Gefühl, als sei alles im Lot mit der ganzen Welt.“ Jagger trägt schwarze Jeans und sieht unglaublich fit aus, also sprechen wir eine Weile über sein Trainingsprogramm („Auf Tour muss ich die Schlagzahl immer erhöhen, aber zumindest fange ich nicht bei Null an. Und dieses Grundniveau zu halten ist mir sehr wichtig.“), auch über die Frage, wie er seine Stimmbänder in Form hält.“Wenn ich auf der Bühne stehe“, sagt er, „geht’s nun mal nicht nur ums Singen, sondern um die gesamte Performance. Ich laufe rum, tanze, bewege meine Arme – und das allein nimmt dir 50 Prozent deiner Luft. Ich bemühe mich also, diesen Aspekt im Auge zu behalten. Man möchte nicht außer Atem sein, wenn man eine Ballade singen will. Zu Hause habe ich durchaus Möglichkeiten, meine Stimme in Form zu halten. Ich singe Karaoke, ich schreibe Songs und mache Demos, auf denen ich natürlich auch singe. Ohne eingebildet rüberkommen zu wollen:
Ich schätze mich glücklich, dass ich alle Stones-Songs noch in der ursprünglichen Tonart singen kann. Mein oberes Register steht mir noch immer zur Verfügung, vielleicht sogar mehr denn je, seit ich nicht mehr rauche und auch weniger trinke.“
Um auf das Thema Keith Richards und seine Äußerungen in „Life“ zu sprechen zu kommen, frage ich ihn, ob eine Entschuldigung von Richards so etwas wie eine „Eine Grundvoraussetzung gewesen sei? Wollten Sie das sagen?“, fragt er mit einem dünnen Lächeln. „Nun, ich denke, dass es von Vorteil war, dass wir uns zusammengesetzt haben und er dabei auch diese Aussage machte. Ich möchte eigentlich nicht mehr dazu sagen, aber es war wichtig, dass er es sagte – und ja, es war so etwas wie eine Grundvoraussetzung. Man muss solche Sachen aus dem Weg räumen, man kann sie nicht unausgesprochen lassen – auch wenn die Versuchung groß ist. Gerade Engländer haben dafür ein Talent. Sie mögen einfach nicht den unangenehmen Tatsachen ins Auge sehen. Manchmal ist es so einfach, sie aus dem Weg zu schieben, aber ich denke, es war wichtig, dass wir dieses Gespräch geführt haben.“
Gab es – unabhängig davon – Passagen in Richards‘ Buch, die Jagger goutiert hat? War es unterm Strich eine akkurate Wiedergabe ihrer frühen Jahre?
„Akkurat …“ Er wiederholt das Wort mit einem galligen Lachen. „Wirklich, ich möchte nicht über Keiths Buch sprechen.“
Als ich ihn 1987 auf Richards ansprach, antwortete Jagger: „Ich fühle Ich respektiere ihn, ich fühle eine starke Zuneigung zu ihm und auch so etwas wie einen Beschützerinstinkt. Er ist der Typ Mensch, der nun, der einfach eine ganz eigene Art von Verletzbarkeit hat. Er hat ’ne Menge schlechter Erfahrungen gemacht – aber natürlich auch ’ne Menge guter (lacht). Wir hatten beide unseren Spaß, beide aber auch unsere Tiefschläge.“ Als ich ihn diesmal auf sein momentanes Verhältnis zu Richards anspreche, sagte er: „Wir haben ein ausgesprochen gutes Arbeitsverhältnis. Keith scheint ziemlich konzentriert zu sein und in der Musik aufzugehen.“
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man in Interviews oft an einen Punkt kommt, wo man bei einem Thema nicht nachsetzen sollte. Manchmal tut man’s trotzdem, manchmal lässt man es lieber bleiben. Als Jagger es ablehnt, weiter über Richards zu sprechen, schaut er wortlos auf das Glas vor sich – und seine Weigerung scheint aus einem Gefühl echter Betroffenheit gespeist zu werden. Ich versuche es mit einem Umweg: Im Laufe der Jahre haben sich auch andere Zeitgenossen ähnlich über Jagger ausgesprochen. Kann er nachvollziehen, dass die Leute ihn in diesem Licht sehen? „Ich denke, dass es vor allem eines ist: ein Klischee“, sagt er. „Die Leute mögen es nun mal, andere zu analysieren und sie in eine Schublade zu stecken -wie: ,Keith ist so impulsiv, während Mick ein kalter, berechnender Hund ist.‘ Im richtigen Leben gibt’s so etwas nicht. Auch Keith kann kalt und berechnend sein. Was keineswegs als Kritik gemeint ist, weil man manchmal diese Seite einfach rausholen muss. Die Leute haben nun mal verschiedene Naturelle. Und ich wüsste auch nicht, wo man die Grenze ziehen sollte, wenn man über sich selbst spricht – als Person und nicht nur als Teil einer Band. Ich muss manchmal eine Situation analysieren, jenseits der Musik, und im nächsten Moment muss ich mich wieder auf meine Gefühle verlassen. Ich muss die Perspektive meines Gegenübers verstehen können. Wenn ich geschäftliche Gespräche führe, muss ich deren Standpunkt nachvollziehen können. Man tritt einen Schritt zurück und analysiert die Situation. Man sollte eben nicht emotional sein, wenn man sich in einer derartigen Situation befindet. Was aber nicht bedeutet, dass ich beim Thema Musik keine ausgeprägten Gefühle hätte. Ich kann sogar sehr emotional sein. Man muss eben auf verschiedenen Hochzeiten tanzen können. Ich bin emotional sehr involviert, wenn’s etwa ums Bühnendesign geht oder die grafische Gestaltung auf dem Merchandising. Ich arbeite manchmal mit Charlie an diesen Sachen -und wir können uns da wirklich reinsteigern. Ich habe bei den Rolling Stones viele Rollen zu spielen -und ebenso viele in meinem Leben jenseits der Stones. Ich sehe also nicht ein, warum ich nur in die eine Schublade gesteckt werden sollte.“
Ich mache einen letzten Anlauf, um dem Verhältnis von Jagger und Richards auf die Spur zu kommen. Als er über die emotionalen Probleme der Band sprach, erwähnte Watts mir gegenüber: „Die beiden hauptsächlichen Verdächtigen lebten praktisch zusammen, als sie noch Kinder waren, nicht wahr? Sie lebten auf der gleichen Straße, nur ein Stückchen voneinander entfernt. Das ist der Kern des Problems. Sie sind wie Brüder, die sich wegen der Miete in die Haare kriegen -und wenn du dich da einmischen willst: Vergiss es.“ Ähnliches konnte man auch von Richards hören, der unlängst einem anderen Magazin sagte, dass er und Jagger wie „zwei extrem launische Brüder seien: Wenn es knallt, dann knallt’s richtig, aber wenn sich die Gemüter erst wieder beruhigt haben “ Könnte sich Jagger mit dieser Interpretation anfreunden?
„Die Leute kommen immer mit solchen Bildern“, sagt er. „Aber ich habe einen Bruder (Chris Jagger) – und meine Beziehung zu ihm ist eine brüderliche Beziehung und völlig anders als die, die ich zu Keith habe. Wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, ist das zwangsläufig eine andere Beziehung. Mit einem Bruder hat man gemeinsame Eltern, eine gemeinsame Familie. Keith und ich – wir haben das nicht. Wir arbeiten zusammen. Mit einer Beziehung zwischen Brüdern hat das nichts zu tun. Wenn man keinen Bruder hat, sagt man vielleicht, man schätze einen Menschen, als sei es der eigene Bruder. Aber mit jemandem in einer Band zu spielen ist nun mal ein ganz anderes Ding.“ Aber führt das Leben in einer Band nicht trotzdem zu ausgeprägten emotionalen Beziehungen?
„Sicher, wenn man so lange zusammenarbeitet, stellen sich zwangsläufig emotionale Bindungen ein. Es gibt gemeinsame Erinnerungen, Dinge aus der Vergangenheit, auf die man zurückgreifen kann – Bezugspunkte, die man gemeinsam auffrischen kann. Man hat eine Beziehung zu jedem in der Band – auch zu den Leuten an der Peripherie der Band, also einer sehr umfangreichen Gruppe. Aber eine Familie ist es deswegen noch lange nicht.“
Wäre es für ihn nicht reizvoll, nun selbst eine Abhandlung seines bewegten Lebens zu schreiben -also das Gegenstück zu Richards‘ „Life“ zu liefern? Er hatte ja bereits einmal mit einer Autobiografie angefangen, dann aber das Projekt abgebrochen. „Geld“, sagt er.
„Geld wäre für mich die einzige Motivation, ein derartiges Buch zu schreiben. Ansonsten sehe ich keinerlei Reiz darin.“
Am nächsten Tag treffe ich Richards in der Lounge des Rehearsal-Komplexes, in dem sich die Stones auf die Tour vorbereiten. Er trägt ein schwarzes T-Shirt mit abgerissenen Ärmeln und ein graues Bandana, aus dem sein grauer Haarschopf hervorquillt. Er verzichtet inzwischen darauf, seine Haare zu färben – und weder bei ihm noch den anderen Stones kann man Indizien ausmachen, dass sie mit kosmetischen Eingriffen den Zahn der Zeit zu kaschieren suchen. Keine Frage: Eine gesunde Eitelkeit dürfte ihnen nicht fremd sein, aber zumindest mit dem Alter in ihren Gesichtern scheinen sie ihren Frieden geschlossen zu haben. Während wir sprechen, sorgt Richards dafür, dass seine Zigarette nie ausgeht.
Ich spreche ihn auf eine Äußerung von Prince Rupert Loewenstein an, ihrem langjährigen Finanzberater, der in seinem Buch „A Prince Among Stones“ unlängst schrieb: „Eine meiner Bekannten, die sich mit Psychoanalyse beschäftigt, sagte mir einmal:,In gewisser Weise ist es Keith, der auf dem menschlichen Level die Nase vorn hat, während Mick auf professioneller Ebene der Gewinner ist.'“ Ich rechne fast schon damit, dass sich Keith von dieser Einschätzung distanziert – niemand im Stones-Camp, so hat man mir eingeflüstert, möchte den momentanen Burgfrieden in Frage stellen -, doch Richards antwortet ohne zu zögern: „Ich würde sagen, das ist eine ziemlich zutreffende Einschätzung, ja.“
Nach der Premiere von „Shine A Light“, Martin Scorseses Konzertfilm von 2008, fragte ihn ein Fernsehreporter einmal, ob er sich auch ein Leben ohne die Stones vorstellen könne. Richards schien amüsiert. „Aber locker“, antwortete er. Was vielleicht der Wahrheit entspricht – vielleicht aber auch nicht. „Wir wissen, dass wir verdammt gut sind“, sagt er mir, „und wir haben diesen seltsamen Ehrgeiz, noch besser zu werden. Wir haben das Glück, dass wir noch immer zusammen sind -was natürlich die Grundvoraussetzung ist. Bei jeder Band, selbst wenn sie nur für ein paar Jahre existiert, kommt irgendwann einmal der Punkt, wo man sich gegenseitig auf die Nerven geht. Aber vielleicht verspürt man doch gleichzeitig diesen Wunsch, die gemeinsame Konversation nicht abreißen zu lassen -und dabei ist Musik nun mal ein elementarer Faktor. Sie ist stärker als alle anderen Faktoren, die dir vielleicht in die Quere kommen. Sicher, es ist schon ein Wunder, wenn zwei Typen 50 Jahre lang miteinander klarkommen -von dreien oder vieren ganz zu schweigen. Aber andererseits möchte ich die Differenzen zwischen Mick und mir auch nicht überbetonen, weil nur davon immer die Rede ist. Man hört nie von den anderen 98 Prozent der Zeit, in denen wir problemlos harmonieren, weil wir uns so gut kennen und wissen, was wir wollen. Mein hauptsächlicher Kommunikationskanal ist die Musik. Man kann das ein Gentlemen’s Agreement nennen oder wie auch immer. Es mag eine unausgesprochene Absprache sein, aber wenn wir gemeinsam Musik machen, merke ich sofort, dass eine Menge dieser vermeintlichen Störfaktoren umgehend verschwinden.“
Glaubt man Waddy Wachtel, der in Richards‘ sporadischem Neben-Projekt The X-Pensive Winos spielt, kamen die problematischen Passagen in „Life“ für Jagger keineswegs aus heiterem Himmel. „Bevor das Buch erschien“, sagt Wachtel, „hat Keith ihn über den Inhalt informiert. Komplett! Mick wusste genau, was in dem Buch stand, aber als es dann veröffentlicht wurde, mussten sie wohl einen kleinen Knatsch inszenieren. Keith sagte damals:,Ich hab mich mit ihm zusammengesetzt! Ich hab ihm alles gezeigt!'“
Richards mag diese Aussage zwar nicht explizit bestätigen, sagt aber andererseits, dass er von Jaggers Reaktion nicht überrascht gewesen sei. „Ich weiß genau, wie er tickt. Aber gleichzeitig wollte ich meine Geschichte erzählen. Und wie ich schon zu Mick sagte:,Du hättest mal sehen sollen, was ich alles ausgelassen habe'“, erzählt Richards lachend. „Ich sagte ihm auch:,Ich weiß ganz genau, wie du das Buch gelesen hast. Du hast gleich im Index nach ,Jagger, M.‘ gesucht – und dann nur diese Passagen gelesen und den Kontext komplett ignoriert. Gib’s zu!‘ Aber es stimmt schon: Wir hatten unser kleines Scharmützel, mit dem ich aber gerechnet hatte. Wir haben das Problem auf unsere Weise gelöst – und jetzt ist die Kuh vom Eis.“
Hat Mick eine Entschuldigung verlangt?“Hat er“, sagt Richards, „und ich hab ihm gesagt, dass es mir leid tut, wenn ich ihm Ärger, Schmerz oder was immer eingebrockt hätte. Es war “ Richards lacht. „Ich würd sogar meine Mutter anlügen, wenn ich damit die Band am Laufen halte.“
Hatte er den Eindruck, dass die Band zu diesem Zeitpunkt auf der Kippe stand?“Nein, überhaupt nicht. Ich dachte mir, dass es ein kleiner Kitzel war, ein netter Adrenalinstoß.“
Gibt es rückblickend etwas, das er heute nicht wieder schreiben würde?“Nein, nein, nein, nein“, sagt er lachend. „Ich sage, was ich zu sagen habe – Punkt, aus. Ich würde nichts zurücknehmen wollen.“
Ich frage mich trotzdem: Hat es nicht Zeiten gegeben – nicht zuletzt während dieses Disputes mit Jagger -, in denen Richards befürchtete, dass die Band nicht mehr zu retten sei?
„Manchmal denke ich mir:,Diese gottverdammte Band ist ganz schön kaputt – aber nicht irreparabel.‘ Niemand von uns hat sie je zum Schrottplatz tragen wollen, aber man sagte sich schon: ,Ja, irgendwie ist der Wurm drin. Wir müssen so einiges investieren, um die Sache wieder auf Hochglanz zu polieren.‘ Und genau das haben wir im vergangenen Jahr gemacht. Wir haben das Ding in Form gebracht -und sogar in eine weit bessere Form, als ich es mir hätte träumen lassen.“
Ich erinnere ihn an die Aussage, die er vor gut 25 Jahren gemacht hat: dass es seine Hoffnung sei, die Band in Stil und Würde altern zu sehen. Nun könnte man sicher die These vertreten, dass sich die Band phasenweise nicht immer gerade „stilvoll“ entwickelt habe. Kann man auch diesen Phasen vielleicht etwas Positives abgewinnen?
„Hmm, ja. Stil ist Stil ist eine feine Sache, aber auch nur, wenn er mit kleinen Macken verbunden ist. Wenn alles immer nur perfekt und stilvoll ist, gewöhnt man sich halt an den Zustand. Es ist diese kleine Macke, die das große Ganze erst zum Glänzen bringt. Verstehen Sie, was ich meine?“
Zum Thema Würde hatte mir auch Watts eine Anmerkung geliefert: „Wenn die Musik, die wir gemeinsam machen, einfach großartig ist – dann ist das der Grund, warum Mick Keith vergibt oder umgekehrt. Ich glaube, es ist die Musik, die allen das Gesicht rettet.“
Worte wie Würde – oder Gnade oder Vergebung – mögen im Kontext der Rolling Stones vielleicht etwas deplatziert klingen, zumindest für diejenigen, die ihre Entwicklung hautnah verfolgt haben. An einem Sommerabend des Jahres 1969 wurde Brian Jones tot auf dem Boden seines Swimmingpools aufgefunden. Am Ende des gleichen Jahres spielte die Band in Altamont und wurde Zeuge, wie vor der Bühne ein Zuschauer erstochen wurde. „Ich habe die Lektion gelernt“, sagte mir Jagger 1987. „Ich habe gelernt, dass man eine große Show nicht auf die Bühne bringen kann ohne Kontrolle.
Das war eine Lektion, die wir alle verinnerlicht haben.“
In den nächsten Jahren waren es Gram Parsons und Produzent Jimmy Miller, die starben -wobei ihre Nähe zur Band möglicherweise eine Rolle spielte. 1974 warf Mick Taylor das Handtuch, weil er das Gefühl hatte, bei den Song-Credits über den Tisch gezogen worden zu sein -und weil Richards ihn im Studio arg herablassend behandelt habe. „Es war einfach eine unglaublich chaotische Zeit“, sagt er heute. „Wir waren ständig auf Tour, und wenn wir mal eine Pause einlegten, kreierten wir so ziemlich die beste Musik, die die Stones je gemacht haben. Sechs Alben in sechs Jahren – es war unglaublich.
Und sie machten in diesem Tempo ungerührt weiter, während ich nur noch geschlaucht und ausgebrannt war.“ Taylor hatte einen Gastauftritt bei den letztjährigen Shows und ist auf auch der neuen Tournee wieder vertreten, wo er unter anderem für „Midnight Rambler“ auf die Bühne kommt. „Um ganz ehrlich zu sein: Mir war nicht bewusst, wie sehr ich das Gefühl vermisst habe, wieder mit ihnen zu spielen. Als ich das erste Mal auf der Bühne stand, fühlte ich mich sofort wie zu Hause.“
Bassist Bill Wyman stieg 1993 aus, als er sich nicht mehr zumuten wollte, ständig im Flugzeug zu sitzen. „Ich kam zu dem Punkt, wo ich mir sagte:,Ich brauch diese Fliegerei nicht mehr. Ich habe meine eigene Karriere und kann tun und lassen, was ich will. Ich hab eine neue Familie und möchte meine Zeit mit ihr verbringen. Ich hab keine Lust mehr, rund um die Erde zu düsen.'“ Auch er spielte bei der letztjährigen Show im Londoner O2, war aber über seinen Mini-Auftritt nicht übermäßig glücklich. „Meine drei Töchter, alles noch Teenager, sahen mich zum ersten Mal mit den Stones live – was für mich natürlich eine besondere Motivation war. Ich war dann doch etwas enttäuscht, dass mein Auftritt nach fünf Minuten schon wieder vorbei war. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht in die USA wollte. Für drei Konzerte mit je zwei Songs? Mir wurde klar, dass man nach all den Jahren nicht mehr in die Vergangenheit zurückreisen kann, weil die Situation inzwischen eine andere ist. Klassentreffen, alte Freundinnen, Scheidungen und Wiederversöhnungen mit der alten Ehefrau – alles funktioniert nicht. Und mit einer Band ist es das Gleiche.“
Doch auch für diejenigen, die die Band nie verlassen haben, hat das Schicksal nicht immer nur gute Karten gemischt. Richards fiel in das tiefe Drogenloch, gefolgt von Jahren des Alkoholismus. Inzwischen hält er den Input auf einem überschaubaren Niveau. „Völlig nüchtern zu sein wäre in meinem Fall wohl gegen die Natur, verstehen Sie? Alles in Maßen! Wenn man dieses dumme alte Klischee aus den Augen verliert, geht’s schnell in die Hose.“ 2006 erlitt er einen Schädelbruch, als er auf den Fidschi-Inseln von einem Baum fiel. „Hatte ich eigentlich schon längst vergessen“, sagt er, „aber wenn ich mich manchmal am Kopf kratze, spür ich prompt den Knubbel. ,Richtig, da war doch was.'“ Den Aussagen eines Freundes zufolge muss Richards allerdings noch täglich entsprechende Medikamente nehmen.
Wood brach sich die Beine, als er 1991 in England in einen Autounfall verwickelt wurde. „Letztes Jahr musste ich wieder unters Messer: In meinem Fußgelenk gab’s ein Loch, das mit Knochen aus Knie und Hüfte aufgefüllt wurde. Ist alles bestens verheilt, aber ich sollte noch immer vermeiden, allzu lange zu stehen.“ Vor vier Jahren machte Wood auch mit Drogen und Alkohol Schluss – mit dem Resultat, dass er heute besser zu spielen glaubt denn je zuvor. „Es ist fast schon Zauberei“, sagt er, „aber die Sicherheit, einen klaren Kopf zu haben, macht einen großen Unterschied. Ich spiele heute erheblich weniger Noten, aber was ich spiele, hat Hand und Fuß. Das ist meine Belohnung. Wir alle profitieren davon – vor allem im Zusammenspiel mit Keith. Wir beide haben inzwischen dieses blinde, absolut intuitive Verständnis:,Genau, das ist es, was wir ausdrücken wollen‘, während man auf Droge nur starr nach unten schaute und dachte:,Okay, irgendwie werden wir wohl schon wieder zusammenkommen.'“
Selbst Watts, bei dem das Wort „Würde“ noch am ehesten angebracht ist, hatte kurz seine Probleme mit Drogen – in seinem Fall Heroin, wie er in einem Interview aus dem Jahre 2011 bestätigte. „Ich war von der Droge immer schon wieder runter, wenn ich abends nach Hause kam. Aber meine Frau merkte schnell, dass ich nicht mehr der Gleiche war.“ Als 2004 bei ihm Kehlkopfkrebs festgestellt wurde, unterzog er sich zwei Operationen – und ist mit seinen 71 Jahren der Rolling Stone, der am härtesten arbeiten muss. Im Laufe der zweieinhalbstündigen Show kann sich Jagger auch mal die Akustikgitarre umschnallen und ruhig am Mikro stehen -oder die Bühne verlassen, wenn Richards für zwei Songs die Vocals übernimmt. Watts kann sich nie verdrücken oder eine Pause einlegen. „Das Schicksal eines Drummers“, sagt er. „Der Drummer ist die Maschine. Es gibt nichts Schlimmeres, als außer Atem zu sein oder geschwollene Handgelenke zu haben -und man hat noch immer ein Viertel der Show vor sich. Das ist die Hölle.“
Nur Jagger war es vergönnt, seine Jahre in der Band ohne gesundheitliche Probleme oder menschliche Krisen zu überstehen. Sicher, seine Ehe mit Bianca Jagger ging 1979 in die Brüche und seine 22-jährige Beziehung zu Jerry Hall 1999. Hinzu kommt natürlich seine manchmal stürmische Partnerschaft mit Richards. Seit „Exile On Main Street“ haben sie nur noch sporadisch Songs miteinander geschrieben. Jagger erwähnt, dass sie zuletzt bei den Aufnahmen zu „A Bigger Bang“ gemeinsam geschrieben hätten, doch diese Tage scheinen schon lange zurückzuliegen. „Doom And Gloom“ aus dem letzten Jahr stammt aus Jaggers Feder, der die Nummer auch teilweise aufnahm, bevor die Band weiter daran arbeitete. Das Gitarrenriff zu Beginn des Songs stammt jedenfalls von ihm. („Ist gehüpft wie gesprungen“, erzählte Richards im letzten Jahr dem ROLLING STONE. „Er hätte sich das Riff nie alleine draufgeschafft, wenn ich es ihm nicht beigebracht hätte.“)“One More Shot“, der andere neue Track aus dem letzten Jahr, basierte auf Material, das Richards eigentlich für ein mögliches Soloalbum zurückgelegt hatte.
Mit anderen Worten: Es gab im Leben der Rolling Stones durchaus Schrammen und Blessuren – wenn auch nicht gleichmäßig verteilt -, aber anscheinend nicht genug, um sie selbst abzuschrecken oder ihr Publikum zu vergraulen. Die Frage aber bleibt, wie sich diese ungebrochene Faszination erklären lässt. „Ich könnte jetzt das Sprüchlein vom Stapel lassen, das ich immer für diese Fragen bereithalte“, entgegnet Jagger, „aber letztlich habe ich auch keine plausible Antwort. Warum haben die Rolling Stones überlebt? Ich sage dann immer: Weil sie erfolgreich sind. Weil ihr Publikum sie noch immer mag. Wenn uns niemand mehr sehen wollte, würden wir’s vermutlich auch nicht mehr tun – selbst wenn’s uns privat einen Riesenspaß macht. Aber wenn Sie mich nun fragen, welche Bedeutung wir für ein neues oder sich wandelndes Publikum haben, muss ich passen. Ich hab nicht die leiseste Ahnung. Ich vermute mal, dass unsere Langlebigkeit – unabhängig von der Qualität, womit ich nicht gesagt haben möchte, dass wir keine Qualitäten hätten – dass diese Langlebigkeit der Faszination eine weitere Dimension verleiht.
Wie die Patina auf einem alten Möbelstück. Weil man 50 Jahre lang durchgehalten hat, bekommt man diese zusätzliche Strahlkraft, wenn man so will. Was natürlich auch von Nachteil sein kann, weil man schnell in die Versuchung kommt, sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen.“
Was aber auch einer der seltenen Fälle ist, in denen Jagger krass übertreibt. Am Samstag, dem 27. April, geben die Stones im Echoplex, einem kleinen Club im Stadtteil Echo Park, vor 500 Zuschauern eine unangekündigte Show. An diesem Abend, auf dieser kleinen Bühne, greifen die Rolling Stones auf nichts anderes zurück als auf ihr Talent und ihre ungebrochene Energie – und beide sind mehr als beeindruckend. In dem 90-minütigen Set spielen sie 14 Songs, darunter eigenes Material von „Street Fighting Man“ bis „You Got Me Rocking“, Coverversionen von Chuck Berry („Little Queenie“) und den Temptations („Just My Imagination“) bis hin zu „That’s How Strong My Love Is“(1964 von O. V. Wright, ein Jahr später von Otis Redding veröffentlicht). Sie sind unglaublich laut und roh, ja klingen fast schon wie lärmende Avantgarde. Richards‘ Gitarre dröhnt unheilschwanger, während Jagger unermüdlich über die Bühne hetzt. Seine Mimik verändert sich ständig, und obwohl diese Songs schon unzählige Male über seine Lippen gekommen sind, präsentiert er sie noch immer so, als wären es taufrische Entdeckungen -mal ausgelassen, mal zwingend, mal verzweifelt -, und er dokumentiert dabei eine Intensität, die entweder pure Leidenschaft ist oder aber eine beachtliche schauspielerische Leistung. Richards hält einmal beim Spielen inne, schaut sich den Sänger an, schüttelt bewundernd den Kopf, sieht lächelnd zu Ronnie Wood, der wiederum das Lächeln an Watts weiterreicht.
Einige Tage zuvor hatte ich mit Richards über das Reunion-Konzert der Everly Brothers gesprochen, das im September 1983 in der Londoner Royal Albert Hall über die Bühne ging. Die Everlys waren bekanntlich zwei Männer, die nicht miteinander klarkamen und oft genug auch nicht mehr zusammen arbeiten wollten. Doch als sie bei diesem Auftritt -dem ersten seit zehn Jahren – gemeinsam eine atemberaubende Version von „Let It Be Me“ sangen, trat Phil Everly plötzlich zur Seite und sah seinen Bruder Don mit einem Blick an, aus dem uneingeschränkte Liebe und Wertschätzung sprach. „Ich kenne das Gefühl nur zu gut“, sagte mir Richards. „Mick und ich haben auch diese Momente -und gewöhnlich ist die Musik der Auslöser. Es gibt Augenblicke, wo man sich wirklich sagt:,God, man, I love you, baby.‘ Es passiert auf der Bühne sogar ziemlich oft. Ich beobachte Mick und bin immer wieder baff. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zum außenstehenden Beobachter werde. Wenn er voll auf die Tube drückt, haut es mich noch immer um. Was ein weiterer Grund ist, warum ich diese Arbeit so liebe.“
Watts erzählte etwas Ähnliches: „Mick ist der beste Frontmann, den man finden kann -vor allem jetzt, seit es die Konkurrenz durch James Brown und Michael Jackson nicht mehr gibt. Dort draußen auf der Bühne ist er einfach unschlagbar. Und er nimmt seinen Job tödlich ernst. Er hält sich in Form, er sieht gut aus -er hat alles, was man sich nur wünschen kann.“ Eine Einschätzung, die sich an diesem Abend vor allem in der Zugabe mit „Jumpin‘ Jack Flash“ bewahrheiten sollte. 1968 war es dieser Song, der in der Rockmusik eine Abkehr von den treuherzigen Idealen der damaligen Zeit einläutete -von Songs wie „All You Need Is Love“, die blauäugig proklamierten, dass Liebe und Altruismus ausreichend seien, um dem kalten Chaos ins Auge zu sehen. Im Gegensatz dazu thematisierte „Jumpin‘ Jack Flash“ das Gefühl, verloren und verlassen zu sein -und trotzdem den Mumm zu haben, seinen Weg auf eigene Faust zu finden.
Im Echoplex scheint Jagger diese Attitüde personifizieren zu wollen, als er bei der Zeile „I was crowned with a spike right through my head“ den gestreckten Zeigefinger gegen die Schläfe drückt und so tut, als würde er gleich tot umfallen -nur um dann hüftschwingend an den Bühnenrand zu stolzieren, wo er die abschließenden Zeilen herausbellt: „But it’s all right now, in fact, it’s a gas! But it’s all right, I’m Jumpin‘ Jack Flash, it’s a gas! Gas! Gas!“ Einmal Hölle und zurück -genau das war die Botschaft, die uns die Rolling Stones in ihren besten Momenten vermittelten. Der Blues beschwor den Willen, Dinge ertragen zu können, die eigentlich unerträglich waren -Dinge, die man anderen antat oder auch sich selbst. Die Musik der Rolling Stones kommuniziert einen ähnlichen Willen, wobei es diesmal nicht zuletzt ihre gemeinsame Geschichte ist, die es zu schultern gilt. Es war der Wegweiser, mit dem sich die Stones ihren Weg durch diese Welt bahnten, aber er taugt auch als Modell für den Rest von uns: Manchmal gibt es halt keinen Ausweg, manchmal ist es einfach besser, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen.
Ein paar Tage zuvor erzählte mir Keith Richards, was der legendäre Delta-Bluesmann Robert Johnson für ihn bedeutet: „Hört man Robert Johnson, so kann man die Angst mit Händen greifen. Aber Angst wovor eigentlich? Wer einmal der Angst ins Auge gesehen hat, der will seinen Mitmenschen vielleicht auch mitteilen, dass man die Angst überwinden kann. Diese Tatsache sollte man niemals vergessen. Und das ist etwas, was wir – sagen wir: in ,Gimme Shelter‘ – auch auszudrücken versuchen. Angst ist ein Gefühl, das man mit einem Song vermitteln kann – so wie jedes andere Gefühl natürlich auch. Verstehen Sie, was ich meine? Und wenn das der Fall ist, dann könnte man schon sagen, dass wir alle Gefühle zusammenkratzen, die uns zur Verfügung stehen.“