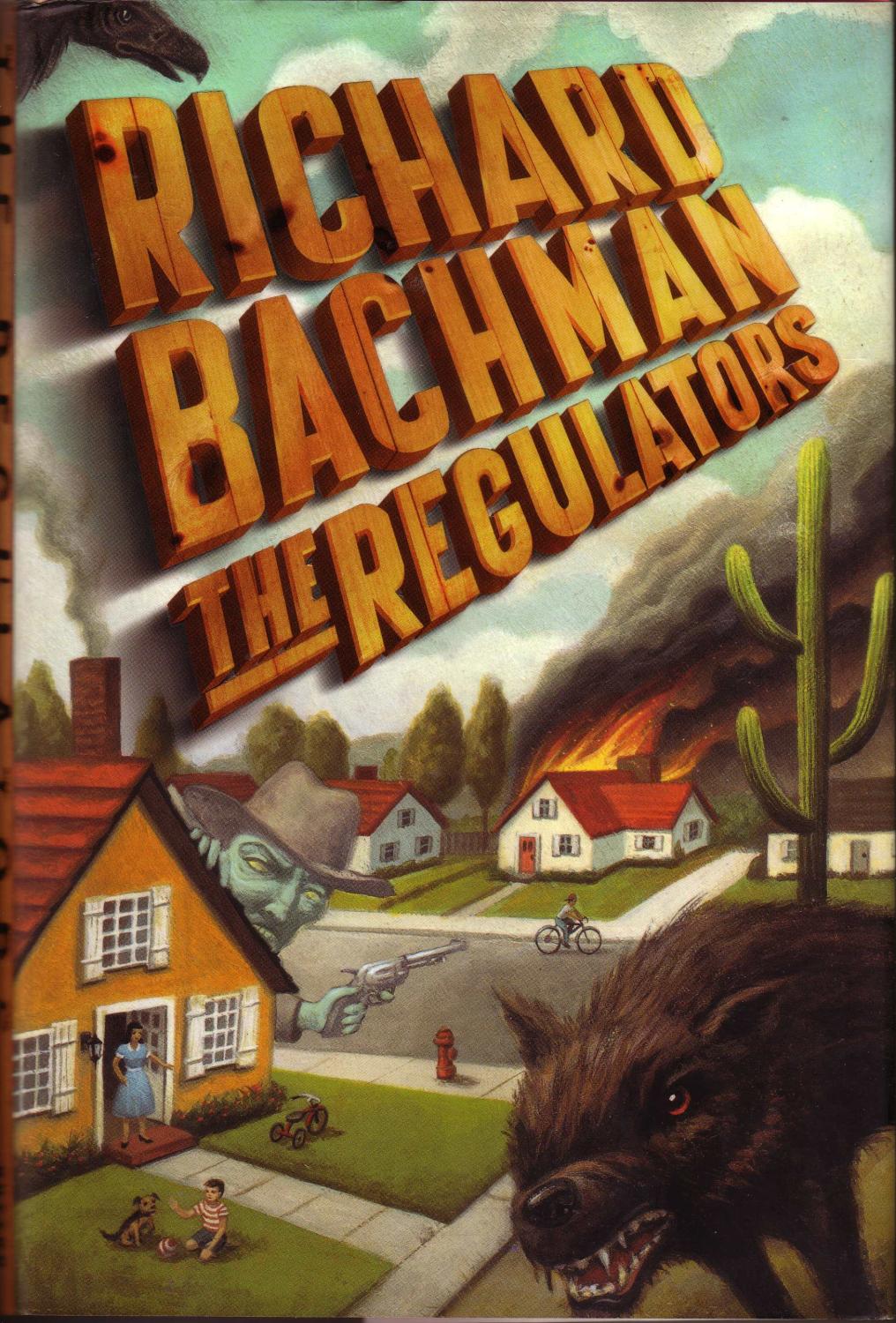David Foster Wallace :: Der bleiche König
Er wusste, was er tat. Es war kein spontaner Entschluss. Als David Foster Wallace sich vor fünf Jahren das Leben nahm, hinterließ er auf seinem Schreibtisch einen fein säuberlich geordneten Stapel Papier. Seit der Veröffentlichung von „Unendlicher Spaß“ hatte er an „etwas Langem“ gearbeitet, an einem neuen Roman, der nie fertig werden sollte. Das unvollendete Manuskript umfasste zwölf Kapitel, knapp 250 Seiten. In Schubladen, Notizbüchern, auf der Festplatte seines Computers fand sich noch mehr – ein Konvolut ohne ersichtlichen Anfang oder Ende: Figurenskizzen, angerissene Handlungsstränge, Fußnoten, offene Enden.
Seinem amerikanischen Lektor Michael Pietsch kann es kaum hoch genug angerechnet werden, die Sisyphusarbeit auf sich genommen zu haben, aus dem heillosen Durcheinander die bestmögliche Fassung eines Fragment gebliebenen, posthumen Werks auszuklamüsern; immerhin war in weiten Teilen nicht einmal die Reihenfolge einzelner, ohnehin nur lose miteinander verknüpfter Kapitel festgelegt; ganz zu schweigen von einer nachvollziehbaren Chronologie der Ereignisse. Wobei: Ereignisse? Erzählte „Infinite Jest“ noch davon, wie man sich zu Tode amüsiert, handelt „The Pale King“ von nichts Schrecklicherem als tödlicher Langeweile. Laut einer Notiz des Autors ist „Der bleiche König“ – so der Titel der deutschen Ausgabe – „eine Abfolge von Vorbereitungen auf Geschehnisse, aber es geschieht nie etwas“.
Dann passiert aber doch eine ganze Menge in diesem unübersichtlichen Bürokomplex eines amerikanischen Steuerprüfzentrums in Peoria, Illinois, Mitte der Achtziger. Es kommt darauf an, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet – und mit welcher Intensität. Denn auch das Thema der Konzentration spielt in diesem Buch eine entscheidende Rolle. Da wäre zum Beispiel Shane Drinion, ein auf den ersten Blick unscheinbarer Typ, der sich derart intensiv auf seine Gesprächspartnerin Meredith Rand und ihre haarsträubende Lebensbeichte fokussiert, dass er unbewusst beginnt zu levitieren. Claude Sylvanshine hingegen ist ein sogenannter „Faktenseher“ oder „Datenmystiker“, der in seiner chronischen Zerstreutheit aus dem Nichts heraus Tatsachen wahrnimmt, die niemand sonst wahrnehmen kann; diese Daten sind jedoch in den meisten Fällen vollkommen belanglos, wie etwa der „zweite Vorname des Sandkastenfreundes eines Fremden, an dem man auf dem Flur vorbeigeht“. Oder Chris Fogle, der, wie ausschließlich aus den Anmerkungen zu erfahren ist, eine bestit. Welch beglückender aus der Hölle der – oder sind wir damit womöglich in ihren innersten Kreis vorgedrungen?
Wie einem die gesteigerte Aufmerksamkeit wiederum zum Verhängnis werden kann, illustriert Foster Wallace unter anderem anhand der Figur David Cusk. Cusk, der kleinste Veränderungen seines Innenlebens obsessiv registriert, leidet seit seiner Jugend unter unkontrollierbaren Schweißausbrüchen, die nur noch schlimmer werden, sobald er glaubt, dass sie die Aufmerksamkeit von anderen Menschen erregen. Seine psychische Zwangslage verschärft sich, als er sich einen Ausspruch Franklin D. Roosevelts zum vermeintlich beruhigenden Mantra erwählt: „Das Einzige, wovor wir Angst haben müssen, ist die Angst selbst.“ Die Angst vor der Angst – wieder ein Problem mehr, auf das er sich konzentrieren muss.
Vom Leser verlangt Foster Wallace wie gehabt höchste Aufmerksamkeit, und gleichzeitig versucht er, sie hin und wieder zu zerstreuen oder die Geduld auf eine harte Probe zu stellen. In einem Kapitel geht es beispielsweise über mehrere Seiten folgendermaßen zu: „‚Abschweifungskönig‘ Chris Fogle blättert eine Seite um. Howard Cardwell blättert eine Seite um. Ken Wax blättert eine Seite um. Matt Redgate blättert eine Seite um. ‚Groovy‘ Bruce Channing heftet ein Formular in eine Akte. Ann Williams blättert eine Seite um.“ Kann man das einfach überblättern? Oder würde man dann womöglich eine entscheidende Information verpassen?
Die Lektüre wird zur Reflexion darüber, welche Details der Prosa von Bedeutung sind und welche nicht, wo der Autor uns auf eine falsche Fährte lockt und wo er selbst möglicherweise in eine Sackgasse geraten ist. In „Der bleiche König“ finden sich Passagen, die so irrwitzig, selbstironisch, unheilvoll, verstörend se in eine Sackgasse geraten ist. In „Der bleiche König“ finden sich Passagen, die so irrwitzig, selbstironisch, unheilvoll, verstörend oder erkenntnisfördernd sind, wie sie nur einem wahrhaft von seiner Kunst besessenen Schriftsteller gelingen können. Allein wie er seine zahlreichen Prota oder erkenntnisfördernd sind, wie sie nur einem wahrhaft von seiner Kunst besessenen Schriftsteller gelingen können. Allein wie er seine zahlreichen Protagonisten zum Sprechen bringt, wie er sich und beruflichen Jargons aneignet, sucht seinesgleichen. Manches bleibt aber auch notgedrungen Stückwerk, und man bekommt den Hauch einer Agen Stückwerk, und man bekommt den Hauch einer Ahnung davon, wie viel Ahnung davon, wie viel Arbeit er noch vovon, wie viel Ahnung davon, wie viel Arbeit er noch vor sich gehabgen Stückwerk, r sich gehabgen Stückwerk, Hauch davon, wie viel At hätte. „Die verzweifelte Sehnsucht nach dem Ganzen“, von der der Übersetzer Ulrich Blumenbach schreibt, sie ist in jeder Zeile spürbar.