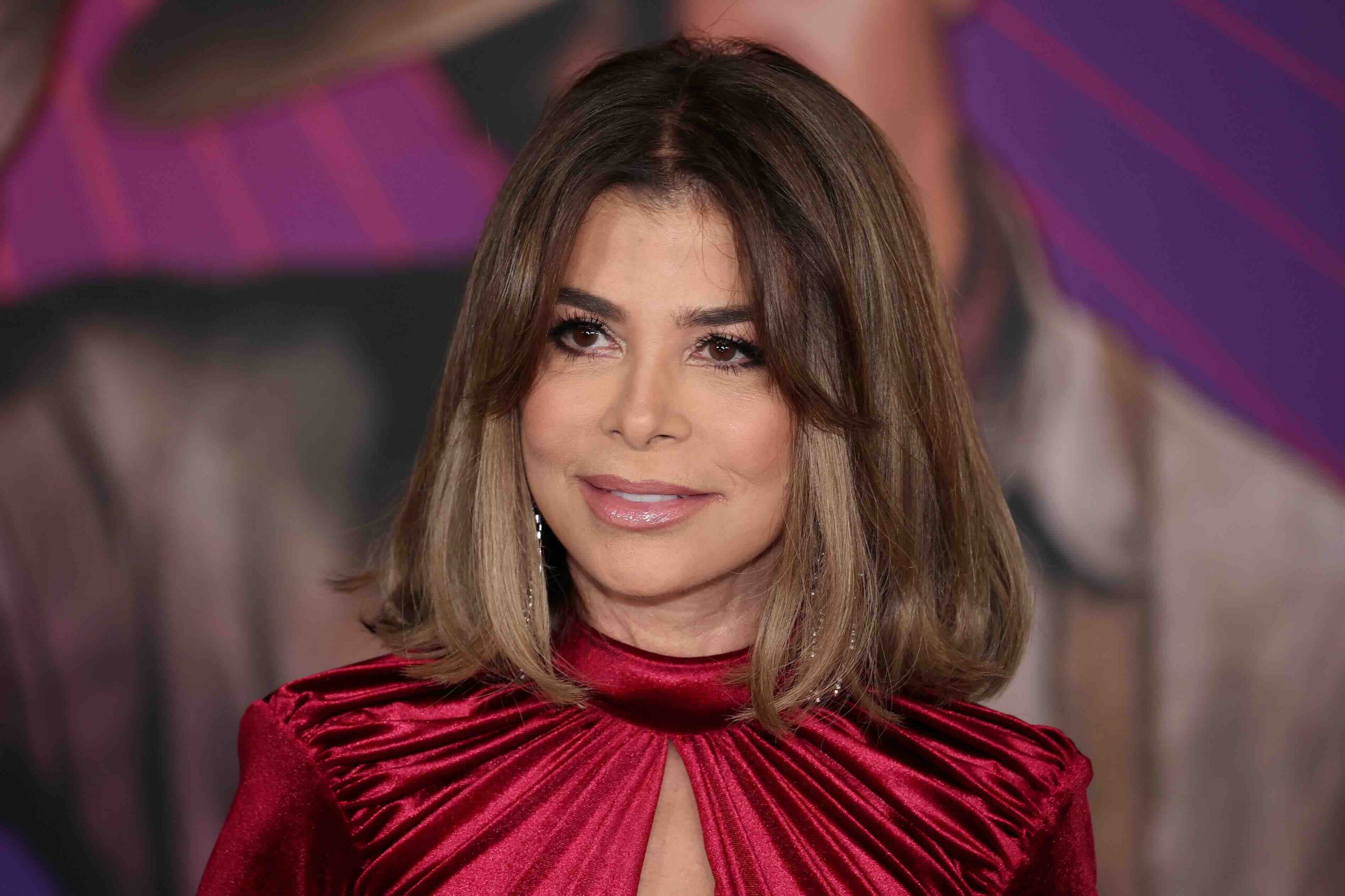Joni 33 1/3
SONG TO A SEAGULL (aka joni Mitchell) (1968)
Wie so viele Alben aus der Frühzeit des introspektiven Singer/Songwriter-Genres wirkt auch Joni Mitchells Debüt heute naiv und ein bisschen verkitscht. Aber die charakteristischen Mitchell-Themen sind in den blumigen Texten schon vertreten. Die Stadt-Land-Dichotomie, die das Album konzeptionell strukturiert, die Selbstzweifel, die Liebhaber, die Tochter, die sie nach der Geburt weggeben musste – und die gescheiterte Ehe mit Chuck Mitchell, von der ihr neben dem Nachnamen seelische Wunden blieben, die sich mindestens bis „Blue“ durch ihre Songs ziehen. Die etwas flache Produktion hat der neue Lover David Crosby besorgt. Vielleicht riecht „Songs To A Seagull“ deshalb etwas süßlich. (3,0)
CLOUDS (1969)
Das erste selbst produzierte Album. Von dort an gab Mitchell die Kontrolle nicht mehr aus der Hand. Ihre Stimme hat an Tiefe gewonnen, die seltsamen Gitarrentunings wirken in der klaren Produktion noch beeindruckender. Als Songwriterin trägt Mitchell den Kopf – trotz des Albumtitels – nicht mehr in den Wolken, die fast kindliche Romantik des Debüts ist in den besten Songs wie „Tin Angel“. „I Don’t Know Where I Stand“ und „Both Sides Now“ (das ursprünglich „Clouds“ hieß) einem schärferen Blick gewichen. Plötzlich sei ihr klar geworden, dass sie kein Mädchen, sondern eine Frau sei, sagte Mitchell später über diese Zeit: „I’ve looked at life from both sides now. (3,5)
LADIES OF THE CANYON (1970)
Ein Album, das einen vom ersten Ton gefangen nimmt. Ein heller, süffiger Sound, dominiert von Klavier, akustischer Gitarre und dem mittlerweile sublimen Gesang. Ausgeschmückt mit Saxofon, Klarinette, Flöten und himmlischen Harmonien, werden einige Songs von Milt Jacksons federnder Perkussion vorangetrieben. Der Albumtitel spielt auf Mitchells neues Zuhause in Laurel Canyon/ Los Angeles an, wo sie zu der Zeit mit ihrem neuen Lover Graham Nash lebte. Die größten Songs stehen ganz am Ende: „Woodstock“, „Big Yellow Taxi“ und „Circle Game“, eine Antwort auf Neil Youngs „Sugar Mountain“, bei der Crosby, Stills und Nash im Chor singen. (4,5)
BLUE (1971)
Die Mutter aller so genannten „persönlichsten Alben“, die Songwriter in den folgenden Jahrzehnten veröffentlichen sollten. Auf „B/ue“gibt es kein Versteckspiel mehr hinter Romantizismen oder schlauen Metaphern. Direkter und schonungsloser hatte noch niemand seine Ängste und Unsicherheiten auf einem Popalbum offenbart. Die Stimme ist von emotionaler Nackheit, die Songs sind Klassiker, „River“ und „A Case Of You“ bis heute die Gipfel von Mitchells Songkunst. Dass ausgerechnet James Taylor, der selbstmitleidigste und zugleich selbstgerechteste aller Liedermacher, damals der Mann an ihrer Seite war, ist eine Ironie des Schicksals. Als Harmoniesänger ist er natürlich meisterlich. (5)
FOR THE ROSES (1972)
Zurück zur Natur! Das Cover deutet es mehr als an. Innen drin sogar Joni im Eva-Kostüm. Nach der Katharsis „Blue“ zog sie sich in ein Holzhaus in der kanadischen Wildnis zurück. Seltsam, dass das Ergebnis dieser Klausur in Mitchells 7Oer-Kanon dem am nächsten kommt, was man ein Rock-Album nennen könnte. Erstmals spielt sie Songs mit Rhythmusgruppe, im Country-Pop „You Turn Me On (I’m A Radio)“ versucht sich Graham Nash an einer dylanesken Mundharmonika, die Texte kreisen fast obsessiv um den Starstatus, den Mitchell mit „Blue“erreichte. Die freien Jazz-Phrasierungen deuten schon auf spätere musikalische Entwicklungen. In dieser Reinheit und Schönheit bleiben sie aber einzigartig. (4,5)
COURT AND SPARK (1974)
Bob Dylan soll eingeschlafen sein, als Mitchell ihm ihr erstes durchweg „elektrisches“ Album vorspielte. Vielleicht hat er sich auch nur vor einer Würdigung dieser perfekt polierten Pop-Perle drücken wollen. Mit „Help Me“, „Free Man In Paris“ und „Raised On Robbery“ enthält das mit allerlei Prominenz von Robbie Robertson bis Jose Feliciano aufgenommene Album Mitchells eingängigste Stücke. Die waren Schätze sind allerdings die Reflexionen über weibliches Selbstbewusstsein „People’s Parties“, „Same Situation“ und „Down To You“. Laut eigener Aussage Madonnas „coming of age record“. (4,5)
THE HISSING OF SUMMER LAWNS (1975)
Auf ihrem nächsten Album dekonstruierte Joni Mitchell das Singer/Songwriter-Genre. Ihr musikalisches Interesse verlagerte sich von Melodien und Folksongs auf Rhythmen und Strukturen, bei „Jungle Line“ setzte sie gar ein Sample von burundischen Trommlern ein. Das introspektive Song-Ich wich einem mit dezidiert weiblichem Blick erfasstem sozialphilosophischen Panorama, das vom Tracklisting über den Klappentext bis hin zum Cover selbstbewusst als Gesamtkunstwerk auftrat. Für ihr Meisterstück bekam Joni Mitchell im Jahr der Veröffentlichung außer einem freundlichen Telegramm von Paul und Linda McCartney keine positiven Reaktionen. (5)
HEJIRA (1976)
Ein rastloses Album, das zunächst „Travelling“ heißen sollte und mit dem Mitchell sich den männlich kodierten Mythos der Straße zu eigen machte. In ihrer epischen Länge hypnotische Songs, die keine Sekunde stoppen, angetrieben werden von Jazz-Grooves und dem melodischen Bass von Jaco Pastorius. Geschrieben auf einem Trip quer durch die USA von Los Angeles nach Maine (von Südwest nach Nordost die umgekehrte Richtung von Kerouacs „On The Road“). Der Song über Walter „Furry“ Lewis (mit Neil Young an der Harmonika) ist Mitchells erste Referenz an den Blues. (5)
DON JUAN’S RECKLESS DAUGHTER (1977)
Nach der im selbstironischen Titel aufgegriffenen Gender-Thematik schien Mitchell nun auch ethnische Identitäten durchkreuzen zu wollen. Mit Afro-Perücke und schwarz geschminkt lief sie über den Hollywood Boulevard und kostümierte sich für das Cover ihres nächsten (Doppel-)Albums als black pimp. Ein Besuch des Karnevals in Rio de Janeiro und der neue Lover Don Alias, der mit seiner Percussion-Gruppe schon mit Weather Report und dem Mahavishnu Orchesytra spielte, hatten Mitchell zu afro-latin Rhythmen inspiriert, Saxofonist Wayne Shorter, von da an enger musikalischer Vertrauter, Pianist Michel Colombier und Bassist Jaco Pastorius kreuzen filigran. (4,5)
MINGUS (1979)
Charles Mingus hatte Mitchell für seine Bearbeitung von T.S. Eliots „Four Quartets“ gewinnen wollen, doch Mitchell sah sich außer Stande, Eliots Verse für Mingus‘ Musik zu adaptieren. Wenig später schenkte Mingus ihr sechs Melodien, die er „Joni I-Vl“ genannt hatte. Mitchell schrieb dazu Texte und probierte verschiedene Arrangements. Mingus starb, bevor die Arbeiten an dem Album beendet waren. So wurde aus der anfänglichen Kollaboration eines der ersten Tribute-Alben des Pop. Mitchell schrieb unter Eindruck der Mingus-Autobiografie „Beneath The Underdog“ den Song „God Must Be A Boogie Man“, mischte die atmosphärisch arrangierten, ans Herz gehenden Mingus-Melodien mit privaten Tape-Aufnahmen von Charles‘ Frau Sue und setzte ans Ende eine leider missglückte Adaption des Mingus-Klassikers „Goodbye Pork Pie Hat“. (3,5)
WILD THINGS RUN FAST (1982) Nach den zerebralen Alben Ende der Siebziger begrüßten viele Kritiker die simplen Liebeslieder für Neu-Ehemann Larry Klein auf „Wild Things Run Fast“. Mit „Chinese Cafe“, vielleicht der ersten Reflexion übers Älterwerden eines Künstlers aus Mitchells Generation, ist der Anfang tatsächlich vielversprechend. Doch schon wenn im Titelstück die Gitarre von Steve Lukather aufheult, beginnt man an der neuen Direktheit zu zweifeln. In den besten Momenten, wenn sich die Band zurückhält und Wayne Shorter wie in „Be Cool“ das Solieren überlässt, ist „Wild Things Run Fast gehobener Jazz-Pop. „(You’re So Square) Baby I Don’t Care“ fand den Weg auf George W. Bushs iPod.(2,5)
DOG EAT DOG (1985)
Die amerikanische Gesellschaft unter der Präsidentschaft von Bushs Vorgänger Ronald Reagan war das Thema von „Dog Eat Dog“. Doch die Wut über konservative Politiker, Scharlatane und „snakebite evangelists“ stand Mitchell nicht sonderlich gut. Blinder hat die Frau mit dem Blick einer Malerin nie getextet. Von der musikalischen Kurzsichtigkeit mal ganz zu schweigen. Zwar geht Co-Produzent Thomas Dolby nicht ganz so unsensibel zu Werk wie Arthur Baker auf Bob Dylans „Empire Burlesque“, doch der Zeitgeist hat „Dog Eat Dog“ auch musikalisch fest im Griff… (2,5)
CHALK MARK IN A RAINSTORM (1988)
…und ließ auch auf dem Nachfolger nicht locker. „My Secret Place“, ein anämisches Duett mit Peter Gabriel eröffnet das – Gott sei Dank! – letzte Mitchell-Album dieser für alte Helden so unerfreulichen Dekade. Weitere „Stargäste“ (auch so ein Wort aus den Achtzigern): Billy Idol, Tom Petty, Don Henley, Wendy & Lisa… Die wenigen Höhepunkte von „Chalk Mark…“ weisen in die Vergangenheit: das Remake von Bob Nolans „Cool Water“ mit Duettpartner Willie Nelson und das Traditional „A Bird That Whistles“, das schon der the freewheelin‘ Bob Dylan unter dem Titel „Corrina Corrina“ sang. (2,5)
NIGHT RIDE HOME (1991)
Ein intimes Folk-Jazz-Album, eingespielt mit kleiner Band. Wayne Shorter spielt in dem Vergewaltigungsdrama „Cherokee Louise“ sein einfühlsamstes Solo für Mitchell, die federnde Perkussion nimmt die Weltmusik-Einflüsse von „The Hissing Of Summer Lawns“ wieder auf, mit „Night Ride Home“, „Passion Play (When The Slaves Are Free)“ und „Nothing Can Be Done“ schreibt Mitchell ihre besten Songs der letzten 15 Jahre. Seit „Hejira“ hat sie kein Album mit dieser stilistischen Geschlossenheit kreiert. (4)
TURBULENT INDIGO (1994) Grunge und „MTV Unplugged“ hatten die artifiziellen Achtziger Anfang der Neunziger wieder aufgehoben. Das neue Interesse an „handgemachter“ Musik schuf auch ein günstigeres Klima für Sixties-lkonen. Auch Joni Mitchell profitierte als untypischste Vertreterin der „coolen Alten“. „Turbulent Indigo“, ein Album, das sich wie „Dog Eat Dog“ in harschen Texten mit dem Zustand der Welt beschäftigte, wurde als Comeback gefeiert. Musikalisch kommt das Album ohne die aufgesetzte Wut der Achtziger aus, hat aber auch nicht den flow von „Night Ride Home“. Im besten Song, „Last Chance Lost“, verarbeiten Mitchell und Bassist Larry Klein ihre gescheiterte Ehe. (3)
TAMING THE TIGER (1998) „Harlem In Havana“, das Eröffnungsstück des bis heute letzten Mitchell-Albums mit neuen Songs, ist aufregender als alles auf „Turbulent Indigo“ und abenteuerlustiger als alles seit „Mingus“. Der über die Jahre abgedunkelten Stimme steht das Jazz-Idiom – etwa auch im anrührenden „Man From Mars“ – besser als je zuvor. Doch Mitchells Vorliebe für seltsame Ambient-Gitarren lässt viele der minimal arrangierten Stücke konturlos dahinplätschern. (3)
BOTH SIDES NOW (2000)
Zu einer Zeit, als viele Popmusiker ihre künstlerische Bankrotterklärung in Form von geschmäcklerischen Interpretationen alter Jazz-Schlager abgaben, erzählt die Spezialistin für zwischenmenschliche Beziehungen die Geschichte der modernen Liebe vom ersten Flirt bis zur Verzweiflung und Verarbeitung ebenfalls mit Stücken aus dem American Songbook (und zwei eigenen Songs). Doch Joni Mitchell offenbart sich als kongeniale Interpretin, bringt die alten Stücke wieder zum Klingen, arrangiert sie wie die Farben eines ihrer Bilder und setzt sie perspektivisch in ein neues Licht. (4)
TRAVELOGUE (2002)
Joni Mitchell reist noch einmal durch ihre 16 Studioalben mit eigenem Material, interpretiert alte Stücke auf ähnliche Weise wie die Jazz-Standards auf „Both Sides Now“. Die Begleitung auf diesem Doppelalbum ist mit Wayne Shorter, Herbie Hancock, Brian Blade und Billy Preston exzellent. Ausgerechnet „God Must Be A Boogie Man“, durch das man sich auf „Mingus“ noch quälen musste, bevor Mitchell erstmals als Jazz-Croonerin überraschte, ist grandios. (4)