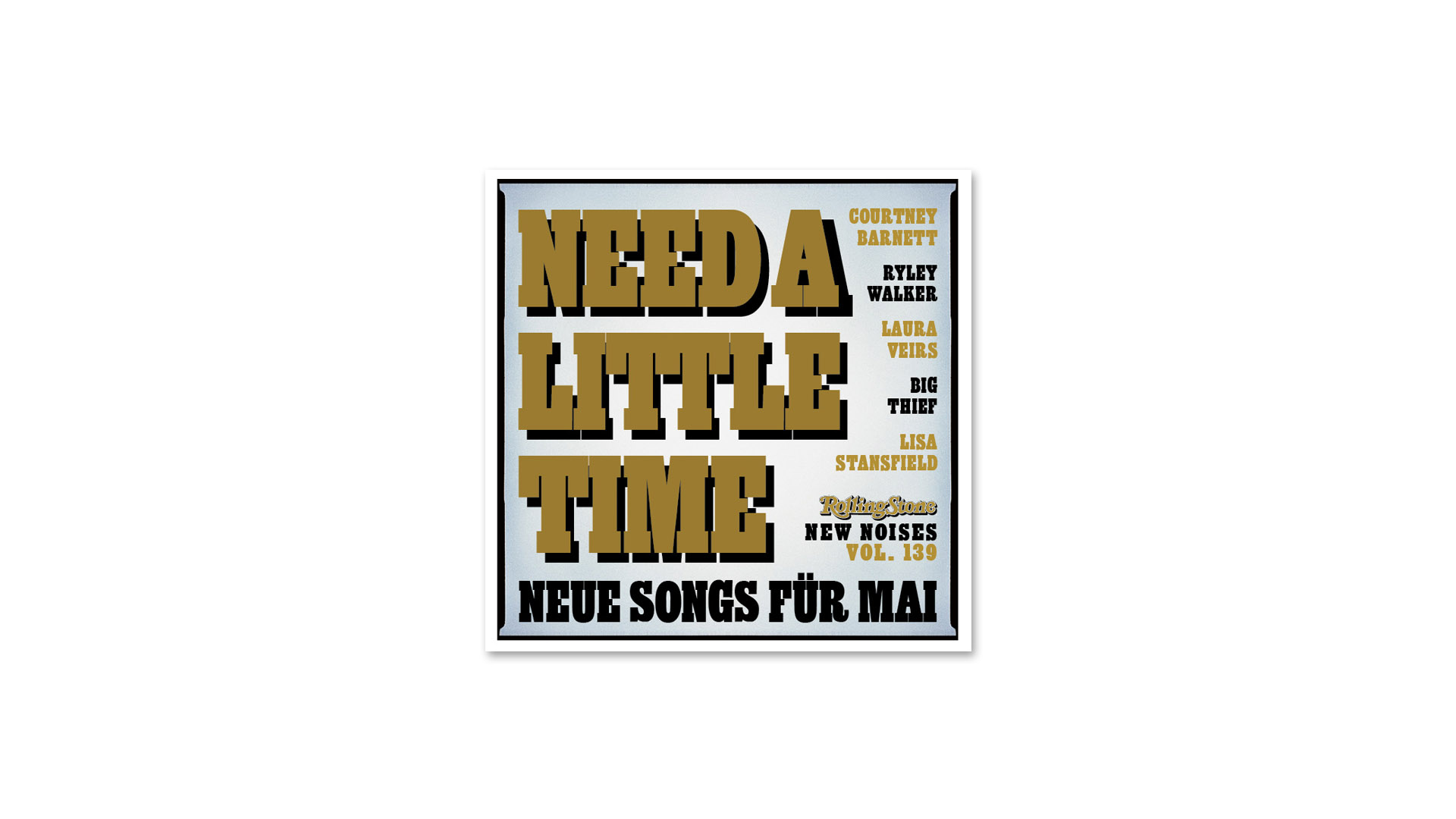Laura Veirs – Saltbreakers
Eigentlich ist Laura Veirs fertig. Das letzte, fabelhafte Werk, „Year Of Meteors“ brachte die naturalistische Mystik der mittlerweile in Portland lebenden Sängerin sowohl lyrisch als auch musikalisch auf den Punkt – etwas tatsächlich anderes war da entstanden, in all den Gesängen von Meerjungfrauen, weißen Spinnen, Feuerschlangen und nächtlichen Tauchgängen in die geheimnisvolle See. Zumal Veirs‘ Produzent und Trommler Tucker Martine den an sich nicht unbedingt revolutionären Songwriter-Folk in ein Klanguniversum übersetzte, das die textlichen Vorlagen faszinierend eigenwillig kolorierte. Dass Martine auch viel weniger verspielt und richtiggehend traditionell aufnehmen kann, hat er unlängst mit „The Crane Wife“ von den Decemberists bewiesen. Tucker Martine! Einen besseren Produzenten hat der Nordwesten der USA momentan nicht zu bieten.
Das neue Album von Laura Veirs, für das sich dieselbe Crew zusammengefunden hat wie zuletzt (sogar Bill Frisell spielt wieder bei einem Song), ist indes nicht nur Naturbetrachtung. Zwar geht es viel um Salz (auf der Haut, im Wasser, in Tränen), die Tiefe des Ozeans, Walherden und Meerjungmänner, doch verwebt Veirs die Symbole mit deutlich persönlicheren Themen. Der Zerbruch einer alten Beziehung, der Beginn einer neuen, Seelentumult, all das lässt die Geologin Veirs wohl etwas nahbarer wirken, macht beim Zuhören aber keinen gar so gravierenden Unterschied.
Denn „Saltbreakers“ buchstabiert zuvorderst das Vokabular aus, das Veirs sich, wie gesagt, mit dem letzten Werk bereits umfassend zu eigen gemacht hatte. „Pink Light“ wird von Martine aus vielen kleinen Puzzleteilen – schön gezupfte E-Gitarre, hibbeliger Elektro-Beat, Geigen, Synthie-Flimmer, überall Stimmen – zusammengesetzt, „Cast A Hook“ schunkelt versöhnlich romantisch zu einer geschrammten Akustik, Glockenspiel, Tremolo-Gitarren und einem sanften Schlagzeug, beim „Ocean Night Song“ summt der Pazifik über einem Gitarren-Picking, während im Hintergrund ein paar Streicher Walgesänge imitieren. So geht Laura Veirs, und natürlich muss eine so eigene Musik zwei, drei Alben lang ausgemalt werden, bevor ein Umstoß Sinn ergeben würde. Apropos Pazifik: Höhepunkt dieser also nicht überraschenden, wohl aber sehr schönen Platte ist ein Lied namens „To The Country“, bei dem ein völlig außerweltlicher, Sufjan-Stevensartiger Chor auf Veirs‘ sanft entrückte Strophen antwortet. Unter diesem verzauberten Lied, das offenbar in einer einst von Johnny Cash und June Carter bewohnten Waldhütte aufgenommen wurde, liegt ein Percussion-Arrrangement, zu dem Veirs sich auf Mali hat inspirieren lassen – da haben wir also doch wieder die Naturkundlerin und Erdmystikerin, die bei allem Beziehungswust nicht auf der Strecke geblieben ist. Ein Glück.