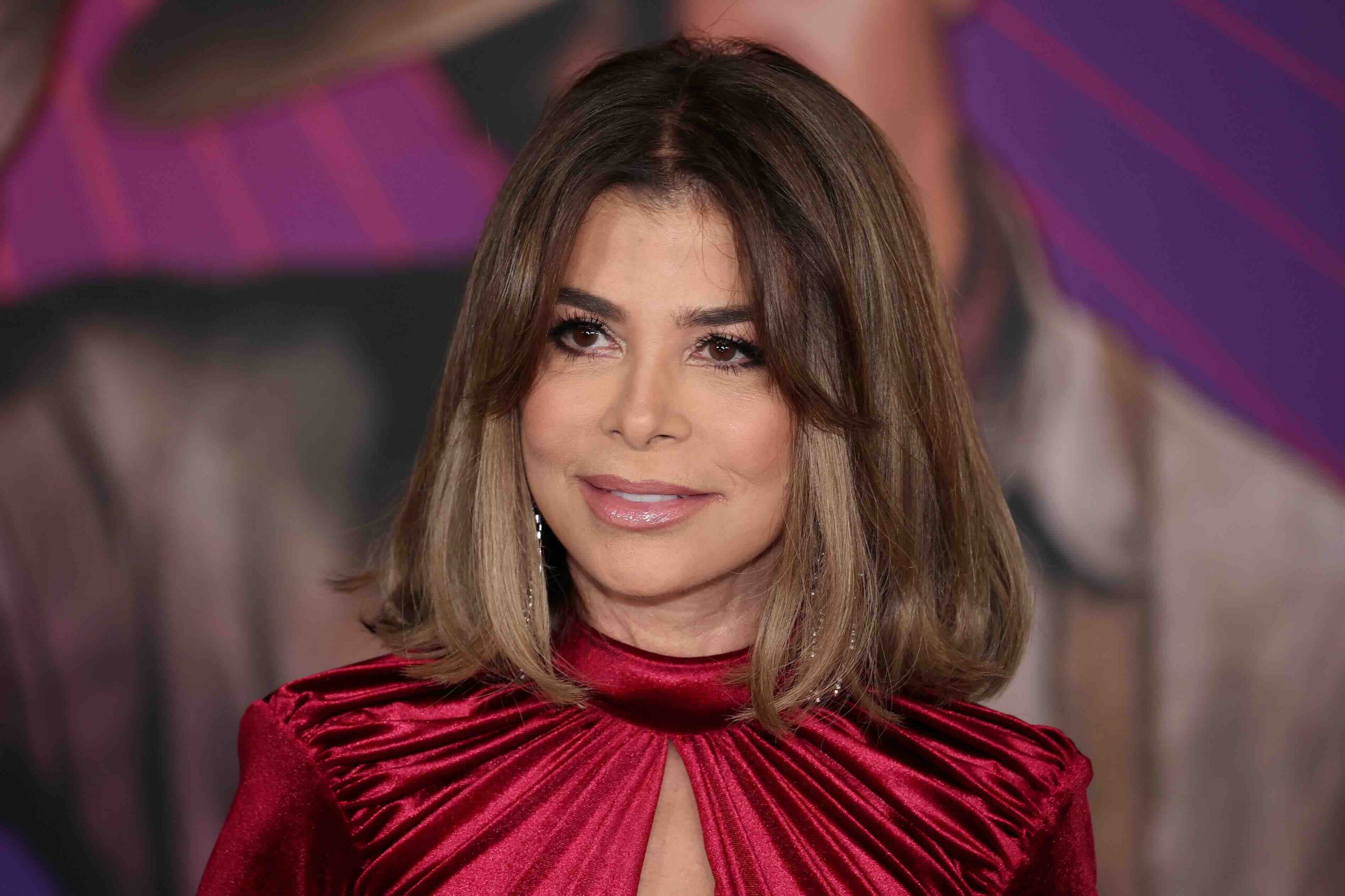THE SEAHORSES – DO IT YOURSELF; CAST – MOTHER NATURE CALLS :: Universal, Polydor
Ende der Eighties war die Pop-Landschaft des United Kingdom in tiefe Dunkelheit getaucht. Nie ward es finsterer in 40 Jahren Britpop. Nur zwei Sterne strahlten hell und klar, der eine über Liverpool, der andere über Manchester: The La’s und The Stone Roses. Ihre Musik war rein und wahrhaftig, spendete Mut und Zuversicht. „There She Goes“ tönte es vom Mersey herüber, „She Bangs The Drums“ ergänzten die Roses. Fanfaren in der Nacht, ein vertrautes und vertrauenswürdiges Morse-Alphabet, das nicht weniger versprach als: it’s gettmg fette?; man. Vbn wegen. Was kam, war Madehester.
Acht Jahre später morsen die Köpfe der La’s und Roses noch immer, beide mit neuen Bands, beide mit neuem Elan. Doch ihre Codes sind allzu vertraut, ihre Motive verdienen kein Vertrauen, ihre Zeichen verheißen keine Zukunft. John Squire, dessen Name einstmals in einem Atemzug genannt wurde mit Johnny Marr, der talentierte Fretboard-Magier, der den Stone Roses ihren unverwechselbaren Sound gegeben hatte, reitet mit den Seahorses vornehmlich Klischees. Hier und da verliert er sich noch in solipsistischen Kreiseln, ist sich selbst genug, deutet seine Klasse an. Dann lehnt er sich wieder bequem zurück, haut ein paar Who-Akkonde raus oder diese angeberischen Led Zep-Gespinste, die das „Secand Coming“ der Stone Roses schon so unnötig beschwert hatten.
The Seahorses sind alles und nichts. Page und Townshend, Beatles und Bluetones, Pop und Progressive, Prä-Hippie-Schlock und Post-Noelrock. Die Gallaghers schweben über allem. In Songtiteln wie „Blinded By The Sun“ oder „Round The Universe“, in Melodie-Plagiaten und Sound-Gefügen. Liam schrieb gar einen Song mit John Squire. Einen guten. Den besten auf „Do It Yourself, und vielleicht heißt die Platte deswegen so. Egal, our boy textet wie sein Gott: „Don’t believe in Jesus/ Don’t believe in Jah/ Don’t believe in the wars we fight/ Just to prove how real we are.“ Very Lennon, very 1969. Da freut sich der Fan in uns, Noel nickt wohlwollend, und Liam, der noble Wilde, spricht: „It was fuckin‘ nothin‘.“ Wohl war.
Die restlichen Texte sind, schwer zu glauben, noch schlechter. Die Produktion von Tony Visconti ist marktgerecht und charakterlos. Musikalisch wartet das Seahorses-Debüt allerdings mit einigen hübschen Überraschungen auf. Der Country-Pop von „1999“ ist in memoriam Brinsley Schwarz und die altertümlich-futuristischen Mellotron-Passagen in „Boy In The Picture“ verströmen den Rüschen-Charme der Moody Blues, circa „Every Good Boy Deserves Favour“.
Schund, aber schön.
Derivate wie diese stimmen versöhnlich und machen den krasseren Kitsch verdaulich. Mit Genuß hat das freilich nichts zu tun, und wenn Sänger Chris Helme einen auf Jon Anderson macht wie im Mittelteil von „Love Is The Law“, kündigen die Seahorses den letzten Konsens, auf den wir alle glaubten, uns verlassen zu können: nie wieder Yes!
Die neue Cast-LP besticht dagegen durch schiere Ereignislosigkeit. John Power hat noch immer ein Händchen für Melodien und feste, griffige Songstrukturen. Das Problem mit „MotherNature Calls“ ‚ist denn auch nicht falsches Zitieren, sondern eine alles durchdringende Harmlosigkeit und Höflichkeit. Mersey-Beat eben. Nirgends schlägt ein Pendel aus, es klampft und klingelt so schauderhaft angenehm, daß es gar keine Art hat. „I just wanna be thinking thoughts that I diink/ Dreaming my dreams and drüting within/ 1 don’t know where I’m going but I know where I been“ dichtet Power verwegen. Mußte ja auch mal gesagt werden.
„The Mad Harter“ und „Soul Tied“ ausgenommen, beides Songs with a purpose, ist dieses Album wie sein Cover: ein schlecht fotografierter Himmel mit fad weißen Wölkchen und fahlem Regenbogen, dazu Bandname und Titel, ebenfalls weiß und in einer supersachlichen Schrift, wie man sie gewöhnlich auf Gebrauchsanweisungen für Staubsauger findet.
Music to vacuum by.