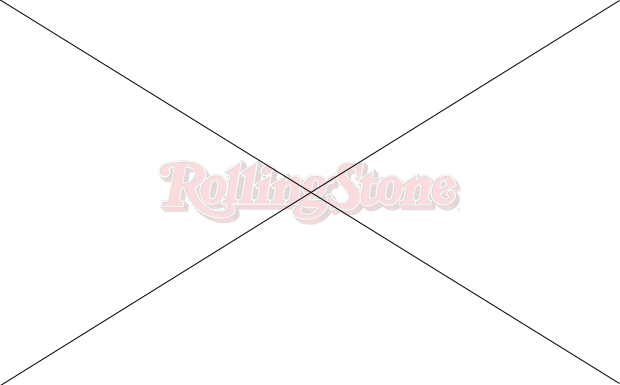Wolfmother – Wolfmother
Oh ja, Wolfmother sind da, aber haben Sie Lust, ausgerechnet jetzt und hier den berühmten Heavy-Rock-Vokabel-Schund zu kriegen? Von fliegenden Gitarren, trommelnden Irrwischen, Bang-Bang-machenden Afro-Köpfen, Magengruben-Grabungen?
Wenn, dann müsste man das schon so sagen: Hey, Wolfmother, der rockende Dreier aus dem australischen Sydney, legt mit seinem ersten Silberling die absolut amtliche Rock-Scheibe des Sommers vor! Fette Gitarren dominieren den Sound, während die treibende Rhythmusgruppe Erinnerungen an beste Zep- und Purple-Zeiten beschwört. Sänger Andrew ist ein echter Shouter. Aufgepasst, Ozzy, hier kommt Konkurrenz! Tipp: Schön einen durchziehen, Hopfenkaltschale bereitstellen und-Anlage auf elf!
Aber zum Glück haben wir gelernt, dass Rocken so einfach ist, dass man niemanden allein dafür zu sehr loben sollte. Und dass trotzdem manche besser rocken als andere. Das junge Trio Wolfmother ist zwar die Band mit den mit Abstand dämlichsten Songtexten der letzten acht Jahre („Life’s not quite what it seems/ In the city of dreams“), ihr Album enthält exakt null Sound- und Struktur-Ideen, die nicht aus dem Hippie-Metal der Siebziger (oder von The Who) stammen, und selbst diese Retro-Idee ist uralt. Dennoch: Diese Musik, dieses Genre wird durch die Dekaden hindurch immer besser und besser, wenn so gute Bands wie Wolfmother sie spielen, mit all dem schrecklich vielen Wissen, mit den Möglichkeiten von heute und dem coolen White Stripes-Publikum.
Ein Album, als ob man im tobenden Gewittersturm die Hülle von Led Zeppelins „Houses Of The Holy“ anguckt. Wie eine Sat 1-Verfilmung des Merlin-Mythos, mit doppelter Geschwindigkeit und hochverzerrtem, am Kopf festgelötetem Surround-System. Die Wolfmutter bringt ein Stück Eisenerz zur Welt, es heißt „Colossal“, und keiner erinnert sich an irgendwas, das tiefer in der Magengrube grub. Doch, gute Platte.