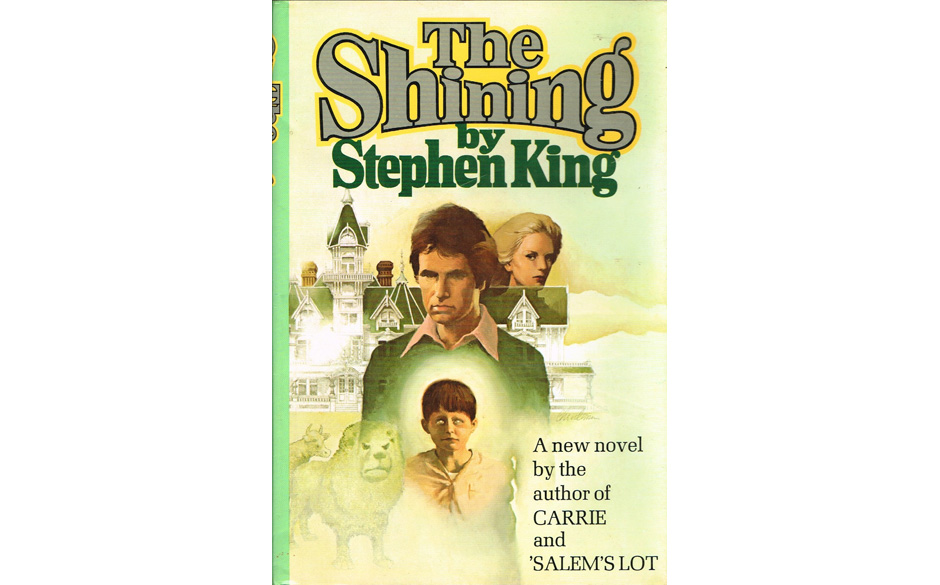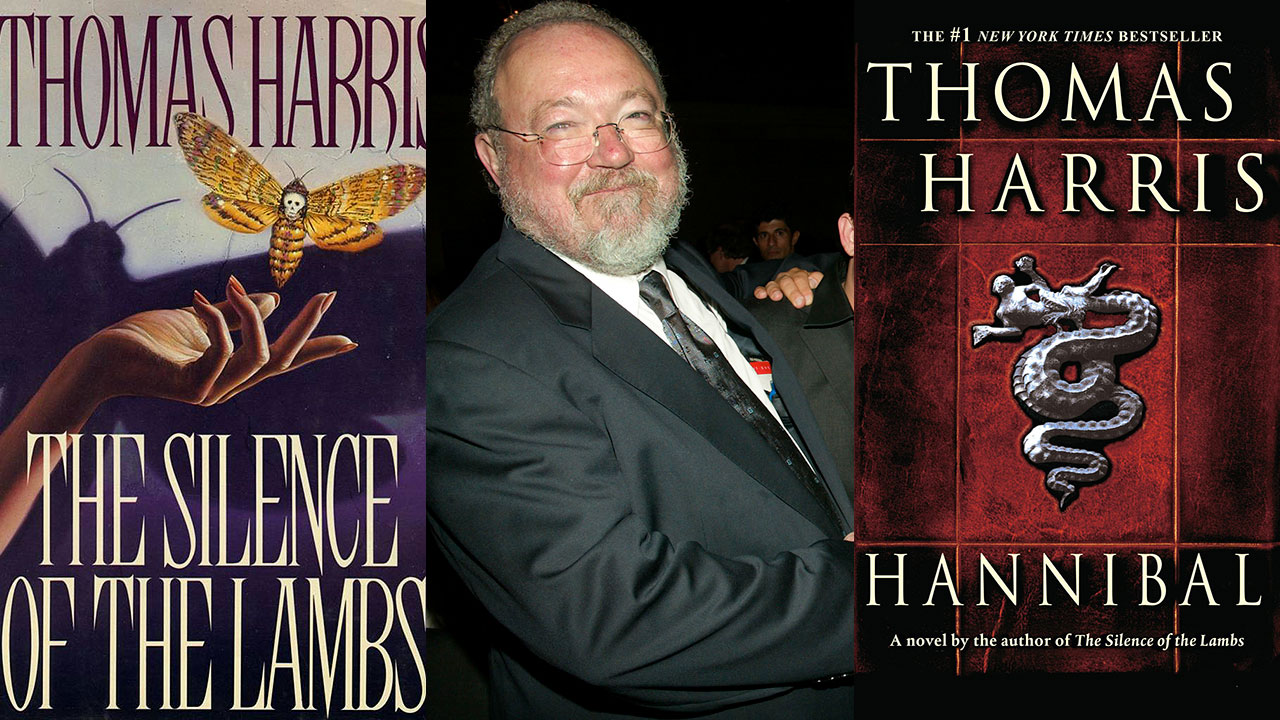Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 20 bis 11
Stephen King: Alle Romane, Kurzgeschichten und Novellen-Sammlungen im Ranking. Sehen Sie hier die Plätze 20-11.
Stephen King – Das Ranking
-
Plätze 81-87
-
Plätze 80-71
-
Plätze 70-61
-
Plätze 60-51
-
Plätze 50-41
-
Plätze 40-31
-
Plätze 30-21
-
Plätze 20-11
-
Plätze 10-01
20. The Dark Tower V: Wolves of the Calla (2003, deutsch: „Wolfsmond“) ★★★★

Stephen Kings wilder Cowboyritt durch die Popkultur. Alles Meta, Meta, Meta. Er liebt ja Harry Potter, also haben die Kämpfer hier Zauberbesenstiele, und die Wurfkugel, Schnaatze genannt, weisen sogar ein eingedrucktes „Harry Potter“-Siegel vor. „Star Wars“-Laserschwerter gibt es auch, außerdem Roboter aus den Marvel-Comics, „Dr. Doom“.
Der Gipfel war natürlich die Rückkehr des Priesters Donald Callahan aus „Salem’s Lot“, nach 28 Jahren – die wohl längste Pause einer Figur, bis Danny Torrance 36 Jahre nach „The Shining“ als „Doctor Sleep“ in Erscheinung trat. Mit Callahans Einbindung in den Turm-Zyklus, so King, erübrigten sich auch stete Nachfragen nach einer Fortsetzung seines berühmten Vampir-Romans (außerdem wird im „Wolfsmond“ erzählt, dass „Lot“-Protagonist Ben Mears in Mexiko längst unter der Erde liegt). „Ich bin keine Erfindung, oder doch?“, fragt der Geistliche, und bereit uns auf die nächste noch kommende, beeindruckende Meta-Ebene vor: Der Roman „Brennen muss Salem“ wird von den Romanfiguren entdeckt, und damit Stephen King als Gott-ähnlicher Schöpfer ins Spiel.
Der fünfte Band wird damit auch zur Vorbereitung auf Stephen King als Romanfigur, der von Roland und seinem Ka-Tet tatsächlich einen Besuch in der echten Welt von Maine erhalten wird. King baute sich selbst ein, weil er seinen eigenen Kampf mit dem Turm darstellen wollte: als vermeintlich nicht zu stemmende literarische Aufgabe, oder, einfach ausgedrückt: Seine eigenen Charaktere müssen ihm in den Arsch treten, damit er die Turm-Romane fünf bis sieben endlich zum Abschluss bringen würde.
Der Revolvermann und seine Freunde werden von einer Dorfgemeinschaft der Calla (= Grenzstadt) Bryn Sturgis engagiert, um die periodische Invasion der Wölfe genannten Reiter in ihr Dorf zu stoppen. Die Wölfe kidnappen aus unbekannten Gründen deren Kinder, die später mit geistiger Behinderung zurückkehren.
„Bryn Sturgis“ ist ein Wortspiel aus dem Schauspieler Yul Brynner und dem Regisseur John Sturges, die 1960 gemeinsam „Die Glorreichen Sieben“ drehten. King liebt den Western, der wiederum auf Akira Kurosawas „Sieben Samurai“ beruht. „Wolves of the Calla“ wird so zu einer „Prepare for Battle“-Erzählung, die auch losgelöst vom Schlussspurt der finalen „Dark Tower“-Romane und der Suche nach dem Turm funktioniert. Eine sich selbst genügende Geschichte mit großen Fights also.
Dazwischen der erzählerisch gelungene Roboter Andy, King tut sich ja oft schwer in der Konzeption von KI-Figuren; einem erstmals tanzend zu erlebenden Roland, dessen entfesselte Bewegungen wie mit dem Stones-Hit „Honky Tonk Women“ synchronisiert zu sein scheinen; sowie eine Aufarbeitung des Kindheits-Traumas Kings, sich in der Natur den Hintern mit Brennnesseln abgewischt zu haben (hier trifft’s Eddie Dean).
Es ist schön, den Priester Callahan zurückzuhaben, wenn auch nur für kurze Zeit. Der vom Glauben abgefallene Priester galt ja nach seinem Vampirbiss für Jahrzehnte als verschollen. Nun klärt er mit Roland Deschain seine Vertrauensfragen, aber auch eine andere wichtige: „Hatten die Red Sox endlich einmal die World Series gewonnen, als ihr Amerika verlassen habt?“
19. Desperation (1996, deutsch: „Desperation“) ★★★★

Noch vor „The Green Mile“ das zweite bedeutende Buch aus dem Jahre 1996. „Desperation“ wurde benannt nach einem fiktiven Örtchen auf der U.S. Route 50 in Nevada, getauft als „Loneliest Road in America“ (was durchaus auch als Marketing-Slogan verwendet worden ist).
Ist religiöser Glaube ein Mittel gegen das Böse? King hat sich immer widersprüchlich zum Thema Gott geäußert, es scheint bis heute nicht klar, ob er an den alten bärtigen Mann glaubt, eigentlich sollte man davon ausgehen, schreibt er doch über das Übernatürliche und fast nichts Anderes. In diesem Roman wollte er zum Ausdruck bringen, dass Leidensfähigkeit eine wichtige Eigenschaft ist, um Gottvertrauen herzustellen – und vor allem zu erhalten.
Der Schriftsteller Johnny Marinville, als Ex-Suchtkranker und „Jerry Garcia“ der Literaturszene“ in gewisser Weise ein alter ego Kings, übernimmt hier die Funktion des Zynikers, der im Laufe der Ereignisse zum Geläuterten wird. Der echte Gottesgläubige ist der kleine Junge David, der seine Familie an das Minenmonster Tak verliert und überzeugt davon ist, dass dies himmlischer Wille war. In der Auseinandersetzung zwischen Rockstar-Autor und bibelfestem Bub entstehen einige der pointiertesten Wortgefechte in diesem Roman.
King nutzt „Desperation“, um viele seiner Standpunkte („Gott, ich hasse Kritiker!“) bis zu Redewendungen („dunkler als eine Wagenladung voller Arschlöcher“) unterzubringen.
Vor allem aber funktioniert „Desperation“ auch als bösartige Parodie auf amerikanische Wüstenkäffer. Eigentlich misstraut jeder jedem, und der örtliche Cop führt sich auf wie ein Diktator. Es ist die Country-Hölle, in der die Leute ausrufen: „Ich bin ein schwerbewaffneter, Eistee-trinkender, bibelfester, unruhestiftender, Clinton-hassender Hurensohn!“
Collie Entragian heißt der Sheriff, beseelt von Tak. Er begleitet uns leider nicht durch den kompletten Roman, aber er ist Hauptfigur einer der spannendsten Eröffnungs-Sequenzen Kings. Es muss ein entsetzliches Gefühl sein, wenn man bei einer Verkehrskontrolle angehalten wird und einem erst nach und nach dämmert, dass Urvertrauen in staatliche Autoritätspersonen ein Riesenfehler sein kann.
18. The Tommyknockers (1987, deutsch: „Tommyknockers“) ★★★★

Alle hassen dieses Buch, King am meisten. Er sagt, er sei beim Schreiben so high gewesen, dass er sich kaum an die Arbeit erinnern konnte. Dabei sind seine Schilderungen der Alien-süchtigen mit der gläsernen oder gallertartigen Haut so hinreißend beschrieben, wie es vielleicht nur Süchtige beschreiben könnten. Auf deutsch mehr als 1.000 Seiten! Selbst die Hauptfigur, ein alkoholkranker Dichter, ist eine durch und durch sympathische Person. Retten vor den bösartigen Außerirdischen wird es ihn nicht.
Jim „Gard“ Gardener, der Poet an der Flasche, und Bobbi Anderson, die nach dem Raumschiff lechzende Heimatschriftstellerin, sind Junkies, eine klassische Zweckgemeinschaft, sie arbeiten zusammen, und doch nebeneinander her, haben indifferenten Sex, blicken gemeinsam nach vorn, sich selbst aber nie an, nur ein Ziel vor Augen: das gigantische UFO im Wald ausbuddeln, über dessen kleinste Spitze Bobbi beim Spazierengehen gestolpert war.
Gardener treiben andere Motive an als die Junkies – eine Stahlplatte im Kopf macht ihn, ganz im Gegensatz zur übrigen Stadtgemeinschaft, immun gegen die Einflüsterungen im Inneren des Schiffs, die alle zu Außerirdischen machen. Bobbi Anderson bleibt dabei recht blass, wird mehr und mehr zur Nebenfigur, womöglich ist auch das nur logische Konsequenz aus einer Erzählung, in der es um Menschen als Werkzeuge geht.
Es ist Kings große Kunst, den Höhepunkt dieser sehr langen Erzählung früh zu offenbaren, das wird natürlich die Öffnung der UFO-Luke sein, und den Leser gleichzeitig in Erregung zu halten. Für King ein Novum, derart linear die Ereignisse auszubreiten – aber nun, das Raumschiff ist ja auch riesig, und am Anfang machen auch noch nicht alle Menschen aus Haven bei der Ausgrabung mit.
Der deutsche Buchtitel („Das Monstrum“) ist wieder einmal unsinnig gewählt, geradezu dämlich: Es handelt sich bei den wie Reptilien aussehenden Tommyknockers nicht um klassische „Monstren“, selbst das UFO, das von einem Geist gesteuert zu sein scheint, ist kein Monster. Es handelt sich bei diesen außerirdischen Wesen um technisch entwickelte, aber emotionale recht unterentwickelte, zweckorientierte Wesen: eher einem Erhaltungstrieb folgend, reisen sie durchs All auf der Suche nach Rassen, die sie assimilieren können. Es ist ihre Gefühllosigkeit, ganz im Geiste der Body Snatchers, die sie so bedrohlich macht.
Elendig gekürzter Roman
King würzt die Story mit seinen härtesten politischen Angriffen seit den Endsiebzigern, als er, wie, in „The Dead Zone“ oder „Firestarter“, Nixon, Vietnam-Politik, die Republikaner sowie die staatlichen Geheimdienste attackierte. Hier ist es die Angst vor einem Nuklear-Unfall, vor einem zweiten Tschernobyl („The Tommyknockers“ erschien ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe) oder Three Mile Island, die Gardener zur Wut treiben. Nur, dass sein Publikum ihn, den betrunkenen Dichter, nicht für voll nimmt. War Johnny Smith („The Dead Zone“) eine Stimme der Vernunft, ist Gardener ein prügelnder Chaot, der mühelos zwischen Philosophie und Gelall changiert.
Das Buch hat einige Schwächen; nicht alle Episoden aus der Stadt Haven (die, wie so viele King-Kleinstädte, fast nur von schwachen, korrupten oder kaltherzigen Menschen bevölkert und am Ende einfach vom Erdboden gewischt wird) sind der Rede wert. Der fliegende, mörderische Cola-Automat ist recht blöd; Bobbi Andersons höchst misanthropische Schwester, die eine der besten Nebenfiguren seines Schaffens überhaupt zu werden drohte, findet ein schnelles, unrühmliches Ende – einfach schlecht geplottet.
Auf Bestseller getrimmte Bücher durften damals nie so richtig lang sein – dieses Schicksal teilten sie bis in die Neunziger auch mit dem Kino, bis „Titanic“ 1997 der erfolgreichste Film aller Zeiten wurde. Leser nicht überfordern, schon klar, etc usw.! Nur so lässt sich – obwohl: nein, nicht wirklich! – verzeihen, dass „The Tommyknockers“ auf deutsch ähnlich gekürzt erschien wie „It“. Womöglich fühlte sich der deutsche Verlag auch dem Druck ausgesetzt, ein King-Buch nach dem anderen pünktlich auf den Markt bringen zu können. Dieser Kürzungs-Wahn hatte dem Leser 1987 aber auch eines der schönsten King-Enden verdorben.
Das Buch schließt in Wirklichkeit nicht mit Gardeners Abflug ins All, sondern mit den beiden kleinen Brüdern David und Hilly, die sich endlich wieder in die Arme schließen können. Der kleinere Hilly musste zuvor auf Altair 4 ausharren und leiden – ein karger Planet ohne Atmosphäre, auf den die Tommyknockers Problemfall-Menschen schicken, die dort verzweifelt nach Sauerstoff schnappen.
17. „It“ (1986, deutsch: „Es“) ★★★★

Kaum einer hätte nach „The Stand“ und „Shining“ damit gerechnet, dass King sein bis heute populärstes Werk erst noch veröffentlichen würde, in den 1980er-Jahren. Wehmütig, aber auch brutal erzählt er von einer Jugend in den 1950er-Jahren. Der Clown aus der Hölle, Kinderfresser Pennywise, ist eine von Kings berühmtesten Figuren geworden.
Mit dem vor 33 Jahren veröffentlichten Buch wollte King die Ängste seiner Vergangenheit ein für alle mal beerdigen, ironischerweise wird das Buch, nicht zuletzt durch die jüngste Verfilmung, am Leben gehalten wie kein zweites des Horror-Schriftstellers.
„It“ ist wie eine Ray-Bradbury-Kindheit im Blutrausch; mit einem Blick hinter die Fassade kleinbürgerlicher Städte, und Entdeckungen der jungen Menschen, an die kein Erwachsener glauben will. Deshalb müssen die Kids ihr Schicksal in dieser durch und durch verpesteten Stadt (für King war das fiktive Derry Sinnbild alles Schlechten) selbst in die Hand nehmen. Einer der Jungen will den von „Es“ ermordeten kleinen Bruder rächen. Der wollte im Regen mit seinem Papierboot spielen, man fand ihn, einen Arm abgerissen, vor einem Kanalisationsschacht.
Die Faszination an „It“, das in Sonder-Editionen immer wieder neu aufgelegt und in den Kritikerlisten als Höhepunkt in Kings Schaffen bezeichnet wird, ist ungebrochen. Sein bis dahin dickstes Buch, King arbeitete seit 1982 daran, markierte auch das Ende seiner bis dato längsten Roman-Pause (fast zwei Jahre nach „Thinner“), und erschien – wie verantwortungslos müssen die Verantwortlichen eigentlich sein – auf Deutsch um nahezu 500 (!) Seiten gekürzt. Die Jahrzehnte später veröffentlichte komplette Übersetzung brachte es dann auf mehr als 1500 Seiten.
Werwolf, Mumie, Vampir und alles andere auch
Die geniale Betitelung (gibt es einen besseren Titel?) lässt Raum für alle Assoziationen. Was aber machte die Klasse des Buchs aus? Zum einen wollte King sich vom klassischen Horrorroman nach „It“ verabschieden, mehr noch: das letzte Wort haben, deshalb baute er etliche Monster in die Erzählung ein. „It“ ist ein Gestaltwandler: Werwolf, Mumie, Vampir und alles andere auch. Zum anderen beinhaltet das Werk zwei Zeitlinien, 1958 sowie 1985: Das namenlose Wesen verfällt alle 27 Jahren in den Tiefschlaf, erste Spuren des Monsters finden sich in der Chronik Derrys ab dem 14. Jahrhundert. Als Kinder wie als Erwachsene versuchen die sieben Mitglieder des „Klubs der Verlierer“ die Kreatur zu töten. Sie finden ihn in der Kanalisation.
Am besten sind die Passagen, in denen tatsächlich die Freuden des Sommers beschrieben werden, hier wird King zum Heimatschriftsteller seines geliebten Maines. Das Versteck der Kinder im Wald, die selbst gebauten Dämme, das selbst gekaufte Eis in den Ferien. Der erste Kuss, die Schmetterlinge im Bauch. Obwohl King mit Henry Bowers einen zusätzlichen – menschlichen – Antagonisten ins Spiel bringt, mutet dessen Action und die seiner Gang geradezu humoresk an; wie in einem Katz-und-Maus-Spiel erwischen Bowers und Freunde immer irgendwie einen des „Klubs“ auf der Straße und jagen sie, bis das Blut fließt. Und die Eltern sind jedesmal hilflos. Gelungen erzählte Kinderfreundschaften haben ihren besonderen Reiz, besonders in den 1980er-Jahren war das Kino voller solcher Geschichten, wie in den „Goonies“ oder „E.T.“. Auch deshalb ist „Es“ heute so beliebt und erschien zum perfekten Zeitpunkt veröffentlicht. Die erste Staffel der Retro-Serie „Stranger Things“ huldigt auch dem Kleinstadt-Gang-King.
Wer auch nur ein wenig Fantasie besitzt, muss sich vor Clowns gruseln, auch diese Assoziationen hat King mit „It“ noch verstärkt; auch wenn Ronald McDonald schon gute Vorarbeit geleistet hatte. Wirkungsvoll sind Pennywises gegen den Wind fliegende Ballons oder die Kinderstimmen aus dem Ausguss.

Eine der vielen Kampfszenen ist gerade deshalb gelungen, gerade weil der Leser weiß, was ihn erwartet. Beim Einbruch in ein verlassenes Haus hören die Kinder es sofort vom Dachgeschoss aus rumpeln, etwas flitzt die Treppen runter, und da steht er auch: der Werwolf. Es kommt zur Verfolgungsjagd Kinderfahrrad gegen Lykanthrop, und dass es sich bei dem Drahtesel namens „Silver“ um ein liebevoll gepimptes Stück Kindheitsfreude handelt, verstärkt die Kraft dieser Szene, die ein gutes Ende nimmt, noch.
Die meisten Besprechungen des Romans vernachlässigen die Mythologie von „Es“. Es handelt sich nicht um ein Fabelwesen, dass der Teufel zur Plage der Menschheit erschaffen hat. „Es“ ist ein Außerirdischer, der vor Jahrtausenden mit einem Komet auf der Erde gelandet und danach in Tiefschlaf verfallen ist. Die Kinder machen während einer indianischen Seancé diese Entdeckung, die zu den größten Überraschungen der Geschichte zählt.
Aber nicht alle Schocker sind gelungen. Das Problem sind die Monster-Charaktere an sich: Wer hat heute noch Angst vor Mumien, Werwölfe, Vampiren? King setzt dazu auf einen schnell abnutzenden Ekel-Faktor (Heuschrecken in Glückskeksen, Maden in verfaulenden Gesichtern). Irgendwo taucht, King wollte es wohl wirklich wissen, auch sein durchgedrehtes Mörder-Auto Christine auf. Später setzt sich „Shining“-Koch Dick Hallorann gegen rassistische Brandstifter zur Wehr. Wie in einer Geisterbahn scheint alle fünf Minuten ein neues Monster um die Ecke zu kommen. Es ist lustig, dass die meisten Kritiker an den aktuellen „Es“-Verfilmungen die Jumpscares bemängeln: zu viele, und zu prominent positioniert. Aber genau das ist doch auch die Buchvorlage: eine einzige Sammlung von Jumpscares!
Die Lektion im „ultimativen Horror“ kann King hier, weil es wenig auf Fantasie ankommt, stattdessen auf Verstümmelung und Mord, nicht erteilen. Am Ende bedient sich King eines Kniffs, den er oft, vielleicht zu oft anwendet: Er lässt Derry, so wie so viele seiner missratenen Städte, wie Salem’s Lot oder Haven, durch einen Sturm, Gottes gerechte Strafe, absaufen, untergehen, verbrennen.
Das Ensemble des „Klubs der Verlierer“ ist Kings am aufwendigsten strukturiertes seit der Helden-Mannschaft aus „The Stand“, aber dieses kommt nicht ohne Klischees aus. Es gibt den dicklichen, hoffnungslos verliebten Ben; die rothaarige, deshalb natürlich aufsässige, von ihrem Vater misshandelte Beverly; den Asthmatiker Eddie, der an dem Monster wachsen und natürlich sein Atemgerät bezwingen soll; die Hauptfigur Bill – „Stotter-Bill“, der sein Stottern besiegen muss. Mit der im Schluss-Spurt eingeführten, gottähnlichen „Schildkröte“ als größten Feind von „Es“, drosselt King das Tempo gefährlich ab. Während Bill in den Kampfmodus wechselt, philosophiert die Amphibie über den Kosmos, will ihm damit aber eigentlich Ratschläge erteilen. Das ist keine gute Montage zweier Erzählstränge.
Auf den letzten Seiten kriegt King uns dann doch wieder. Die Überlebenden aus dem „Klub der Verlierer“ werden älter, ziehen in alle Himmelsrichtungen und fangen an zu vergessen. Zu vergessen, dass sie einst Freunde waren, sie vergessen einander, und sie vergessen, dass sie einst die schlimmste Kreatur des Universums getötet und damit unzähligen Kindern, die später an die Reihe gekommen wären, das Leben gerettet haben. Sie wissen nicht mehr, was einst war.
King geht dann als Erzähler in eine Art auktorialen Modus und stupst uns an: Das, was die „Verlierer“ erleben, ist wie das Aufwachsen. Man kann die Kindheit nicht zurückholen, im Gegenteil, die meisten Erinnerungen verschwinden. Leider auch die schönen. Das ist vielleicht der härteste, sicher der ehrlichste Schluss, den King uns hier hätte präsentieren können.
Bill steigt noch ein letztes Mal auf sein Fahrrad „Silver“, das er als Kind so geliebt hatte. Er weiß gar nicht mehr, warum. Aber rettet damit ein Leben.
16. „Billy Summers“ (2021) ★★★★

Stephen King ist befreundet mit Lee Child, dem (Ex-)Buchautor der phänomenal erfolgreichen und phänomenal guten „Jack Reacher“-Reihe. In seinem Roman „Under The Dome“ von 2009 schenkt er dem ehemaligen Militärpolizisten Reacher sogar eine staatstragende Erwähnung. Nach quittiertem Dienst bestraft Reacher als Amerika-Wanderer die bösen Typen, auf die er zufällig trifft, obwohl er eigentlich das Land bereisen will. Nun huldigt King mit Lee-Child-Sätzen erneut dem einsamen Wolf Jack Reacher, einem Mann, der überall ein Fremder bleibt, und der am Ende seiner vielen Abenteuer stets an eine Weggabelung kommt, wo er den Daumen rausstreckt, um mitgenommen zu werden. Kings Protagonist Billy Summers sagt: „Ich will nach Westen oder Norden, beides ist okay. Nur Süden und Osten kommen nicht infrage. Da war ich schon, das kenne ich.“
Vielleicht also kein Zufall, dass King mit „Billy Summers“ einen Roman geschrieben hat, dessen Titel nicht-deskriptiv ist, sondern sich auf die Erschaffung einer Figur zu konzentrieren scheint, dessen Name allein schon von etlichen Leidensgeschichten und Dramen erzählen soll, wie der von Reacher. Und ja, das ist ihm gelungen: Billy Summers ist eine solche Figur, wie es sie im Schaffen des 73-jährigen Schriftstellers schon sehr lange nicht mehr gegeben hat. Komplex, von Selbstzweifeln zerfressen, und doch einem schlichten moralischen Kompass folgend, der sich nicht mehr korrigieren lässt.
Billy Summers ist ein Ex-Soldat in seinen Vierzigern, der für seinen Einsatz im Irak-Krieg als begnadeter Scharfschütze hoch dekoriert wurde. Mittlerweile arbeitet er als Auftragskiller, aber nur, diese moralischen Einschätzungen nimmt er selbst vor, um die „bösen Menschen“ zu töten, nicht die „guten Menschen“. Er erledigt per Kopfschuss einen verurteilten Mörder, kurz bevor der im Gericht einen Deal aushandeln kann, der ihm den elektrischen Stuhl erspart. Summers ist ein sehr intelligenter, schnell kombinierender Mann – auch das hat er mit Jack Reacher gemein – und ahnt, dass er selbst nach dem Mordauftrag erledigt werden soll. Summers taucht nach getaner Arbeit ab und will nun herausfinden, wer ihn ausschalten wollte, und warum.
Kings Problem mit weiblichen Figuren
King macht nicht viel falsch in „Billy Summers“. Wer sich erfolgreich ferngehalten hat von der Beschreibung des Roman-Kurzinhalts durch den Verlag, müsste zunächst befürchten, die Story endet mit dem Gewehrschuss aus einem Hochhausfenster und dessen akribischer Vorbereitung, also einer Art „63/11/22“ light, in dem King minutiös die Vereitelung des Anschlags auf John F. Kennedy schildert. Aber Summers erledigt seinen Job so schnell und unzweifelhaft, wie auch der Autor ihn abhakt.
Die kleinen Schwächen des Romans sind andere. Schwächen, die in den King-Büchern ab den Nullerjahren häufiger zu finden sind. King wird sie vielleicht auch nicht mehr ablegen können. Erstens, er ist bemüht weibliche Figuren zu konstruieren, die aus einer existenziellen Krise stärker hervorgehen – das Wort „Selbstermächtigung“ ist auch im Feuilleton seit Jahren hip –, aber jede seiner Protagonistinnen (Lisey und Holly Gibney zählen zu den bekanntesten) ist stark nur durch die Gnade eines Mannes, der sie aufbaut. Hier die 21-jährige, vergewaltigte Alice, der Summers außerplanmäßig Unterschlupf in seinem Versteck gewährt, und die erst durch den älteren Mentor – in den sie sich verliebt – zur selbstbestimmten Frau wird. In einer selten so deutlich bei ihm vorkommenden Formulierung bringt King zum Ausdruck, dass er selbst mit der Vorstellung hadert, den ihn so quälenden, angeblichen Widerspruch aufzulösen, dass eine Frau potent sein, aber auch ohne den Mann ihren Sinn im Leben finden könnte. Denn: „Die Möglichkeit dazu hat Billy ihr eröffnet. Alice ist angekommen. Sie hat sich gefunden.“ Ohne Billy kein Ziel.
Die zweite Erzählschwäche besteht darin, dass King sich seit Jahren an den republikanischen US-Präsidenten abarbeitet, aber manchmal das Maß zu verlieren droht. Zu Beginn des Jahrtausends war das George W. Bush, ab 2016 Donald Trump. Grundsätzlich ein ehrenvoller Job: Mit dem Bewusstsein, als Schriftsteller Millionen Leser erreichen zu können, schäbige Staatsoberhäupter kritisieren. Aber wie schon im „Institut“ oder im „Dome“ betreibt King ein Namedropping, das bisweilen zum bloßen Symbolismus verkommt. Bevor Summers einen Vergewaltiger niederschlägt, setzt er sich eine Melania-Trump-Maske auf; ein krimineller Immobilienbesitzer trägt eine MAGA-Mütze; Summers verkleidet sich als Mexikaner, um in die Villa eines neureichen Verräters zu gelangen (nicht ohne Grund wollte Trump eine Mauer bauen, um genau sowas zu verhindern!); außerdem gibt es einen Medien-Mogul, dem anscheinend der rechte Sender „Fox News“ gehört, und dessen Alter und Physis an Rupert Murdoch erinnern (der inzwischen immerhin ein Trump-Gegner ist), wobei dessen Lebenswandel jedoch unzweifelhaft an Jeffrey Epstein angelehnt ist. Der Milliardär betreibt einen Prostitutionsring mit minderjährigen Opfern. So charakterfest Kings Anliegen ist – die Vehemenz, mit der er seit Jahren diese fiktiven Stellvertreter echter Scheusale angeht, lenkt von der Geschichte ab.
Eine in Kings Schaffen beispiellose Aktion eines Anti-Helden
Einen pädosexuellen Verbrecher töten zu wollen, fällt Billy Summers nicht schwer, der Täter ist „ein böser Mensch“. Der Pädosexuelle ist das größte Monster unter den Menschen. Mit Summers hat Stephen King jedoch eine seiner wenigen Figuren kreiert, deren eigenes Tun nicht nur ambivalent erscheint. Es bleibt auch bis zum Ende der Geschichte unklar, wie er selbst zu seinem Anti-Helden steht. Gute Menschen dürfen leben, schlechte Menschen sollen sterben, und sei es durch Selbstjustiz. Ein Vergewaltiger wird von Summers selbst vergewaltigt – eine in Kings Schaffen beispiellose Aktion eines Anti-Helden.
Das ist für Summers keine rationale Entscheidung. Der Ex-Marine ist seit seiner Kindheit schwer traumatisiert. Während die USA seit Jahrzehnten über strengere Waffengesetze diskutieren, ist es hier eine Waffe im Privatbesitz, die dem jungen Billy in Notwehr das Leben rettete. Danach kommen die Kinderheime. King verteidigt Summers nicht, und Summers fühlt es selbst: „Er ist nicht besser als diese Typen, sieht den Balken im eigenen Auge nicht, aber es bringt nichts, so etwas zu denken.“ Viele seiner bald 100 Bücher hat King durch inhaltliche Querbezüge verbunden, und auch bei „Billy Summers“ gibt es einen Bezug (wir spoilern ihn nicht), der aufzeigen soll, warum Billy so wurde, wie er ist. King führt damit auch ein übernatürliches Element ein, das zunächst abstrus erscheint. Aber so, wie Billy ein missbrauchtes Kind in einer dysfunktionalen Familie war, so ist auch der Junge aus dem anderen Roman, auf den King anspielt, ein missbrauchtes, das der Familie entkommen muss.
Billy Summers ist ein psychisch kranker Mann, Stephen King schreibt das so nicht, aber gerade durch seine so untypische Distanz zu ihm als Hauptfigur erweckt der Auftragskiller große Sympathien. Es ist Summers‘ Wegbegleiterin Alice, die sich, so wie er, der Schönheit von Literatur hingibt; dem quasi-magischen Gedankenvorgang, dass wir durch das Lesen neue Welten erschaffen. Beide, Summers und Alice, schreiben ihre (gemeinsame) Geschichte auf und konstruieren so für sich ein schöneres Leben, ohne Tod und Flucht.
Der Beginn einer neuen Phase?
Wann hat Stephen King das letzte sehr gute Buch geschrieben? Zuletzt musste man Angst haben, aber nicht wegen dem, was in den Büchern steht, sondern Angst um King – ob er seine Story rund und ohne Logiklöcher nach Hause bringt. Das war ihm in den letzten Jahren so gut wie nie gelungen. „The Outsider“ (2018) entwickelte sich von einem verschachtelt konstruierten Whodunnit zu einem Creature Feature, und „Das Institut“ (2019) scheiterte mit seinem Versuch, den Missbrauch PSI-begabter Kinder als Allegorie auf die Ermordung von Kindern in Konzentrationslagern darzulegen. Bei jedem jüngeren Roman die bange Frage also, ob King die Fäden am Ende zusammenhalten kann.
In „Billy Summers“ kann das nicht passieren, nicht nur, weil es einen halfway plot switch gibt, essenzielle Charaktere erst ab der Mitte des Romans vorgestellt werden. Mit den „Reacher“-Romanen hat „Summers“ weiterhin gemein, dass hinter einem verbrecherischen Plan eine Verschwörung, und hinter dieser Verschwörung eine noch größere Verschwörung steckt. Lee Child kreiert dabei unzählige Twists, also Überraschungen, deren Grundlagen – bestimmte Charaktere, Orte, Pläne – schon früh in der Geschichte ausgebreitet, aber nur angedeutet werden. Am Ende der Knall, die Offenbarung. King macht das nicht – vielleicht kann er es auch nicht: Es gibt in „Billy Summers“ einige Überraschungen, aber sie kommen aus dem Nichts.
Das letzte große Stephen-King-Jahr war 2014, als er mit „Mr. Mercedes“ und „Revival“ zwei bedeutende Romane veröffentlichte. Das eine die unheilvoll prophetische Geschichte über moderne Formen des Terrorismus (Bombenanschläge bei Teenage-Pop-Konzerten, das Auto als Mordwaffe in großen Menschenmengen), das andere eine höchst gruselige Oldschool-Erzählung, angelehnt an Poe und Lovecraft, über die buchstäbliche Hölle, die uns im Jenseits erwarte. Mit dem „Mr. Mercedes“-Ermittler Bill Hodges stellte King erstmals einen Ex-Detective in den Mittelpunkt gleich einer Roman-Trilogie. Er scheint im höheren Alter zunehmend Gefallen an Kriminal- statt Horrorgeschichten zu finden. Er sollte sich darin, das zeigt „Billy Summers“, weiter probieren.
15. Cell (2006, deutsch „Puls“) ★★★★

Vielleicht hätte Stephen King einen ganz anderen Ansatz wählen müssen, hätte er seinen Roman auch nur ein Jahr später geschrieben. Erst 2007 galt als das Jahr, in dem das Smartphone, also das Handy mit Internetfunktion, seinen Durchbruch feierte. Seit der Herrschaft des iPhones telefonieren wir weniger, sondern tippen vielmehr Nachrichten in das Gerät oder surfen im Netz, wann immer wir auf der Straße sind. In „Cell“ ist es ein Tonsignal, das Handynutzer augenblicklich in Zombies verwandelt, sofern sie den Anruf annehmen. Wer würde heute noch einen Anruf mit „Absender unbekannt“ annehmen? Wir tippen doch alle nur noch Messages.
Eine ganze bestimmte Message ist natürlich überdeutlich: Unsere Abhängigkeit vom Mobiltelefon hat uns längst zu Dumpfbacken, also Zombies gemacht. Aber das schmälert nicht den Wert dieser Geschichte. Neu erfinden muss King das Zombie-Genre, dessen „Puls“ kurz nach der Kino-Renaissance der Untoten erschien, eingeleitet durch „28 Days Later“ und das Remake von „Dawn of the Dead“, nicht. Wer kann das schon! Aber er setzt, pun intended, gute Impulse. Diese eher an lernfähige Tollwütige als an schlurfende Untote erinnernden Wesen sind nur tagaktiv, verfügen über Telepathie und Schwarmintelligenz und rotten sich nachts zusammen um an geschützten Plätzen (Kuhlen, Stadien) zu den Klängen von MOR-Rock aus dem Ghettoblaster zu schlummern. Was natürlich bedeutet, dass die normalen Menschen sich tagsüber verstecken und nachtaktiv werden müssen.
In seinen nach 9/11 veröffentlichten Büchern präsentiert King oft, siehe „Under The Dome“, eine Überfülle an politischen Allegorien. Auch „Cell“ wird davon nicht verschont, und er wirkt bisweilen etwas übermotiviert. Schnell wird der Verdacht laut, Terroristen steuern die Angriffe; „Guantanamo Bay“ wird ebenso unergründlich in den Raum geworfen wie „Sprengladungen der Aufständischen“, „muslimische Jugendliche mit Selbstmordgürtel“ und „Bushs irakisches Abenteuer“. Die Überlebenden der Amok-Attacken fragen sich, wo denn die Nationalgarde sei, um sie zu beschützen – im Irak? King beschreibt hier das Szenario einer Bevölkerung, die auch deshalb aufgeschmissen ist, weil deren Militär sich im Ausland verzettelt hat.
Wenn eine Spezies den Kampf um die Herrschaft des Planeten verliert, sich den Platz in der Welt und damit der Nahrungskette neu suchen muss, führt das auch zu philosophischen Neubetrachtungen der Existenz. Oder sollten die neuen Menschen, tumbe Telepathen, etwa die weiterentwickelten sein? In „Cell“ gelingen solche Diskussionen so vorzüglich wie in George A. Romeros „Dawn of the Dead“ und Richard Mathesons „I am Legend“. „Aus Primaten werden Menschen, aus Menschen werden Phoner, aus Phonern levitierende Telepathen mit dem Tourette-Syndrom. Evolution abgeschlossen“, sagt Protagonist Tom. Die ziellos umherstreunenden, plündernden und planlosen Überlebenden wirken auf ihn jetzt wie Höhlenmenschen.
Auch im Wort „Impuls“ steckt der „Puls“, und der Puls ist Teil der Evolution. Nicht zuletzt geht es auch um die Frage, was das Wichtigste an uns ist: Ist Intelligenz bedeutsamer als Instinkt, Vernunft bedeutsamer als eben Impulse?
14. Thinner (1984, deutsch: „Der Fluch“) ★★★★½

Kennen Sie den Buchhändler Stephen Brown? Stephen King wird ihn kennen gelernt haben. Das ist der Mann, der das Pseudonym Richard Bachman entlarvt hat – und King musste nach „Thinner“ seinen Decknamen bis auf Weiteres ablegen. Dem Verkäufer waren Ähnlichkeiten des Romans mit dem Werk Kings aufgefallen, und tatsächlich ist diese Horrorgeschichte weit auffälliger als die sozialpolitischen, dystopischen Stories, die der Autor etwa in „The Long Walk“ oder „The Running Man“ gesponnen hatte.
Ein Kritiker lobte nach Erscheinen des Bachman-Buchs gar, „Thinner“ sei ein Werk, das Stephen King gerne schreiben würde, wenn er es denn könnte. Die Verkaufszahlen schnellten nach der Entlarvung von 28.000 Exemplaren auf 280.000 verkaufte Bücher hoch. So oder so ist „Thinner“ ein großartiges Bachman-Buch geworden.
Detektiv in eigener Sache
Die Geschichte spielt mit der Angst vor Sinti und Roma, die hier Zigeuner genannt werden, vor ihren Hexenzaubern und unerbittlichen Flüchen. Rechtsanwalt Billy Halleck baut einen Autounfall, weil seine Frau ihm während der Fahrt einen geblasen hat. Es stirbt eine ältere Zigeunerin auf der Straße. Deren Gatte spricht einen Fluch aus – gegen Billy, sowie gegen den Richter und einen anderen Polizisten, die daran beteiligt waren, den Totschlag zu vertuschen. Der hochnäsige Jurist beginnt daraufhin abzunehmen. Er wird immer dünner, bis er merkt, dass das nicht mehr toll ist, sondern er an Unterernährung zu sterben droht.
Obwohl die Moral – alle Leben sind gleich viel wert, „Hochmut kommt vor dem Fall“ – etwas schnell wirkt, entwickelt King hier eine seiner spannendsten Ideen, die sicher auch als Kurzgeschichte funktioniert hätte, er aber zum Glück zum Roman entfaltet hat. Die Zigeuner sind stur, bösartig, voller geheimnisvoller Tricks, und King lässt sich dazu hinreißen, sie voller Klischees darzustellen. Der Story, man muss es so sagen, tut das leider gut.
Halleck wird im Laufe der Geschichte zu einer Art trauriger sympathischer Detektiv in eigener Sache, er muss herausfinden, wie der den Trek der Zigeuner auf die Spur kommt, damit er deren alten Patriarchen überzeugen kann, den Fluch wieder zurück zu nehmen.
Was den Verfluchten droht, zeigen die Beispiele des beteiligten Richters und Polizisten. Der eine wurde mit „Lepra“ belegt, der andere mit „Eidechse“. Kings Schilderung der Verwandlung in das Reptil zählt zu seinen eindringlichsten, die Ehefrau will es nicht wahrhaben, der Mann schließt sich ein. Für den Leser wird es geradezu hörbar, wie der Richter über seinen neuen Panzer, der am Bauchnabel beginnt, streicht; ein Kratzen über harte Fläche, das den Tod angekündigt.
Billy Halleck hat Kontakte zur Unterwelt, und mit Richie Ginelli bringt King eine sehr lustige Nebenfigur ins Spiel. Ein Mafia-Boss, der die Auseinandersetzung mit dem bockigen Zigeuner Taduz Lemke als sportliche Herausforderung sieht (er kleidet sich sogar in einen Jogginganzug), und der mit größtem Optimismus das Kommando übernimmt – sich aber einen Spaß daraus macht, seine Aktionen geheim zu halten, damit Halleck umso größeres Erstaunen zeigt, wenn sie gelingen. Am Ende aber muss der zum Skelett abgemagerte Rechtsanwalt selbst aktiv werden.
13. Cujo (1981, deutsch: „Cujo“) ★★★★½

Schnell wie ein Rock-Song, und auch so dreckig und laut, so hat King die simple Geschichte dieses tollwütigen Bernhardiners beschrieben, der eine Mutter und ihren Sohn in einem liegengebliebenen Auto drangsaliert. Einer der wenigen Romane, die nicht direkt übernatürliche Kräfte bemühen – ein Monster im Schrank wird lediglich angedeutet, hinter dem sich der Killer in „Dead Zone“ verbergen und dessen Geist den Hund befallen haben könnte.
Aber dieser Roman kennt dafür auch kein Happy End, obwohl gerade in den letzten 30 Seiten, als die Eingeschlossenen in minutiös geschilderter Eile erreicht werden sollen, alles darauf hinauszulaufen scheint. Umso rührender sind die Schlussworte Kings, der klarstellen will, dass der durchgedrehte Köter vor seiner Krankheit ein liebenswerter Zeitgenosse gewesen ist.
„Cujo“ war für King 1981 ein Wagnis, ein ganzes Buch vordergründig über einen Hund; es ist in die Geschichte eingegangen als der Roman, an dessen Entstehung sich der Autor angeblich nicht erinnern kann – Kings Alkoholabhängigkeit war damals auf einem Höhepunkt angekommen.
Zwar kommen manche der Erzählstränge einer Seifenoper nahe: Affären fliegen auf, der Liebhaber will Rache nehmen, der gehörnte – und recht blass bleibende – Ehemann gerät während einer Geschäftsreise in die Sinnkrise. Aber King erzählt in „Cujo“ auch von wirtschaftlichen Krisen, Existenzängsten und einem Landleben, das zunehmend verlottert. Die Trentons sind Mittelklasse, aber ihr klappriges Auto wird nicht nur das Schicksal der Familie mitbestimmen, es ist auch Symbol für eine nicht mehr funktionierende Gesellschaft. Die armen Cambers wiederum, denen der Bernhardiner Cujo gehört, leben im Streit – der gewalttätige Vater will, dass Frau und Sohn bei ihm bleiben, dabei müssten sie alle wegziehen in die Stadt, wenn sie eine Zukunft haben wollen. Der Hund ist nur Ausdruck für Angst und Aggression.
12. Christine (1983, deutsch „Christine“) ★★★★½

1983 würde als Jahr von drei gleich bemerkenswerten King-Büchern in die Geschichte eingehen. Und mit „Christine“ veröffentlichte er sein bis heute am jugendlichsten wirkenden, wenn auch albernsten Roman. Aber ist Rock’n’Roll nicht auch albern?
Ein Plymouth Fury aus den Fifties verliebt sich in einen adoleszenten Außenseiter der Neuzeit, und umgekehrt. Der Bubi wird immer cooler, und der Oldtimer „Christine“ bringt dafür jeden der Schulhof-Bullys um die Ecke. Wirklich sehr unterhaltsam, auch auf einer laienhaften psychoanalytischen, objektfetischistischen Ebene. So jäh, wie die Pubertät enden kann, endet auch das Leben des Arnie Cunningham.
Dabei soll King aus einer Laune heraus auf die Idee zu dem Buch gekommen sein. Sein Verleger habe ihn gefragt, was nach dem mörderischen Hund Cujo kommen könnte, worauf der Autor halt mit dem „mörderischen Auto“ geantwortet habe.
Zwar geht einem der Humor Kings wieder einmal schnell auf die Nerven – er versucht sich an Teenagerwitzen –, aber zumindest die Konflikte zwischen den Generationen sind stimmig erzählt, Arnies Eltern und die seines besten Freundes und späteren Antagonisten Dennis sind reich an Ängsten und Hoffnungen.
Wie populär Stephen King 1983 gewesen ist, zeigte auch die Geschwindigkeit, mit der die Verfilmung nachgeschoben wurde: Noch im selben Jahr kam John Carpenters Fassung in die Kinos. Das nicht wirklich gelungene Werk demonstrierte auch, was eben nicht funktioniert: Ein fahrerloses Auto erzeugt gefilmt keinen Schrecken; es ist der nicht sichtbare Geist, der einem Angst macht – den man aber eben auch nicht darstellen kann.
11. The Dead Zone (1979, deutsch: „Das Attentat“) ★★★★½

King ist überzeugter Demokrat, glaubt aber nicht an die Versprechen der Politiker. Er verachtet Nixon, wundert sich nicht über Watergate und lässt sich ausgiebig über die Fehler des Vietnamkriegs aus. So politisch war der Autor bislang noch nicht aufgetreten. Harsch ist sein Blick auch hier: Ein Lehrer mit hellseherischen Fähigkeiten hat sich zum Ziel gesetzt einen Präsidentschaftsbewerber zu stoppen, der den Dritten Weltkrieg auslösen wird. Seinen Abgang verschafft sich der bösartige Politiker am Ende selbst, auf die vorstellbar unmenschlichste Weise.
John Smith ist Lehrer, und wie der Name schon andeutet, ein durch und durch normaler Typ – mit gutem Herzen, was ihn zu einem der berührendsten Figuren aus dem King-Kosmos macht. Der Mann wächst an seiner Verantwortung der hellseherischen Gabe, und wenn es ihm sein Leben kostet, wäre aber fast umso froher, wenn man ihm seine Wahrsagerei nicht abnehmen würde. King sagte, er wollte einen Mythos vom Bösen ins Schlechte umkehren: Mit der Ermordung John F. Kennedys galt auch der „Schütze in erhöhter Position“ als Attentäter mit menschenfeindlichen Motiven. Der hoch gelegene Schütze Smith aber war ein Held.
Mit der Nebenfigur des Sheriff Bannerman, bei dessen Ermittlungen in Mordfällen rund um Castle Rock Smith behilflich ist, hat King gleich einen weiteren Sympathieträger geschaffen. In „Cujo“ werden wir ihm wieder begegnen. Greg Stillson, das ist der Name des kriminellen Präsidentschaftsbewerbers – und seit Donald Trump in Amerika an der Macht ist, werden nicht nur John Smith, sondern auch Stephen King hellseherische Fähigkeiten zugeschrieben.
So wie „Big Jim Rennie“ (aus „Under The Dome“) ist Stillson einer, dessen Aufstieg unwahrscheinlich erschien, der sich am Ende aber doch mit Beharrlichkeit durchsetzte. Nach der Wahl Trumps zum US-Präsidenten hat King sich oft zu beiden literarischen Figuren geäußert.