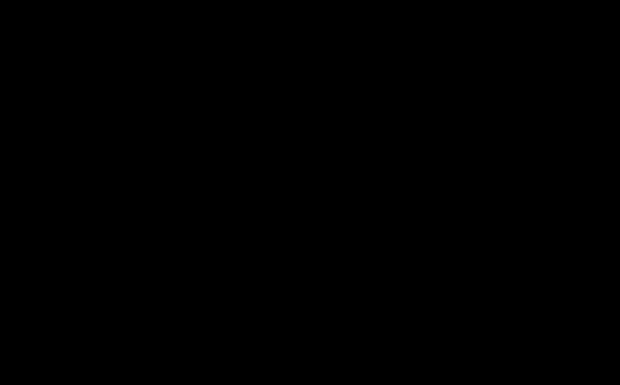„Tatort“: ein toter Held
"Gegen den Kopf" stellte ungemütliche Fragen an den Zuschauer.
Wer je in der Berliner U-Bahn gefahren ist, der kennt so eine Gemengelage: Einige Männer dösen vor sich hin; ein paar asiatische Mädchen gickeln lautstark über ihren Smartphones; zwei Jugendliche mit Kapuzen lärmen betrunken durch den Gang; ein Mann telefoniert. Es ist früh am Morgen, die erste Bahn, für manche endet die Nacht, für andere beginnt der Tag. Dann entdecken die Halbwüchsigen einen älteren Mann, der eine Gehhilfe hält, entwenden das Gerät, spielen damit herum, machen obszöne Bewegungen und fordern 30 Euro. Die Umsitzenden bemühen sich, nicht hinsehen zu müssen. Nun kommt der Mann herbei, der telefoniert hat, gebietet mit fester Stimme Einhalt, schaut die beiden an und sagt schließlich: „Ich habe ein Auge auf euch.“
So beginnt „Gegen den Kopf“, der „Tatort“ aus Berlin, geschrieben und inszeniert von Stephan Wagner: Es hätte ja nichts passieren müssen. Aber zwei Minuten später, an der nächsten Haltestelle, starb der Mann, ein selbstbewusster Hüne. Er hatte ein Foto von den Randalierern gemacht, das er nicht löschen wollte, woraufhin einer der Jungen wie besinnungslos auf ihn einprügelte und ihn schließlich mit Tritten traktierte. Auf dem Bahnsteig standen acht Menschen, eine Frau verständigte anonym die Polizei, aber die Täter flüchteten zu schnell.
Nun macht de Polizei ihre Routinearbeit: Spuren sichern, Bilder der Überwachungskameras überpüfen, Handys orten, Zeugen befragen, die Menschen aus dem Zug finden. Die Ereignisse sind aus vielen Perspektiven dokumentiert. Wir sehen die Leiche von Mark Haessler in der Gerichtsmedizin: 38 Jahre alt, 1,97 Meter groß, 96 Kilogramm schwer. Verkrustetes Blut im Gesicht. Bei der Witwe im friedlichen Berliner Vorort war bereits der Reporter der Boulevard-Zeitung, das Kind spielt im Garten, die Kommissare Ritter (Dominic Raacke) und Stark (Boris Aljinovic) begegnen einer verstörten, kraftlosen Frau: „Er sagt, mein Mann war ein Held.“ Bei der Staatsanwältin tragen sie mechanisch den Fall vor, sie ist froh, dass sie es nicht aus den Medien erfährt, und gewährt „volle Mannstärke“: Die Öffentlichkeit wird Druck ausüben, die Sache muss vom Tisch.
Der Tod am U-Bahnhof ist eine Akkumulation von Unwahrscheinlichkeiten, die während der Ermittlungen die Frage nach der Schuld verschwimmen lässt. Man denkt sofort an den Tod von Jonny K. am Alexanderplatz, eine sinnlose Berserkertat, die nicht nur die Berliner Medien monatelang beschäftigte. Der „Tatort“ hat allerdings insofern zusätzliche Brisanz vermieden, als Migranten keine Rolle spielen. Man denkt aber auch an folgenden Fall: Im Jahr 2009 starb auf dem Bahnsteig München-Solln der virile, lebensfrohe Unternehmer Dominik Brunner, der einige Schüler vor älteren Jugendlichen beschützen wollte. Die enthemmten Kerle traten mit Füßen auf ihn ein, bevor sie wegliefen. Brunner wurde zum Märtyrer und Helden ausgerufen, später stellte sich heraus, dass er – ein Judo-Kämpfer – vor der Schlägerei eine Kampfhaltung eingenommen hatte und nicht an den Schlägen, sondern an einem Herzinfarkt gestorben war.
Einer der Täter stellt sich der Polizei und belastet den anderen, das Ermittlungsteam macht dilettantische Fehler, ein Maulwurf berichtet aus dem Inneren der Behörde: „Gegen den Kopf“ nimmt so ziemlich jede Wendung, die man aus der Wirklichkeit (und aus Kriminalfilmen) kennt. Doch Wagners Film ist weder Betroffenheitskitsch noch ein moralinsaurer Thriller, sondern eine ruhige Studie über Zufall und Schicksal, Polizeiarbeit und Mediengier. In Rückblenden rekonstruiert er den Hergang der Tat und auch das, was danach geschah, und langsam fügt sich alles zu einer Kette der Beliebigkeit, der Willkür, des Volatilen. Dominic Raacke und Boris Aljinovic tragen ihre Neckereien mit der Müdigkeit alternder Westernhelden aus: Im Auto rekapitulieren sie noch einmal die alte bundesrepublikanische Auseinandersetzung über den „gläsernen Bürger“ und den Datenschutz.
Ambivalenzen bestimmen auch das behutsame Drehbuch von „Gegen den Kopf“. Stephan Wagner hat vor zwei Jahren den „Fall Jakob von Metzler“ als beklemmendes Kammerspiel und den Gewissenskonflikt eines Mannes verfilmt: Robert Atzorn ließ in die Seele eines erfahrenen Polizisten blicken, der die düstersten Andeutungen von Folter machte, weil er ein Kind nicht sterben lassen wollte. Der sogenannte gesunde Menschenverstand gab ihm darin Recht – aber Gerechtigkeit ist etwas anderes als das Gesetz.
Man sieht die beiden Halbstarken: Der eine ist ein Schnösel mit reichen Eltern, der andere ein vorbestrafter Herumstreuner, der Drogen für ihn beschaffte. Sie kannten einander flüchtig, sie hatten bis in die Nacht gesoffen, sie hatten kein Geld mehr. Man sieht die Zeugen: Keiner kam zur Hilfe, die meisten hatten Angst oder schlechte Erfahrungen oder fühlten sich ohnmächtig. Manche antizipierten schon das Urteil: Die kommen bald wieder heraus oder werden freigesprochen, dafür lohnt es ja nicht! Und der Film stellt eine besonders perfide Frage an den Zuschauer: Ist eigentlich auch ein Mann, der kein perfekter Familienvater ist, der ein Geheimnis hat, ein guter Mann? Und trauern wir nur nur um gute Männer?
Der Film endet mit den trostlosen Bildern eines Reihenhauses und einer Frau, die ihren Mann verloren hat. Man hat ihr gesagt, er sei ein Held gewesen. Sie wird damit leben müssen.