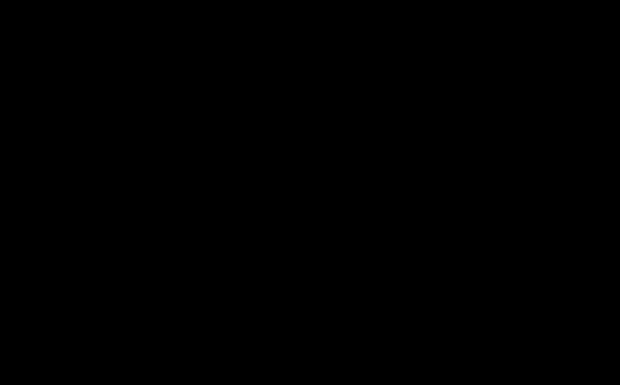Unheilig, Frei.Wild und Haudegen: Stallknechte der Herzen
Neue deutsche Bands wie Unheilig, Frei.Wild und Haudegen setzen auf Gefühl, Gemeinschaftssinn und Bärigkeit – und feiern mit biederer Pathosmusik gewaltige Erfolge. Warum denn bloß?
Vielleicht sind ja die Kunststudenten und Dichtertypen an allem schuld: Bands wie Radiohead und Ja, Panik, die mit Intertextualität und Streichorchestern nach Meisterwerken streben, wo es im Rock’n’R oll doch früher vor allem um zwei Minuten und 50 Sekunden Spaß ging. Die Medien klatschen Beifall – und vergessen manchmal, dass die Feuilleton-Darlings nur ein relativ überschaubares musikalisches Segment bearbeiten. Man kann nicht oft genug daran erinnern: Viele Musikhörer und Konzertbesucher wünschen sich einfach ein paar hübsche Songs, die das eigene Weltbild bestätigen. Dabei ist es relativ egal, ob die Musik eher schnulzig oder punkig klingt. Hauptsache, die Texte legen einen starken Arm um die Schultern des Hörers und sagen: „Ich verstehe dich und deine Probleme.“ In der Hinsicht sind sich Kastelruther-Spatzen- und Böhse-Onkelz-Hörer vielleicht ähnlicher, als sie glauben.
Die Onkelz stellen gewissermaßen den Blueprint für Deutschrock mit Tendenz zum Sentimental-Pathetischen dar. Die vier Musiker aus Frankfurt waren bis zu ihrer Auflösung 2005 die Helden einer Generation von Prolls mit deutsch-nationalem Background. Als Teenager standen sie bekanntlich der Skinheadszene nahe, schrieben einige Nazi-Punk-Songs, weshalb sie auch später von fast allen größeren Medien boykottiert wurden. Die Band verkaufte trotzdem Millionen von Platten und hatte sieben Nummer-eins-Alben. Nicht nur wegen ihres derben Hardrocks, sondern weil sich die Fans in den oft beleidigt-märtyrerhaften Texten aufgehoben fühlten.
Das Ende der Onkelz hinterließ eine Lücke, in die Plattenfirmen schon seit einiger Zeit verstärkt investieren: Musik von ehrlichen Kerlen, deren Lieder sich weniger aus den Mythen des angloamerikanischen Rock’n’Roll speisen als aus der sepiagetönten, hausmacherischen Sehnsucht nach Heimat und Vertrautheit. Zum Beispiel das Duo Haudegen aus dem Berliner Stadtteil Marzahn, das eben sein erstes Album „Schlicht & ergreifend“ veröffentlicht hat. Die tätowierten Zwei-Zentner-Männer Hagen Stoll und Sven Gillert sehen aus wie Hufschmiede, Stallknechte oder Mähdrescherfahrer – mehr pittoreske Bodenständigkeit geht nicht. Aus heiseren Kehlen lamentieren sie zu überwiegend unverstärkter Rockmusik über die Härte der Zeiten und die Lieblosigkeit der Frauen.
„Wäre bei Haudegen Kalkül im Spiel, hätten wir schon 2005 damit anfangen müssen, direkt nach der Auflösung der Böhsen Onkelz“, entgegnet Stoll in einem von der Plattenfirma verbreiteten Interview auf die naheliegenden Vorwürfe. Damals war er allerdings noch als HipHopper unterwegs: Er rappte und produzierte unter dem Namen Joe Rilla, unter anderem für das Hart-und-zotig-Label Aggro Berlin: „Ich steh für Ostberliner Hooligans“, verkündete er in „Der Osten rollt“. Doch von Wortspielen und vertrackten rhymes ist bei seiner neuen Band wenig zu hören: „Die Zeiten sind rau, die Moral liegt getreten am Boden/ Bei einem Blick aus deinem Fenster raus wirst du belogen und betrogen.“ Das klingt schlicht und weinerlich, aber möglicherweise wird es genau deswegen vielen gefallen. Haudegen sind eine Art Street-Version der Kuschelmonster von Pur. „Wenn du auf der Suche nach Authentizität in der heutigen Welt der Popmusik bist, laden wir dich gerne ein“, sagt Stoll. Ein Satz, der auch von Hartmut Engler sein könnte.
Auch der sogenannte „Graf“ ist kein Freund von allzu komplexen Texten, die Musik seiner allseits bekannten Band Unheilig ist manchmal sogar gefährlich nahe am Schlager. „Große Freiheit“ wurde zum erfolgreichsten deutschen Album des vergangenen Jahres, im März gab es zwei Echo-Awards für Sänger und Mastermind Bernd Heinrich Graf. Mögliche Gründe? Er sieht eben nicht wie ein gefönter Vorabendserien-Darsteller oder „DSDS“-Kandidat aus. Den ehemaligen Optiker mit Gothic-Vergangenheit umflort ein sinister romantisches Charisma, er ist „schräg“ und handfest zugleich. So fühlen sich eben auch viele der Fans, die fest im Berufsleben stehen, aber dabei auf eine popkulturelle Vergangenheit zurückblicken. Wenn der Graf zum halbdunklen Sisters-Of-Mercy-Sound schreit und murmelt, wird selbst ein banaler Text wie „Geboren um zu leben“ zur Hymne, bei der sich das Publikum an den Händen fasst: „Ich stell mir vor, dass du zu mir stehst/ Und jeden meiner Wege an meiner Seite gehst.“ Ein wenig mit schwarzer Spitze besetztes Indie-Flair hat das trotzdem noch.
Es geht im aktuellen Deutschrock eben nicht um exotisch entrückte Pop-Idole à la Lady Gaga, sondern um Identifikationsangebote und um Geborgenheit in der Gemeinschaft der Fans. Die Südtiroler Band Frei.Wild strapaziert das Ideal allerdings bis über die Schmerzgrenze hinaus: Musikalisch aggressiv und inhaltlich beängstigend deutschtümelnd, übt man den Spagat zwischen dem Punk-Sound der Toten Hosen und dem Märtyrertum der Böhsen Onkelz. „Das Land der Vollidioten“ von 2009 hört sich wie ein programmatisches Statement an: „Das ist das Land der Voll-idioten, die denken, Heimatliebe ist gleich Staatsverrat/ Wir sind keine Neonazis und keine Anarchisten, wir sind einfach gleich wie ihr … von hier.“
Der Erfolg gibt ihnen recht: Das Album „Gegengift“ stieg Ende 2010 bis auf Platz zwei der deutschen Charts, bei der Echo-Verleihung war die Band immerhin für einen Preis nominiert. Was unter anderem auf Facebook zu einem Sturm der Entrüs-tung führte: Frei.Wild-Sänger Phillip Burger gehörte nämlich bis Oktober 2008 der rechtspopulistischen Südtiroler Partei Die Freiheitlichen an und trat offenbar eher aus Marketinggründen wieder aus. „Solange sie sich benehmen“, sagte Burger in einem Interview, seien rechtsradikale Skinheads auf den Konzerten der Band durchaus willkommen. In der Bandliste des Neonazi-Portals Thiazi werden Frei.Wild mit Diskografie und Songtexten gelistet, neben vollends braunen Kollegen wie Störkraft.
Eher rührend doof ist dagegen die Band Riefenstahl aus Hannover, die ihr neues Album „Triumph“ nennt und offensichtlich gerne so doppelbödig böse wäre wie Rammstein. Dass „Triumph des Willens“ (1935) von der 2003 verstorbenen Regisseurin Leni Riefenstahl der Inbegriff des Nazi-Propagandafilms ist, gehört wohl zum Kalkül. Und wenn Sänger Jens „Centurio“ Esch seine Texte im pathetischen Heldentenor intoniert – „Es ruft zum letzten Tanze emphatisch Riefenstahl“ –, dann möchte man tatsächlich nichts lieber, als sofort Tocotronic hören und in den rätselhaften Texten von Ja, Panik versinken. Denn wenn deutsche Musiker zu sehr fühlen und zu wenig denken – dann kommt selten etwas Gescheites dabei heraus. Der „Musikantenstadl“ ist da im Zweifel noch das kleinere Übel.