Von Leif Randt bis Patti Smith: Unsere Bücher des Jahres 2025
ROLLING-STONE-Autor:innen über ihre Top-Bücher 2025: Was haben wir gern gelesen?

Gunter Blank, Maik Brüggemeyer, Birgit Fuß, Björn Hayer, Thomas Hummitzsch, Gérard Otremba, Birgit Schmitz und Arne Willander über ihre Highlights des Jahres
01. Leif Randt: „Let’s talk about feelings“ (Kiepenheuer & Witsch)

Typisch für einen Coming-of-Age-Roman: Er steuert auf ein Ereignis zu, zum Beispiel Weihnachten (siehe „Der Fänger im Roggen“). Sollte es nun so sein, dass – wie der Verlag verkündet – Leif Randt das Genre des Coming-of-Middle-Age erfunden hat, dann dürfte dessen entscheidendes Merkmal sein: Die Geschichte bewegt sich von einem Ereignis fort. In diesem Fall: von der Beerdigung der Mutter. Zu Beginn versammelt Marian Flanders, 41 Jahre alt, seine Freunde, Nachbarn und die bunte Patchwork-Familie, um die Asche seiner Mutter auf dem Wannsee zu zerstreuen. Für Leif-Randt-Fans ist die Ähnlichkeit zur Anfangsszene von „Schimmernder Dunst über CobyCounty“ ein kleines Fest. Alle Figuren, die mehr oder weniger wichtig werden sollen, treffen schon auf den ersten Seiten aufeinander – etwas abseits, leicht unbeteiligt, beobachtet der Held das Geschehen. Was kommen mag und was Bestand haben wird, liegt im schimmernden Dunst der Zukunft. Wird Marvins erfolgreiche DJ-Halbschwester weiter um die Welt touren wollen? Kann Freundschaft bestehen bleiben, wenn ein Teil sich in eine neue Beziehung begibt? Wie wird das sein, zum ersten Mal einen Menschen zu betrauern, der immer da gewesen ist?
„Let’s talk about feelings“ spielt in einer Übergangszeit, minimal versetzt in eine nahe Zukunft. Man bewegt sich lesend in das Jahr 2026. Es gibt eine Bundeskanzlerin, zwei neue Parteien: eine nationallibertäre, rechte Partei, die andere mit dem Namen Progress16. Clubbing, Drogen, Rausch, schnelles Ver- und Entlieben bestimmen irgendwie immer noch Marians Alltag, obwohl der Berliner Heyday längst vorüber ist. Nicht nur weil mit dem Tod der Mutter, einst It-Girl ihrer Generation und berühmtes Model, die so weise wie sarkastische Kommentatorin fort ist, sondern auch die finanzielle Unterstützung seiner Boutique für ausgefallene Designermode wegbricht. Prekär geht lange gut, bis es nicht mehr gut geht.
Jene, wie Marians bester Freund Piet, üben sich weiter in scharfsinniger, amüsanter Kulturkritik mit Distinktionsgewinn – noch unentschieden, ob er „ziemlich konservativ oder sehr viel linker werden“ würde. Randt gibt sich viel Mühe, ein ganzes Universum an Marken und Designern zu erfinden, deren Originalität gerade so lange Bestand hat, bis die erste chinesische Billigkopie auf den Markt kommt. Andere, die sich früh für Karriere und Familie entschieden haben, lassen sich inzwischen scheiden und probieren neue polyamoröse Lebensentwürfe aus. Alles scheint immer noch denkbar in diesem Moment. Etwas ist vorbei, doch das Neue hat noch nicht begonnen. Der politische Philosoph Antonio Gramsci nannte es die „Zeit für Monster“. Randt entwirft dabei keine dystopische, sich selbst verschlingende Welt mit riesigen Ungeheuern. Braucht er auch nicht. Denn die kleine Verschiebung in die Zukunft genügt schon, damit das Unbehagen an der Gegenwart spürbar wird. Für Berlin heißt das etwa: Das Kapital zieht weiter, nach Wolfsburg, wo sich der kriselnde Autokonzern in ehemaligen Werkshallen neue Geschäftsfelder aus Clubkultur und Fashion erschließen möchte. Für Marvin bedeuten die sich abzeichnenden Krisen: „Er war ein Teil der Gesellschaft, und wenn diese sich verändert, würde wohl auch er sich verändern.“ Aufbruch verspricht nur die noch unsichere, aber aufregende Liebesgeschichte mit der Filmemacherin Kuba.
Vor 15 Jahren begann mit „Schimmernder Dunst über CobyCounty“ etwas Neues in der deutschen Literatur, oder besser gesagt: etwas sehr Eigenes. So elegant wie Randt balanciert seither niemand zwischen Gegenwartsanalyse und unterkühlter Beschreibung. Er erzählt von unserer Welt voller Menschen mit Meinungen und vermeintlichen Gewissheiten. Man stellt sich den Autor mit leicht schräg gelegtem Kopf vor, wenn er seine Figuren durch unsere Zeit bewegt und sie zumindest erahnen lässt, dass wir nicht schon alle Antworten haben. (Birgit Schmitz)
02. Percival Everett: „Dr. No“ (Hanser)

Das Nichts ist mehr als die Abwesenheit von etwas. Philosophisch betrachtet ist es eine Art Gegenprinzip zum Sein, eine Art gedanklicher Abgrund, der grundsätzliche Fragen nach den Grenzen der Existenz aufwirft. Schwenkt man in den mathematisch-physikalischen Bereich, dann handelt es sich beim Nichts um eine genau definierte und komplexe Leere, in der die physikalischen Gesetzmäßigkeiten fortwährend gelten. Das Nichts enthält jede und keine Möglichkeit, den Urknall, aber auch sein Ausbleiben, das Konkrete, aber auch das Virtuelle. Das Nichts ist also ein höchst faszinierendes Ding beziehungsweise Un-Ding, dem sich der Erzähler in Percival Everetts Roman „Dr. No“ verschrieben hat.
Wala Kitu ist ein nerdiger Professor für Mathematik, der den größten Teil seiner akademischen Karriere damit zubringt, über nichts nachzudenken. Sonderlich eifrig ist er dabei nicht. Auch sein Name bedeutet nichts, im wahrsten Sinne des Wortes. „Wala“ heißt auf den Philippinen nichts, und „Kitu“ steht in Swaheli ebenfalls für nichts. Dieser eigenwillige Experte in nichts wird eines Tages von einem durchgeknallten Selfmade-Milliardär namens John Milton Bradley Sill rekrutiert, der davon träumt, als Bond-Schurke à la Goldfinger Fort Knox auszurauben. In dessen Tresorraum vermutet er einen Schuhkarton randvoll mit nichts. Genau den will er haben, um „Amerika wieder zu nichts zu machen“ und sich an dem Land zu rächen, das ihm im Zuge der Ermordung von Martin Luther King Jr. vermeintlich die Eltern genommen hat. Sill wirbt Wala Kitu als Berater an. Von ihm lässt er sich erklären, wie er nichts erkennen kann, wenn er erst einmal davorsteht.
So schräg das bis hierher klingt, so unheimlich unterhaltsam ist diese Geschichte. Percival Everett hat einen satirischen Spionageroman verfasst, der dem Genre alle Ehre macht. Der Professor und der Milliardär werden von Partnern zu Gegenspielern, um die Everett ein illustres Figurenkabinett anordnet. Da ist eine Astrophysikerin namens Eigen Vector, deren sprechender Name wohl auch irgendwas mit nichts zu tun hat. Sie nimmt (neben einem Avatar namens Gloria) die Rolle des Bond-Girls ein, dem der verklemmte Kitu nicht ins Bett folgen wird. Eine einbeinige Bulldogge namens Trigo wird zur guten Seele des Romans, mit der sich der Professor im Traum über Eulersche Formeln, Hegels Theorien und „be-kante“ kategorische Imperative austauscht. Dazu kommen ein paar halbseidene Doppelnull-Agenten, teure Autos, U-Boote und eine Jagd um die Welt, die diese komödiantische Agentenstory vervollständigen.
Seinen Titel hat der Roman von Ian Flemings Klassiker „James Bond jagt Dr. No“. In der englischsprachigen Welt ist Everetts 23. Roman zwischen seinem satirischem Thriller „Die Bäume“ und der im Mai mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Twain-Variation „James“ erschienen – zwei Romanen, in denen sich der Amerikaner intensiv mit der Geschichte des amerikanischen Rassismus auseinandersetzte.
„Dr. No“ ist eine literarische Spielerei, in der Rassismus nur eine Nebenrolle spielt. Und doch ist der Roman, der in den USA nach Trumps erster Amtszeit erschien, alles andere als unpolitisch. In Teilen ist die Handlung geradezu erschreckend aktuell. Amerika wird hier von einem „fetten Clown“ mit „orangenem Arsch“ und einer Regierung voller Bösewichte regiert. Auf den Straßen marschieren bewaffnete „Männer in schwarzen Panzerwesten“, deren Gesichter „mit Sturmhauben maskiert“ sind. Dass Bösewicht Sill schließlich eine ganze Stadt ver-nicht-et, passt dann auch ins dystopische Bild eines Landes, in dem die rassistische Gewalt weißer Multimilliardäre (und anderer Faschisten) wieder zur Nichtigkeit erklärt wird.
Wie in den USA der Gegenwart geht es in diesem Roman um alles oder nichts – aber eher im übertragenen Sinn. Dass dies ein veritables Lesevergnügen ist, liegt an der erneut großartig verspielten und grandios leichtfüßigen Übersetzung von Nikolaus Stingl, an deren Ende nichts geschehen, die Welt aber dennoch eine andere ist. (Thomas Hummitzsch)
03. Christian Kracht: „Air“ (Kiepenheuer & Witsch)

Ziemlich schnell stellt sich das Gefühl ein, dass dies ein sehr guter neuer Roman von Christian Kracht ist. Doch gar nicht so leicht zu sagen, warum eigentlich. Als eine rätselhafte Mischung aus Fantasy, Dystopie und Abenteuerroman wirkt das Buch aus der Zeit gefallen, weit entfernt vom Hier und Jetzt. Nicht alles wird man dechiffrieren können, wie das altmeisterliche Covermotiv von dem nicht ganz unumstrittenen norwegischen Maler Odd Nerdrum (kein Künstlername). Eine Szenerie zwischen Erweckung und nahendem Unheil, archaisch und antimodern. Darauf steht in einer ultraleichten Schrift „AIR“.
Der Roman beginnt auf Orkney mit einem langen, schweifenden Blick durch einen Raum, in dem in einer Ecke ein Mann schläft. Paul, Inneneinrichter, lebt auf der schottischen Insel, kauft sonst Brot, sitzt am Meer, beachtet kaum noch die über ihm wabernden Polarlichter. Er erhält einen Auftrag eines Designmagazins, das perfekte Weiß zu finden. So weit, so typisch Kracht. Doch schon im zweiten Kapitel fallen wir durch die Zeiten, Dimensionen und Erzählformen. Das Kunstmärchen um das Mädchen Ildr (vielleicht ein Name aus der ausgestorbenen Sprache Norn, die einst auf Orkney gesprochen wurde) führt in eine postapokalyptische und pandemische Welt, nicht klar, ob vor oder lange nach unserer Zeit. Ildr lebt im „Norden“, wo es eine üppige Vegetation gibt, aber ein grausamer Herzog die Menschen knechtet und eine tödliche Seuche herrscht. Auf der Jagd verletzt sie versehentlich einen Fremden mit einem Pfeil und pflegt ihn anschließend gesund. Es deutet sich an, dass der Fremde nicht von „dieser Welt“ ist. Als die Soldaten des Herzogs nach dem Fremden suchen, beginnt eine abenteuerliche Flucht in den Süden zu den Steinmenschen nahe dem Eismeer. Ein bisschen Cormac McCarthys „Die Straße“, Tolkiens „Herr der Ringe“ und „Ronja Räubertochter“.
Derweil in Stavanger angekommen, trifft Paul auf den kettenrauchenden, zynischen Chefredakteur der Zeitschrift und erfährt, dass er eine riesige Datenspeicherhalle weiß streichen lassen soll. Nicht immer ist das Aufzählen der „Es gibt sie noch, die guten Dinge“ aus dem Manufactum-Katalog so komisch wie in dem Moment, als Paul im Kopf überschlägt, wie viele Hunderttausende Fünf-Liter-Eimer Farrow-&-Ball-Farbe er für den Anstrich benötigen würde. Dann ist Paul verschwunden.
Ildr und dem Fremden gelingt es, ihre Verfolger abzuschütteln, sie erleiden Hunger und Kälte und erreichen schließlich die Steinstadt am Fluss Livagar. Trotz der augenscheinlichen Entbehrungen – alles besteht aus Stein, umgeben von eisigem Wasser – treffen die beiden dort auf eine friedvolle Gemeinschaft, die in Harmonie miteinander lebt.
Die unterschiedlichen Dimensionen des Romans sind so durchlässig wie die Schrift auf dem Cover, immer wieder tauchen Gegenstände aus der einen Welt in der anderen auf. Ildr rätselt über die Erfindungen, die der Fremde in seinem Beutel mit sich trägt, erklärt sie mit Magie, während der Fremde ihr wissenschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln versucht. Aber manchmal weiß auch er nicht, woher eine Schraube kommt oder wieso die Pistole aus dem 3D-Drucker nur in den Händen des Mädchens funktioniert.
Egal, ob man den Roman als Gedankenspiel in einem Multiversum mit parallel existierenden Welten liest, ob nordische Mythen oder der neuheidnische Rodismus Kracht als Vorlage dienten oder alles auf die John von Neumann’sche Entropie hinausläuft (für all das finden sich Hinweise) – in „Air“ hängt alles mit allem zusammen. Es setzt sich mit den aktuellen globalen Gefährdungen auseinander. Und fast möchte man behaupten, der Planet und seine drohende Zerstörung schienen Kracht besonders am Herzen zu liegen, genauso wie das moralische Dilemma des technischen Fortschritts oder einer zur Selbstzerstörung neigenden Menschheit. Irgendwie düster, aber auch lakonisch und komisch. Mehrfach ist sogar das Wort „Hoffnung“ zu lesen.
Gerade wurde der Vorgängerroman „Eurotrash“ für den International Booker Prize nominiert, was wir mal als gutes Zeichen werten, weil untypisch für die allgemeine Rezeption deutschsprachiger Literatur im Ausland. Die letztjährige Auszeichnung von Jenny Erpenbecks „Kairos“ war tatsächlich etwas traurig, weil deutschsprachige Literatur schon etwas länger mehr ist als die Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Totalitarismus. Und Kracht hat daran ganz bestimmt seinen Anteil. (Birgit Schmitz)
04. Thomas Pynchon: „Schattennummer“ (Rowohlt)

Wenn Ärger in die Stadt kommt, dann nimmt er meistens die North-Shore-Linie.“ So beginnt nicht der neue Jerry-Cotton-Band, sondern „Schattennummer“ („Shadow Ticket“) von Thomas Pynchon. Nach der ersten Seite hat man keine Ahnung, was das soll, aber man ist schon verdammt amüsiert. Man weiß, dass man in einem Roman von Thomas Pynchon ist, wenn jemand eine Zeitung zusammenrollt und im Auto einen Song aus dem Radio mitsingt.
Wenn über den Highway hereinbricht die Nacht
Und ich heimfahr zu meinem Häuschen
Hab ich mal wieder ’nen Dollar gemacht
Und freue mich auf mein Mäuschen
Meine kleine Missus Middleclass …
Vergiss die Kaugummibraut von der Tanke,
Geh mir weg mit dem Plutokratengör,
Ich steh nun mal auf die süße, ranke Frau aus der Vorstadt
Meine kleine Missus Middleclass …
Ich steh samstagsabends nicht mehr am Tresen,
Wasch meine Socken nicht mehr mit der Hand,
Bin jetzt so normal in meinem Wesen
Wie Millionen andere Männer im Land:
Wir sind sehr zufrieden, alles ist, wie es ist.
Im Grunde sind alle Romane Thomas Pynchons Parodien von Detektivromanen, Gangstergeschichten, historischen Romanen und Groschenromanen. Er hat so große Lust, Umgangssprache, Jargon, Sprachklischees und Schlagertexte zu imitieren, dass die Imitationen das Eigentliche werden und ein eigenes Genre, das Pynchoneske, bilden. Kein Mensch kann „V.“ und „Gravity’s Rainbow“ folgen, aber „Die Versteigerung von No. 49“ ist auch außerhalb eines Literaturseminars zu bewältigen. Und Paul Thomas Anderson hat sogar Filme aus „Inherent Vice“ und „Vineland“ gemacht! Seltsamerweise ist der hermetischste amerikanische Romancier eine Gestalt der Populärkultur, wie John Updike, Saul Bellow und Philip Roth es nie waren. Das hat natürlich mit dem comichaften Zugriff zu tun und Dialogen, wie nur Pynchon sie sich ausdenken kann. Seine Dialoge gehen seitenlang wie bei Dostojewski und führen nirgendwohin, wie auch die Aventüren von Hicks McTaggart nirgendwohin führen.
Die Geschichte des Privatdetektivs McTaggart zur Zeit der Prohibition, Milwaukee 1932, ist natürlich Raymond Chandlers „The Big Sleep“, und Hicks ist Philip Marlowe. Er soll die Tochter von Bruno Airmont, dem Al Capone des Käses, nach Hause bringen. Hicks hatte mal was mit Daphne. Natürlich heißen die Typen hier Skeet, Stuffy, Boyt und Dippy Chazz Foditto. McTaggart bekommt jede Menge Ärger, und es verschlägt ihn nach Europa.
„Schattennummer“ ist mit 400 Seiten einer der schmaleren Romane von Thomas Pynchon. Und es ist sein, nun, romantischster. Ein Schelmenroman. „Zeit, die Straßenjungen-Tage hinter mir zu lassen, bin nicht mehr so klein und so schnell, wenn das Leben ein Baseballplatz wäre, würde man vielleicht sagen, Zeit, von Shortstop weiter raus zu wechseln, wo ich mehr Freiheiten habe und verhindern kann, dass lange Bälle auf der Tribüne landen. Solange ich noch fangen kann.“ Dirk van Gunsteren und Nikolaus Stingl haben „Schattennummer“ mit dem Feingespür für den schnodderigen Ton übersetzt.
Thomas Pynchon ist 88 Jahre alt und wird den Nobelpreis nicht mehr bekommen. Noch bei „Gravity’s Rainbow“ (1973) versuchte man das Prinzip der Entropie in seinem Werk zu ergründen, statt zu erkennen, dass Pynchon schon seit „V.“ (1963) ein riesiges Verwirrungs- und Lachprogramm verfolgt.
Und wie viel Spaß muss Pynchon haben, wenn er sich diese Schnurren ausdenkt! Einem Reporter von CNN, der ihn aufgespürt hatte, sagte er 1997 zu der Spekulation, er sei in Wahrheit der zurückgezogen lebende J. D. Salinger: „Nicht schlecht – versuchen Sie es weiter.“ (Arne Willander)
05. David Szalay: „Was nicht gesagt werden kann“ (Ullstein)
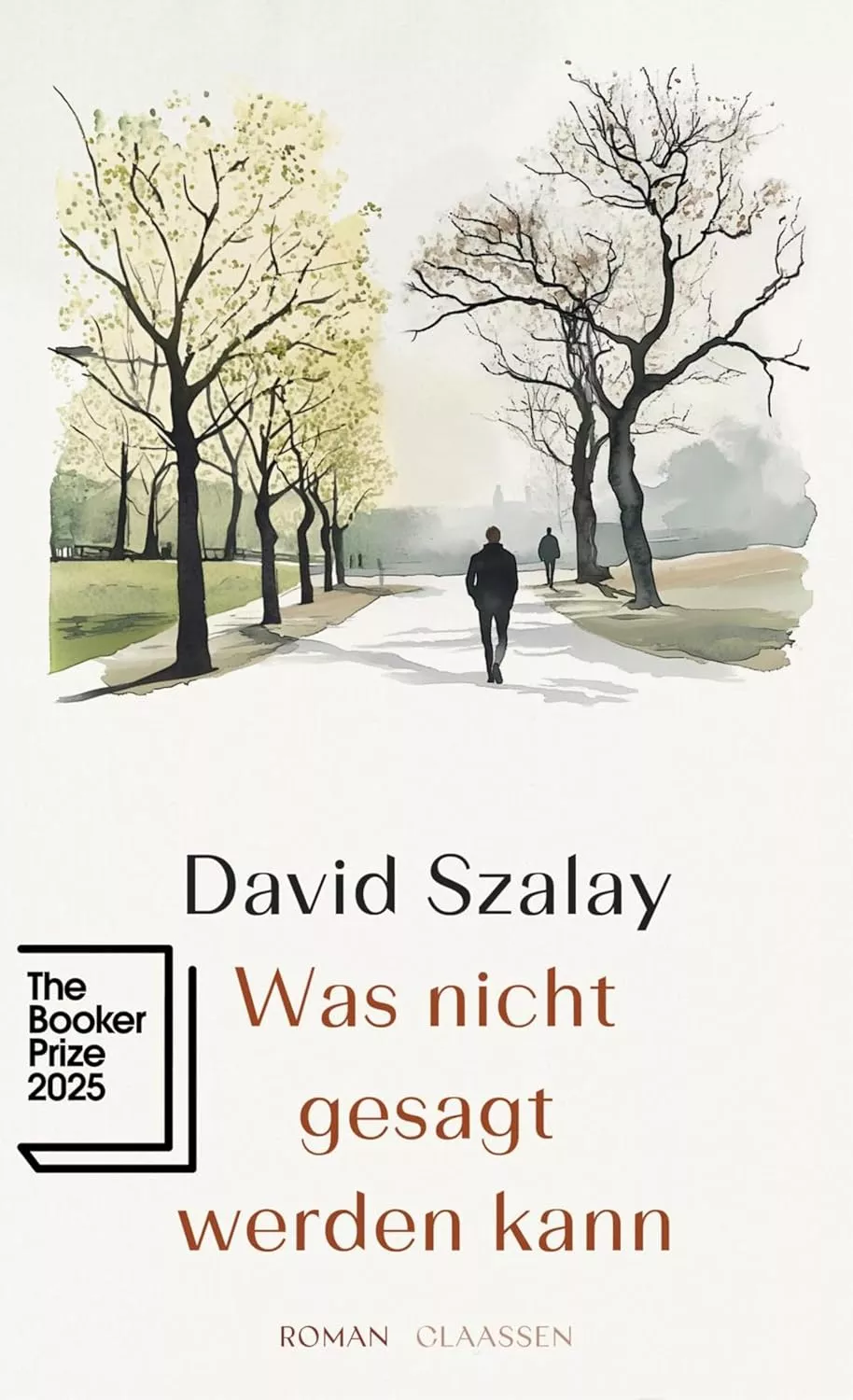
Als David Szalay den diesjährigen Booker Prize entgegennahm, sprach er von Risiken. Man versteht sofort, was er meint. Denn dieser Roman müsste an seinem Vorhaben scheitern: Wie erzählen von jemandem, der selbst keine Sprache hat für das, was ihm geschieht? Nur ganz großer Literatur kann dieses scheinbar Unmögliche gelingen. Eine Literatur, die ihre Prämissen so ernst nimmt, dass man dem wohl wortkargsten Helden der Literaturgeschichte fasziniert an den Lippen hängt. István schafft es aus einfachen Verhältnissen ganz nach oben in die britische Oberschicht. Er ist kein Felix Krull, der sich diese Position erschwindelt, kein Hans im Glück, sondern gleicht vielmehr jenen, die ungefragt und ohne eigenes Zutun ihr Leben ertragen müssen. (Birgit Schmitz)



