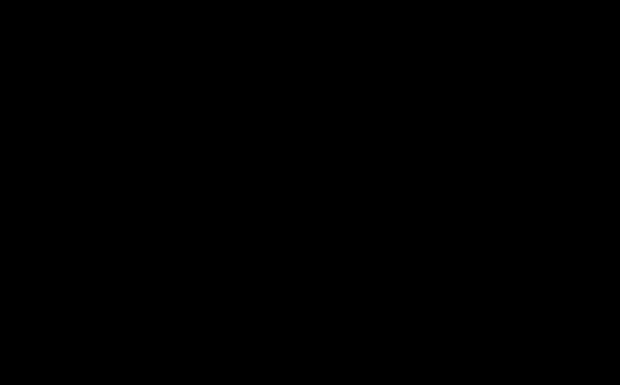So neugierig wie jeder Neunjährige
Zurück zur Kernkompetenz: Mit seinem neuen Roman „ Juliet, Naked" wagt sich Nick Hornby wieder an das Thema Musik und Obsessionen heran.

Natürlich hat ihn gerade wieder jemand gefragt, was er auf seinem iPod hat. Nick Hornby ist inzwischen 52, „High Fidelity“ – der Roman, der „Popliteratur“ salonfähig machte – erschien vor 14 Jahren. Danach schrieb der Brite über Alleinerziehende, Selbstmörder und schwangere Teenager, aber am Ende wollen alle immer nur eins: eine Top-Five-Liste seiner Lieblingslieder. Oder, in England, eine Einschätzung zu Arsenal.
Bestimmt tut man Hornby damit unrecht, aber er lebt ganz gut damit. Er hat sich jetzt sogar getraut, wieder über Musik zu schreiben. „Juliet, Naked“ (Kiepenheuer & Witsch) ist zunächst die Geschichte eines britischen Pärchens, das auf den Spuren eines Rockstars durch Amerika reist und sich immer mehr entfremdet. Duncan, der bleiche Über-Fan, nervt mit seiner analfixierten Vergötterung seine Freundin Annie, die nicht versteht, was an diesem Tucker Crowe so einzigartig sein soll. Bis sie ihn persönlich kennenlernt. Es ist auch die Geschichte eines alternden Idols, das in den 80er Jahren mal ein tolles Album gemacht hat und sich seitdem versteckt – vor irren Fans, die nun im Internet wildeste Theorien verbreiten, aber auch vor der Last des einstigen Erfolgs.
Auf die Idee zu „Juliet, Naked“ kam Hornby, als er vor einigen Jahren in „Vanitv Fair“ ein Interview mit dem lange von der Bildfläche verschwundenen Sly Stone las, und kurz darauf John Careys Buch „What Good Are The Arts?“. „Das hat mich sehr beeindruckt. Carey kommt zu der Erkenntnis, dass wir gar nicht genau bestimmen können, was Kunst ist und was nicht. Etwas ist Kunst, weil jemand findet, dass es Kunst ist – das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Ich habe dann daran gedacht, übers Schreiben zu schreiben und wie es ist, als Autor älter zu werden. Aber ein Songwriter schien mir als Protagonist interessanter zu sein als irgendein Schriftsteller.“
Noch einmal Pop als Thema? Plötzlich schien es möglich. „Nach ,High Fidelity‘ hätte ich mir niemals vorstellen können, noch ein Buch über Musik zu schreiben und darüber, was sie uns bedeutet, weil ich damals nicht glaubte, dass das in der Zukunft irgendwie anders ausschauen könnte. Aber tatsächlich hat sich der Konsum von Musik komplett verändert, also gibt es noch viel mehr darüber zu sagen.“
Nick Hornby sitzt in seiner Schreibstube im Londoner Stadtteil Highbury, umgeben von vielen Bücherregalen, Ordnern und Kinderfotos in bunten Rahmen. Er bietet höflich etwas zu trinken an, hat allerdings nur Mineralwasser vorrätig. Eigentlich raucht er nicht mehr, erkundigt sich aber, ob man vielleicht Zigaretten dabei habe? Dann würde er jetzt mal eine Ausnahme machen. .. Für einen Menschen, der in den vergangenen Jahren viel Kritik einstecken musste, wirkt er erstaunlich entspannt. Möglicherweise weiß er einfach, dass ihm endlich mal wieder ein größerer Wurf gelungen ist, nachdem ihm die Leichtigkeit etwas abhanden gekommen war. Während die Suizidszenarien von „A Long Way Down“ nicht recht glaubhaft wirkten und die Teenager-Sorgen von „Slam“ zu einfältig, hat „Juliet, Naked“ wieder den Charme des alltäglichen Irrsinns.
Seine Charaktere beschreibt Hornby immer noch mit nonchalanter Ironie, aber großer Zuneigung. Man kann ihm das ungeniert Menschelnde auch als Naivität auslegen, damit greift man Hornby nicht an. Er kämpft praktisch täglich dagegen an, ein alter Zyniker zu werden: „Zynismus kommt ins Spiel, wenn man meint, alles zu wissen. Ich versuche, so viel wie möglich zu lernen, wie jeder Neunjährige. Man muss neugierig bleiben.“ Und dass die Liebe immer der Knackpunkt seiner Romane ist – das erklärt er ganz pragmatisch so: „Liebe zehrt einfach einen Großteil unserer Zeit auf. Ich bin nicht so romantisch veranlagt, dass ich glaube, Liebe überwindet alles, aber sie ist nun mal das größte Thema, das es gibt – vorausgesetzt, man hat ein Dach überm Kopf und genug zu essen.“
Die Figuren in seinem Roman leiden keinen Hunger, sie haben Arbeit und Freunde und Hobbies – und verzweifeln am Trott. Duncan steigt sich immer mehr in seine Bewunderung für Tucker Crowe hinein, dessen Album „Juliet, Naked“ sein Weltbild erschüttert. Er bricht schließlich sogar ins Haus von Tuckers Ex-Freundin ein, doch Hornby verteidigt sogar diese armselige Gestalt gegen etwaige Vorwürfe: „Duncan ist ein leidenschaftlicher Fan, kein Besessener. Obsession bedeutet einen schrecklichen Verlust des Durchblicks. Für mich sind das Leute, die keine anderen Interessen mehr haben. Duncan liest ja noch, er sieht fern. Er hat noch nicht ganz den Faden verloren.“ Hornby ist solch fanatische Begeisterung nicht fremd: „Mir ist das früher eher beim Fußball passiert. Das ist der große Unterschied zwischen Fußball und Musik: Musik hat mir immer nur Freude gebracht, während mich Fußball bei vielen, vielen Gelegenheiten sehr unglücklich gemacht hat. Und dann verliert man viel leichter den Durchblick.“
Heute ist der Schriftsteller freilich selbst manchmal in der Position des Bewunderten
eine Rolle, die ihm schwerfällt: „Eine Schriftstellerkollegin hat das Buch gelesen und gesagt: ,Das nächste Mal, wenn mir jemand erzählt, dass ich seine Lieblingsautorin bin, sage ich nicht: Ach komm, lies erst mal Philip Roth!‘ Das ist ja die normale Reaktion, wenn man ein vernünftiger Mensch ist. Wenn Leute mir sagen, wie oft sie ,High Fidelity‘ gelesen haben, will ich erwidern: Einmal genügt! Aber offensichtlich gibt ihnen das Buch etwas, das andere Bücher ihnen nicht geben. Warum sollte man sie bevormunden, in dem man sagt: Lass mal, Söhnchen, ich bin gar nicht so gut.“
Außerdem wehrt er sich vehement gegen die gern gehörte These, dass Menschen, die ihre Freizeit mit der Suche nach limitiertem Vinyl, seltenen Erstausgaben oder Originalversionen von obskuren Filmen verbringen, es nicht geschafft haben, erwachsen zu werden. Da wird er fast laut: „Solche Leute leben noch! Das ist das Allerschwerste, wenn man älter wird – intellektuell und spirituell lebendig zu bleiben! Wenn Erwachsensein bedeutet, dass man nur arbeitet, sich um seine Familie kümmert und schläft – es tut mir leid, aber dann wird man nicht glücklich. Es muss mehr geben, und die Liebe zu unserem Kram – unseren Büchern, unseren Filmen, unserer Musik – ist immens wichtig in unserer doch eher geistlosen Gesellschaft.“
„Theoretisch“ besucht Nick Hornby immer noch gern Konzerte, in der Realität schafft er es meistens nicht, weil er im Zweifelsfall doch lieber essen geht. Gerade hat er Black Joe Lewis & The Honey Bears verpasst, Mark Olson & Gary Louris auch. Ärgerlich, aber andererseits: Eine der größten kleinen Szenen in „Juliet, Naked“ handelt von einem missglückten Abend, an dem Tucker sich in einem zweitklassigen Club eine drittklassige Band ansieht. Weil ihm die Musik nichts bedeutet, er sich bei diesem Lärm aber auch nicht unterhalten kann, ist er ganz auf sich selbst zurückgeworfen. Plötzlich strömen viel zu viele Gedanken auf ihn ein, sein Leben zieht an ihm vorbei, er hinterfragt alles. Das Konzert wird zum Gefängnis. Eine Situation, die Hornby gut kennt.
Seine berühmte Frage, ob man Popmusik hört, weil man unglücklich ist, oder unglücklich ist, weil man Popmusik hört, kann er bis heute nicht beantworten. „Ich schwanke immer noch hin und her! Das wird ewig so weitergehen. Die Erkenntnis, dass alles immer kompliziert sein wird, hat auch etwas Beruhigendes. Für mich bedeutet es, dass man sich nie langweilen wird. Ich bin sowieso immer verwirrt, wenn Leute erzählen, dass sie sich langweilen. Dass es nichts Neues anzuhören gibt, nichts zu lesen, dass alles das Gleiche ist und früher alles besser war. Denen ist wohl die Neugierde ausgegangen.“ (Um die Eingangsfrage zu beantworten: Hornbys Lieblingssong in diesem Jahr ist eine Coverversion, „Sleep All Summer“ von The National & St. Vincent.) Bei aller Neugier bedauert Hornby manche Veränderung dann doch. Zum Beispiel, dass immer mehr Plattenläden schließen. Der bei ihm um die Ecke hat gerade dichtgemacht, und nun kann der dreifache Vater nicht mehr am Samstag morgen mal für zehn Minuten schauen, was andere Leute so kaufen. Bleibt also nur das Internet. „Es stellt sich heraus, dass das Internet im Grunde vor allem für zwei Dinge taugt: Pornografie und Musik. Dafür scheint es erfunden worden zu sein. Das schließt viele Paradoxa und Ironien ein. Zum Beispiel: Es soll dieses moderne Medium sein, aber dann findet man dort viele alte Männer, die Setlisten von Bob-Dylan-Konzerten des Jahres 1972 zusammenstellen.“
Die Tendenz, sich im Internet zu kleinen Grüppchen zusammenzuschließen und endlos über scheinbar Unwichtiges zu diskutieren, findet er amüsant; „Juliet, Naked“ endet mit ein paar Posts zum Thema Tucker Crowe, dem schließlich eine Art Comeback gelingt. Hornby muss allerdings zugeben, dass er selbst seine Freunde auch nicht nur nach Charakter, sondern anderen, vielleicht fragwürdigen Kritikerien aussucht: „Viele haben dieselben Leidenschaften wie ich – sie sind Schriftsteller, Musik-Fans, Musikjournalisten… Manche sind auch Eltern, deren Kinder an derselben Schule sind wie meine, aber ehrlich gesagt: Am Ende fühlt man sich doch eher zu jemandem hingezogen, der weiß, wer die Jayhawks sind.“