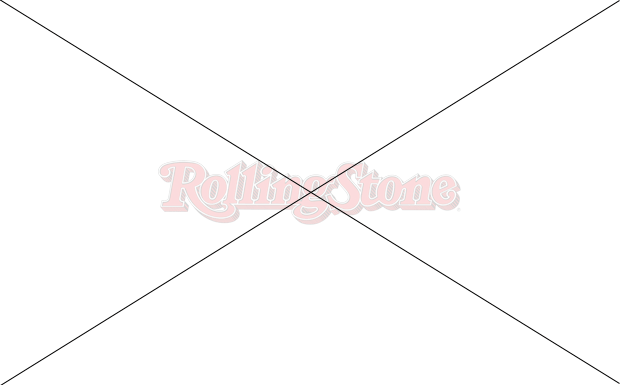Anoushka Shankar im Interview: Beatles, Berghain, Bollywood
Sie ist die Tochter des berühmtesten Sitarspielers der Welt. Mit "Traveller" hat Anoushka Shankar ein Album aufgenommen, auf dem sie indische Musik und Flamenco verbindet. Wir haben sie zu einem ausführlichen Interview getroffen.
Anoushka Shankar (30) will lieber einen Latte Macchiato. Vor dem Interview in einem Berliner Hotel hatte ihre Promoterin schon mal Kaffee für sich und heißes Wasser für sie bestellt, weil Anoushka eigentlich immer Tee trinke. Doch als die schöne Sitarspielerin dann pünktlich erscheint, der Kellner den Kaffee bringt und nach ihrer Wunschsorte fragt, antwortet Shankar: „Eigentlich hätte ich lieber auch so einen.“
Es ist der 6. Dezember und Anoushka Shankar ist in Berlin, um am Abend im Haus der Kulturen der Welt „Traveller“ vorzustellen – ihr aktuelles Album, auf dem sie indische Musik und Flamenco verbindet. 2011 ist sie bereits zum zweiten Mal hier. Anfang September war sie im Berghain – einer der bekanntesten Techno-Clubs der Welt – aufgetreten. „Yellow Lounge“ nennt sich die Veranstaltungsreihe, mit der Shankars neue Plattenfirma, die Deutsche Grammophon, Weltmusik und Klassik an hippen Orten einem jüngeren Publikum näherbringen will.
Shankar war geradezu prädestiniert für dieses Konzept: Sie ist eine junge Frau, die klassische indische Musik spielt und so in ihrer Heimat Aufmerksamkeit für das kulturelle Erbe ihres Landes erzeugt. Aber Anoushka Shankar steht für mehr als Tee trinken und Sitar spielen. Sie ist ein lebendiges Bindeglied zwischen indischer Tradition und westlicher Moderne. Sie wuchs auch in den USA und Großbritannien auf. Ihr Vater, Ravi Shankar, ist der wohl berühmteste indische Musiker. Er unterrichtete seine Tochter und musizierte mit Beatle George Harrison. Doch es ist Anoushka, die den Kultur-Crossover sowohl musikalisch als auch privat wirklich vorantreibt. Sie scheut sich nicht vor Elektronik oder Pop, hat auch mit ihrer Halbschwester Norah Jones aufgenommen. 2010 heiratete sie den britischen Regisseur Joe Wright („Stolz und Vorurteil“) und brachte im Frühling 2011 ihren Sohn zur Welt.
Im offiziellen Album-Trailer kann man sich einen Eindruck von den Aufnahmearbeiten Anoushkas verschaffen:
–
Das wird nicht Ihr erstes Interview für den ROLLING STONE. Im Jahr 2008 erschien die erste indische Ausgabe unseres Magazins. Auf dem Cover wurden klein Radiohead, Led Zeppelin und Bruce Springsteen angekündigt. Und dann gab es da ein großes Porträt von Ihnen, samt der Zeile „Anoushka Shankar – Her Brave New World“.
(kichert) Es gab damals insgesamt fünf Cover für die erste Ausgabe: vier internationale und eins mit mir. Das war wirklich cool.
Sie leben oft in den USA und Großbritannien. Wie bekannt sind Sie dort im Vergleich zu Indien?
In Indien werde ich definitiv öfter erkannt, auch von Leuten, die meine Musik nicht hören und nur mein Gesicht kennen. Ich gehöre dort also eher zum Mainstream. Wenn mich dagegen in den Staaten, Großbritannien oder anderen Ländern gelegentlich jemand auf der Straße anspricht, kennen diese Leute in der Regel meine Musik. Allerdings bin ich auch in Indien kein Filmstar. Daher läuft selbst dort alles sehr höflich und cool ab.
Die folgende Frage führt uns in die Vergangenheit, aber sie wird uns auch wieder in die Gegenwart bringen, weil es wie auf Ihrem aktuellen Album um die Vereinigung unterschiedlicher Welten geht: Ravi, Ihr Vater, ist bekannt dafür, dass er den Beatles indische Musik nähergebracht hat. Diese Zusammenarbeit gilt als eine der ersten Verbindungen von Pop- und Weltmusik. Schon als Teenager waren Sie ein Teil davon und zum Beispiel an „Chants Of India“ beteiligt.
Wir haben gemeinsam daran gearbeitet. Es war das Album meines Vaters und Onkel George hat es produziert. Ich habe meinen Vater begleitet und ihm geholfen.
Wussten Sie damals, wie berühmt George und die Beatles waren?
Es war unmöglich, sie nicht zu kennen. Ich habe sie damals auch oft gehört und diese ganze Beatles-Phase mitgemacht. George war einerseits Onkel George und der Freund meines Vaters, andererseits war ich mir total bewusst, wer er außerdem war.
Sie waren damals ungefähr fünfzehn Jahre alt. Eine Schülerin also, die mit Meistern arbeiten durfte?
George war der Schüler meines Vaters, mein Onkel und mein Freund. Die Atmosphäre war also nicht besonders formell, sondern eher familiär und sehr gemütlich.
2002 haben Sie dann beim „Concert For George“ in London gespielt. Paul McCartney und Eric Clapton sind ebenfalls dort aufgetreten. Gab es für Sie eigentlich nie einen Konflikt zwischen traditioneller indischer Musik und westlicher Popkultur?
In dem speziellen Fall war das eine einzigartige Situation, weil es sich um ein Gedenkkonzert ein Jahr nach dem Tod von George handelte. Popmusik und indische Musik waren seine beiden großen Lieben. Die eine Hälfte des Konzerts war indisch und bestand aus der Musik meines Vaters, und ich habe dazu beigetragen. In der anderen Hälfte spielten all seine Freunde und Kollegen Georges Songs. Tatsächlich hat mein Vater schon in den Siebzigern eine lange Konzert-Reihe namens „Shankar Family And Friends“ veranstaltet. Da hat zur Hälfte auch ein indisches Orchester gespielt und danach eine Band. Das wurde also alles schon mal gemacht. Für mich war das alles sehr faszinierend, es hat sich aber nie wie ein Widerspruch angefühlt.
Ich frage auch, weil Sie in einem alten Interview von Metallica geschwärmt haben, aber damals auch sagten, Sie würden trotzdem kein Intro oder Outro für die Band schreiben wollen. Andererseits haben Sie ein Album mit elektronischen Einflüssen gemacht, und Ihre aktuelle Arbeit kombiniert indische Musik mit Flamenco. Gewissermaßen setzen Sie also eine Familientradition fort, oder? Sie mögen es, Dinge zu mixen – achten allerdings darauf, dass es nicht billig, klischeehaft wird.
Definitiv. Ich denke allerdings, mein Vater würde es hassen, seine Musik mit anderer zu vermischen. Er ist da anders und hat eigentlich nie Pop und indische Musik gemixt – auch wenn er Freund und Lehrer von einem der berühmtesten Popmusiker aller Zeiten war. Aber das war eine auch andere Zeit: Zu Beginn seiner Karriere gab so etwas wie Weltmusik nicht und die Leute im Westen wussten nichts von östlicher Musik. Er hatte eine Pionier-Rolle. Er wollte seine Musik wirklich leidenschaftlich gern mit der Welt teilen. Ich dagegen lebe in einer Zeit, in der man auf Jahrzehnte mit Weltmusik und Experimenten zurückblickt. Es gibt heute eine andere Ebene des Dialogs zwischen den Musikstilen und Kulturen. Inzwischen geht es mehr um Interaktion und gegenseitiges Verständnis. Ich bin sehr an musikalischen Dialogen interessiert.
Auch weil Sie weniger traditionell eingestellt sind?
Möglicherweise. Einerseits schätze ich die Tradition sehr, aber…
…sie ist kein Dogma.
Genau. Ich bin auf der ganzen Welt aufgewachsen, dabei kam es immer zu einer Vermischung der Kulturen. Das hat mich geprägt. Und ich glaube, dass es heutzutage wichtig ist, offen zu bleiben und Kultur zu teilen.
Die Inspiration für „Traveller“ stammt teilweise noch aus Ihrer Kindheit; sie haben schon damals Flamenco gehört. „Andere Musik“ hatte also Platz in Ihrem Elternhaus?
Zuerst habe ich natürlich indische Musik gehört, danach vielleicht Klassik. Meine Eltern hörten verschiedene Musik. Außerdem bin ich zwischen London, Indien und Amerika aufgewachsen, wo ich allen möglichen Dingen ausgesetzt war – durch Freunde und das Leben. Das ganze Umfeld war sehr international. Und ich hatte immer ein sehr offenes Ohr für verschiedene Arten von Weltmusik.
Auf „Traveller“ gibt es den Song „Dancing In Madness“. Sein Rhythmus wird unter anderem geprägt vom Flamenco-Tänzer Farruco, dessen Schrittgeräusche mit denen von Mythili Prakash, einer indischen Tänzerin, kombiniert werden. Was ist die Idee dahinter?
In der Musik gibt es das Call-And-Response-Prinzip, das besonders am Ende von sehr bewegten Passagen eingesetzt wird. Dabei geht es zwischen zwei Musikern immer hin und her, immer schneller. Im konkreten Fall haben wir einen Tänzer mit mir aufgenommen und den anderen mit dem Trommler. Wenn man ihnen jetzt zuhört, klingt es fast wie ein Duett, weil sie sich mit ihrem Tanz gegenseitig antworten. Das ist ziemlich aufregend.
Javier Limón, Ihr Produzent, sprach nach den Aufnahmen sogar davon, dass Sie sein Leben verändert hätten.
Es war sicherlich sehr interessant für ihn, eine andere große musikalische Tradition kennenzulernen, die auch noch viel älter als seine eigene ist und mit der es Gemeinsamkeiten gibt – oder von der seine vielleicht sogar abstammt. Durch die Aufnahmen hat er also wahrscheinlich auch viel über seine eigene Musik gelernt.
Das klingt, als hätte er nicht damit gerechnet.
Im Studio gab es viele Überraschungen für die Musiker, weil die Spanier oft kaum etwas über indische Musik wussten. In Indien gibt es das auch, dass ein paar der erstaunlichsten Musiker sich sehr in einen einzigen, klassischen Stil vertiefen, aber kaum etwas über andere Stile wissen. Wenn sie dann zum ersten Mal miteinander interagieren, kann es sehr spannend sein, sie dabei zu beobachten, wie sie sich gegenseitig entdecken.
Es hat mich gewundert, dass Sie auch Ihre Schwangerschaft inspiriert haben soll. Sie benutzten sogar mal das Bild vom Baby, das in Ihrem Bauch getanzt habe. Meine Mutter hat mir da eher was von Ellenbogen erzählt …
(lacht) Ich glaube das Thema Tanz – als Ausdruck von Freude – hat mich während der Aufnahmen immer wieder beschäftigt, weil es eine besonders freudvolle Zeit in meinem Leben war. Während wir musiziert haben, schritt die Schwangerschaft voran, und es fühlte sich so an, als würde auch mein Baby zur Musik erwachen. Nach einer Weile war ich mir sehr bewusst, dass mein Sohn ein Teil der Aufnahmen war. Er reagierte definitiv auf die Vibrationen und Rhythmen. Wenn wir Percussions aufgenommen haben, hat er wie verrückt getreten. Es fühlte sich wirklich an, als würde er zur Musik tanzen.
Wenn wir schon die ganze Zeit über Grenzüberschreitungen und das Verbinden von Welten reden, müssen wir natürlich auch noch über Ihren Auftritt im Berghain sprechen …
Das war wirklich cool, ich habe es geliebt! Der Veranstaltungsort kann einen großen Einfluss auf das Publikum haben. In einer Konzerthalle haben wir ein sehr klassisches, förmliches Publikum. Das kann auch sehr schön sein, aber wenn man dieselbe Musik an einem Ort spielt, an dem das Publikum jünger ist und steht, ist das freier, offener. Man bekommt eine ganz andere Energie.
Wussten Sie vorher, dass es sich um einen der bekanntesten Techno-Clubs der Welt handelt, der für viele fast eine Art Tempel ist?
Ja, ich habe Freunde, die House- und Trance-DJs sind. Die haben alle so reagiert: „Waaas? Du spielst wo?!“ Und ich nur: „Mh, ja …“ (lacht)
War es seltsam, an einem Ort zu spielen, der so kalt, düster und riesig wirkt, vielleicht dem Klischee von deutscher Architektur entspricht?
Wir sind tagsüber angekommen, es war leer, und wir haben den Soundcheck gemacht. Ich habe mich umgesehen und gedacht: „In so einem Raum würde ich wahrscheinlich Party machen.“ Es war lustig, tatsächlich da zu spielen. Je älter ich älter ich werde, desto weniger scheinen meine Welten voneinander getrennt zu sein.
Sie haben es gerade angedeutet: Ihnen sind ja zumindest Veranstaltungen wie Goa-Partys nicht fremd …
Damit bin ich aufgewachsen. Ich habe Trance geliebt, bin jedes Jahr nach Goa gereist und zu Festivals in Portugal und Ungarn. Das waren immer meine Auszeiten. Ich hatte viele Freunde, die DJs waren. Wir sind auf Partys gegangen, haben sie angefeuert. Ich fühlte mich allerdings ein bisschen isoliert, denn meine eigene Musik war so anders. Aber in den letzten sechs, sieben Jahren habe ich auch auf Festivals gespielt, und es ist ein wenig so, als wäre es jetzt ein gegenseitiger Austausch. Alles kommt zusammen – und das fühlt sich nicht seltsam an, sondern sehr schön.
Sehen Sie auch in dem Fall eine musikalische Verbindung? Wenn Sie sehr schnell spielen und die Noten fast miteinander verschmelzen, wirkt das auch hypnotisch.
Ich sehe diese Gemeinsamkeit bei wirklich starker, harter und dunkler Trance-Musik; sie ist völlig anders, aber auch wieder nicht. Wenn du auf der Tanzfläche bist, kannst du dich genauso in der Musik verlieren. Letztendlich ist das Ziel gleich: Es geht darum die Leute zu transportieren – tiefer zu sich selbst oder woanders hin…
…um das Bewusstsein zu erweitern…
…ja, und die Ebenen zu verbinden.
Sie haben mal gesagt, dass Sie nicht viel mit Ihrer Halbschwester Norah Jones verbindet, weil sie andere Musik spielt. Trotzdem haben sie vor einigen Jahren miteinander gearbeitet. Ging es dabei auch darum, zu sehen, ob eine Art spirituelle Verbindung besteht?
So würde ich es nicht ausdrücken. Wir wollten einfach die Erfahrung machen, miteinander zu arbeiten. Wie Sie sagten, spielen wir unterschiedliche Sachen, deswegen haben wir nicht oft die Gelegenheit, gemeinsam aufzunehmen. Aber wenn man Familie und Freunde hat, die Musiker sind, will man miteinander arbeiten, weil es eine besondere Art ist, sich miteinander zu verbinden und zu interagieren. Und das Album „Breathing Under Water“ hat alle möglichen Genres gestreift: Es gab Pop, Elektro, ein klassisches Orchester und indische Musik. Das war also eine perfekte Gelegenheit, um etwas zusammen zu machen. Es hat auch sehr gut funktioniert und viel Spaß gemacht. Danach fragten die Leute aber: “ Warum macht ihr nicht ein ganzes Album?“
Dabei gibt es keinen triftigen Grund, das zu tun.
Genau, auch wenn ich niemals nie sagen würde.
Reden wir über eine etwas allgemeiner Verbindung: Yoga, Bollywood, Buddhismus – in den letzten Jahren haben sich Teile der indischen Kultur in der westlichen Welt zu Trends oder gar festen Institutionen entwickelt. Wie wirkt sich das auf Sie als Musikerin aus?
Es macht die Sache einfacher und zugleich schwieriger. Man muss diese Trendwellen reiten, mit denen man vielleicht gar nichts zu tun hat. Ich habe zum Beispiel eigentlich nichts mit Bollywood zu tun, aber wenn Bollywood-Filme in Deutschland gerade angesagt sind, werde ich damit in Verbindung gebracht. Ich habe zwar mal eine Tänzerin in einem Film gespielt, aber das hat nichts mit meinen Sitar-Konzerten zu tun. Diese ganzen Assoziationen können in materieller Hinsicht manchmal hilfreich sein, aber sie sind auch ziemlich frustrierend. Ich schätze, das war schon immer der Fall. Als indische Musik in den Sechzigern zum ersten Mal so richtig populär wurde, hatte mein Vater die gleichen Probleme: Er wurde zwar berühmter, aber auf einmal wurden er und seine Musik mit Dingen verbunden, mit denen er nichts zu tun hatte.
Diese ganze Hippie-Sache, von der sich Ravi Shankar eigentlich immer distanziert hat …
Popkultur ist in der Hinsicht generell ziemlich frustrierend: Das 2000-jährige Erbe eines ganzen Landes zu nehmen und jeden Aspekt – von klassischer Musik über moderne Filme bis zu einer physisch-spirituellen Praxis und Mythologie – in einen großen Trend zu packen, von dem die Leute glauben, sie könnten ihn in zwei Sekunden verstehen, das ist ziemlich oberflächlich und kann, nun ja, ziemlich frustrierend sein. (lacht)
Sie haben mal gesagt, dass es natürlich Spaß mache, Konzerte zu spielen. Andererseits soll es sehr belastend für den Rücken sein, lange an der Sitar zu sitzen. Ist es schwer, das Ganze fürs Publikum leicht aussehen zu lassen?
Das hängt vom Training ab: Wenn ich einen Monat nicht geübt habe, schmerzt alles mehr – ob es die Finger sind oder das Sitzen. Wenn ich dagegen in Form bin, ist es nicht so schwierig. Trotzdem kann es schmerzhaft sein, aber wenn man etwas wirklich liebt, steht man das durch. Auch diese Schwielen… (zeigt die Einschnitte in ihren Fingerkuppen)
Autsch. Sie spielen ohne Schutz?
Ja, und manchmal schneidet man sich. Aber was soll man dagegen tun? Wenn man eine Woche nicht spielt, verschwinden sie wieder.
Im Dezember sind Sie normalerweise in Indien. Aber momentan touren Sie noch. Haben Sie schon Ihre Feiertage geplant?
Mein Mann und ich werden mit unserem Sohn über Weihnachten und Neujahr nach Thailand reisen, um etwas Zeit für uns zu haben. Danach werde ich für einen Monat nach Indien gehen, dort ein paar Shows spielen und meinen Sohn zum ersten Mal mitnehmen. Ich brauche die Zeit dort. Es ist gerade wirklich witzig, denn wir sind diesmal auf einer richtigen Winter-Tour durch Europa. Die ganze Band besteht aus Indern und Spaniern. Wir frieren alle und denken ständig: „Hier läuft was schief! Wir sollten woanders sein.“ (lacht)
Dass Anoushka Shankar nicht übertreibt, kann man anschließend auch beim Konzert im Haus der Kulturen der Welt beobachten: Ein Drummer verbringt die Pausen zwischen den Songs schniefend und schnaubend – manche Dinge passen eben doch nicht zusammen. Dass die Verbindung von indischer und spanischer Musik dagegen auch im winterlichen Deutschland für Begeisterung sorgt, davon zeugt nach dem Auftritt noch eine lange Schlange am Autogrammstand.