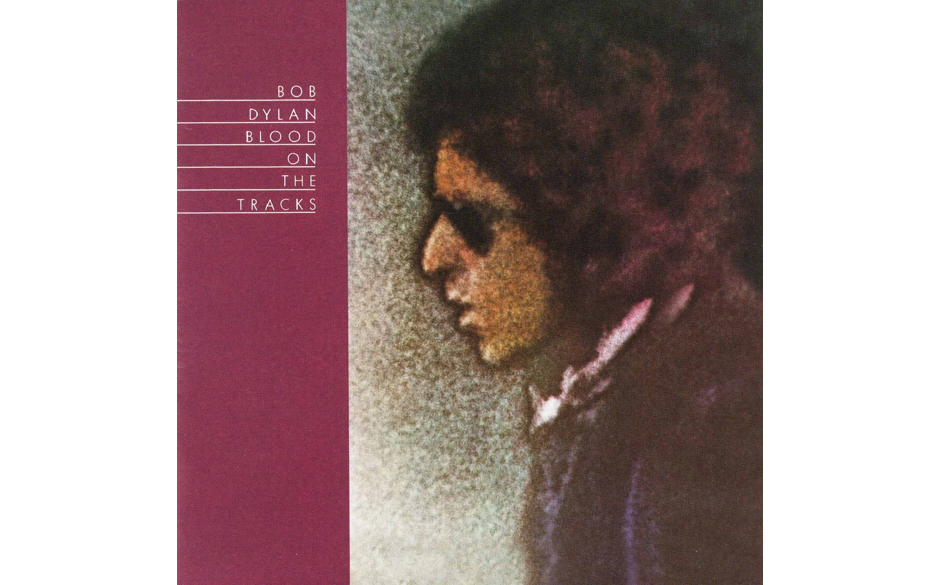Im neuen ME.MOVIES: die 33 besten Serien
ME.MOVIES widmet sich im Special der neuen Ausgabe den (Fernseh-) Serien und kürt die 33 besten. Arne Willander sah und schrieb mit.
Spätere Generationen werden diese Zeit als die Goldene Ära der Serie wahrnehmen: die Jahre, in denen die Machart ebenso umgestürzt wurde wie die Rezeption, in denen sich Fernsehserien vom Fernsehen lösten, auf DVDs, Streams und Video-auf-Bestellung verlagerten und zur Avantgarde der Filmkunst wurden. Während das Kino als Ort des Spektakels, des Zeichentricks, der Comic-Verfilmungen, Fortsetzungen und Kindervergnügen zu seinen Ursprüngen der Unterhaltung zurückkehrte, übernahm die Serie das präzise, ruhige, epische Erzählen – was nicht heißt, dass es keine Schauwerte gibt, keine Stars und keine Spannung. Die Serien bringen Stars hervor – George Clooney, James Gandolfini, Bryan Cranston, Jon Hamm, Peter Dinklage – und Stars, die vom Kino nicht mehr viel zu erwarten haben, wenden sich Serien zu: James Spader, Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Steve Buscemi, Kiefer Sutherland, Holly Hunter, Glenn Close, Woody Harrelson, Patricia Arquette. Krimi, Historienstück, Science Fiction, Fantasy, Western, Komödie, Filmbiografie, Film noir – die alten Genres erstrahlen sozusagen in neuem Glanz und gebieren seltsame Hybride wie „Lost“, „Top Of The Lake“ und „Breaking Bad“. Und die Schaulust ist zu einem sehr privaten Pläsier geworden: Meine Serie und ich.
Die Blüte des Erzählens bedeutet auch überschießende Energien und Fantasien, und manche Ästhetik wirkt bereits obsolet: Noch vor zehn Jahren waren „Ally McBeal“, „Sex And The City“, „Desperate Housewives“ und „Boston Legal“ die Spitze der narrativen Innovation – heute wirken sie wie betuliche Kammerspiele mit cleveren Dialogen. Der Auszug der „Sopranos“ aus dem – jedenfalls deutschen – Fernsehen war das Signal für die neue Form des Sehens: Samstag nach dem „Aktuellen Sportstudio“ war nicht die Zeit für eine so bittere und brutale, so komische und wahrhaftige Fortsetzungs-Saga, und die Fernsehsender fanden auch niemals eine Zeit dafür.
Man könnte sagen: Während man früher beiläufig Serien guckte (vor oder nach dem Abendessen, vor oder nach den „Tagesthemen“, am Dienstag oder Mittwoch), hat man heute die absolute Freiheit – und das Wochenende ist gerade gut genug. Serien seligen Angedenkens wie „Bonanza“, „Raumschiff Enterprise“, „Daktari“, „Starsky & Hutch“, „Kojak“, „Detektiv Rockford“, „Die Straßen von San Francisco“, „Rauchende Colts“, „Dallas“ und „Magnum“ hatten ihre Stammplätze, aber man musste nicht immer dabei sein. „Ein Colt für alle Fälle“ wurde von Werbung unterbrochen, die nicht unbedingt die Raffinesse des Plots zerstörte. Die alten Zeiten waren in dieser Hinsicht gutmütig. Sind die Serien von damals eigentlich GUT? Das war niemals die Frage. Natürlich sieht man heute, wie LANGSAM „Detektiv Rockford“ ist und dass „Kojak“ überwiegend nicht in Manhattan, sondern im Atelier gedreht wurde. „Die Straßen von San Francisco“ ist dröge, aber es ist San Francisco, während „Dallas“ nur mit ein paar wiederkehrenden Tapetenansichten als Ortskennzeichnungen Dallas ist. „Vegas“ ist nicht Las Vegas, „Das Haus am Eaton Place“ steht nicht am Eaton Place, „Der Denver-Clan“ agiert nicht in Denver. Diese Sitz- und Steh-Serien sind Seifenopern in dem Sinn, wie Western „Pferdeopern“ genannt wurden, bis John Ford und Howard Hawks kamen, die tatsächlich Pferdeopern drehten.
Die großen Serien verlangen heute eine Aufmerksamkeit und Hingabe, wie man sie einst der Literatur widmete – schon weil man oft den Originaldialog hören oder mitlesen muss. Es ist eine Aufgabe, „Mad Men“ zu verstehen, denn die Dramatik vollzieht sich fast vollkommen in der Sprache. Dass Don Draper Anzüge trägt, säuft und Sex hat, ist die äußere Ausstattung einer gähnenden Leere, die ihn selbst entsetzt, und die Ausstattung der Räume in „Mad Men“ spiegelt die Künstlichkeit der Lebensentwürfe: Es ist eine bloß behauptete Welt, in er die Wirklichkeit des Krieges, der Bürgerrechtsbewegung, der Ermordung Kennedys als absurde Einbrüche erscheinen.
Amerika versichert sich in den meisten epischen Serien seiner Vergangenheit – mit wenig schmeichelhaften Befunden: „Band Of Brothers“, „The Pacific“, „Boardwalk Empire“, „Masters Of Sex“. In nahezu hermetischen Welten suchen diese Erzählungen das Exemplarische. Das Militär, die Polizei und die Mafia sind dabei ebenso parabolisch wie bei den Serien, die eine Psychopathologie der Gegenwart zeichnen: „Homeland“, „Die Sopranos“, „True Detective“, „Sons of Anarchy“, „The Bridge“. Das alles mag so wenig realistisch sein wie Shakespeare – Barack Obama hat jedenfalls bekanntermaßen „Homeland“ geschaut. Nicht Authentizität ist das Signum der Serien, sondern Wahrhaftigkeit, nicht Affirmation, sondern Ambivalenz. Anders gesagt: Jedermann liebt es, diese Helden zu hassen (oder hasst es, sie zu lieben).
Und nun kommt „Manhattan“: Was „Masters Of Sex“ für die sexuelle Befreiung war, „Breaking Bad“ für den Drogenhandel und „Boardwalk Empire“ für den Alkoholschmuggel, das ist nun „Manhattan“ für die Atomphysik? Nein, darum geht es NICHT WIRKLICH. Wir werden das Jahr 1943 in Gestalt einer sehr elitären akademischen Gesellschaftsgruppe betrachten – auch den Weltraum kennen wir ja nur so.