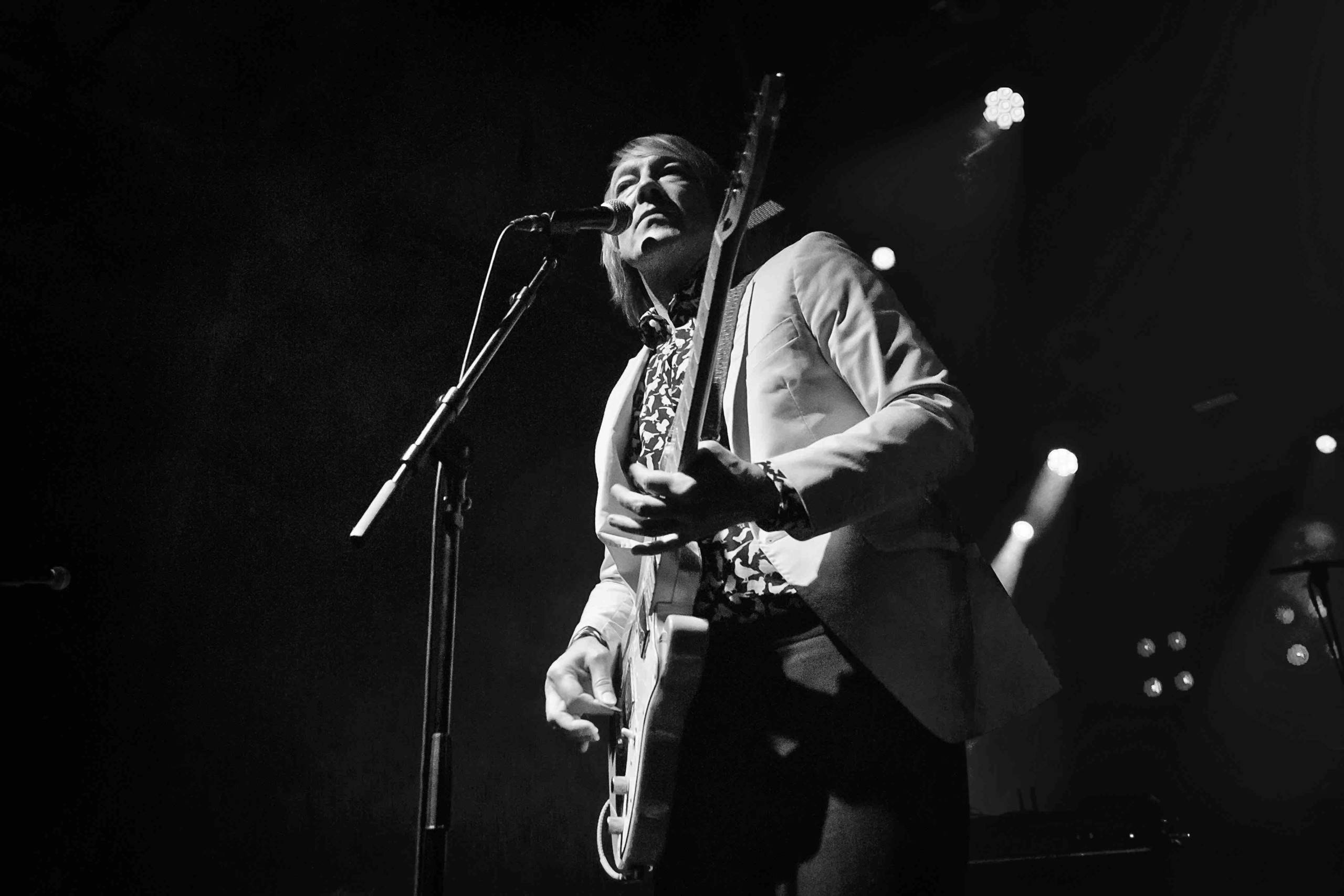Im Zweifel für den guten Song
Jazzerin Lisa Bassenge und Schriftsteller Thomas Melle reden über ihr gemeinsames Album, den Einfluss von Blumfeld und ewige Klischees
Mit den Texten quälen sich deutsche Songwriter immer ganz besonders. Grönemeyer und Campino geben es zu – den Ergebnissen nach haben noch zahllose andere größte Probleme beim Dichten. Manchmal fragt man sich, wieso sie sich nicht häufiger helfen lassen, von den Lyrik- und Prosafachleuten, die in den Literaturverlagen heranwachsen. Die Berliner Jazz-Pop-Solistin Lisa Bassenge hat nun den Versuch gewagt: Den Großteil der Songs für ihr neues Album „Wolke 8“ hat sie zusammen mit Thomas Melle getextet, einem der gefragtesten Theaterautoren Deutschlands, seit 2011 auch Romancier („Sickster“), und zufällig Bassenges Lebenspartner. Wir baten die zwei, die Jazzerin und den Schriftsteller, zum Werkstattgespräch.
Frau Bassenge, Herr Melle – warum schreiben so wenige Schriftsteller Texte für Popsongs?
Bassenge: Weil alle Singer/Songwriter glauben, dass sie das selbst am besten können.
Ein paar Ausnahmen gab es ja: Jörg Fauser mit seinen Texten für Achim Reichel, Robert Hunter für Grateful Dead und Bob Dylan. Und jetzt Sie, Herr Melle.
Melle: Obwohl ich an sich keine Lyrik schreibe, auch kaum welche lese. Da mag ich im Zweifel lieber einen guten Song, der gar nicht erst versucht, durch Schneegestöber oder ausgefuchste Grammatik einen einfachen Gedanken zu verkomplizieren.
Bassenge: Vielleicht haben die meisten Schriftsteller ja gar kein so großes Interesse an Musik.
Den Eindruck hat man nicht, wenn man neue Romane liest: Da sind die iPods der Helden oft besser bestückt als die Bücherregale …
Melle: Für mich hat sich diese Schreibtechnik mittlerweile erschöpft. Aber vielleicht muss zwischen Musikern und Autoren auch einfach mal ein Dialog entstehen. Dass der eine zum anderen sagt: „Schreib doch mal was für mich!“
Wer hat von Ihnen beiden den Dialog begonnen?
Bassenge: Das Texteschreiben fällt mir generell eher schwer. Dieses Mal war es besonders schlimm. Und dann kam zum Glück Thomas und bot mir seine Hilfe an. Er ist ja irre schnell, hat gute Einfälle. In einer Kernzeit von einem Monat haben wir das dann runtergerissen.
Dabei sind sehr unterschiedliche Stücke herausgekommen. Gab es bewusste Vorbilder?
Bassenge: Interessanterweise habe ich mich dieses Mal teilweise an Sachen orientiert, die ich selbst gar nicht so sehr mag, die aber von Thomas kamen. Blumfeld zum Beispiel, auf deren lyrische Qualitäten er schwört.
Ausgerechnet an Blumfeld würde man beim Hören der Platte gar nicht denken …
Melle: Ich bin bei Songs bislang immer nur Konsument gewesen. Teilweise exzessiv, mit Blumfeld eben, Tocotronic, allem Möglichen. Ich habe mich immer sehr für Lyrics interessiert. Wenn mir ein Lady-Gaga-Song gefällt, muss ich wissen, was sie da singt. Das heißt nicht, dass die Texte immer große Kunst sein müssen.
Das Schwierigste an Songtexten ist, Klischees zu vermeiden.
Bassenge: Wir haben uns nicht bewusst dazu entschieden, Klischees zu vermeiden. Aber wir waren freundlich gegenüber unorthodoxen Formulierungen.
Melle: Das war für mich als Mitautor das Interessanteste: große Themen mit einer gewissen Leichtigkeit anfassen zu können. Einer Leichtigkeit, die durch die Form schon gegeben ist, durch die Art von Musik, die Lisa macht. Sie steht ja nicht als beschwerte Schicksalsgöttin auf der Bühne, wie Soap & Skin zum Beispiel.
Bassenge: Vielleicht wimmelt die Platte ja auch von Klischees. Was für Klischees meinen wir eigentlich?
Meistens etwas mit Sternen. Oder mit Anfang und Ende.
Melle: Oder wie bei dieser Sängerin Cäthe: „Gott sei Dank bin ich nur ein kleiner Punk“, „Unter meiner Haut, da will ’ne heiße Sonne raus“ und so weiter. Das sind zwar keine Klischees. Aber es ist trotzdem grauenhaft.
Gefühlige Gemeinplatz-Reime gelten heute als besonders wertvolle Texte, seit Kumpel-Gitarrenbands wie Tomte oder Romantikphänomene wie Rosenstolz groß wurden.
Bassenge: Was mich an dieser Welle besonders gestört hat, war gar nicht, dass die Leute so viel Schmalz verzapft haben. Sondern die Reaktionen darauf, dieses „Man darf jetzt wieder deutsch singen“ in den Medien. Ich habe mal mit Judith Holofernes darüber gesprochen, die ja mit Wir sind Helden auch bei dieser Welle dabei war. Ich fragte sie: „Was meinst du dazu?“, und sie antwortete: „Ich durfte schon immer auf Deutsch singen!“
Das war damals ja auch eine gewisse Gegenreaktion gegen Bands wie Blumfeld.
Melle: Man muss gar keine Front zwischen Wir sind Helden und Blumfeld eröffnen – die Spannung zwischen den Toten Hosen und den Ärzten sagt viel mehr aus. Die Toten Hosen wollen immer die großen Begriffe rüberbringen. Die Ärzte haben etwas Selbstironisches, eine Einfachheit.
In den 90er-Jahren gab es in Deutschland einen Popliteratur-Hype. Warum haben diese Bücher nicht die Musik beeinflusst?
Melle: Weil Popliteratur in Deutschland den Endpunkt des Schnöseltums darstellte. Die Oberfläche der Oberfläche zum Ende des Jahrhunderts – davon lässt sich niemand inspirieren. Wann hat zuletzt ein Schriftsteller die Musik beeinflusst? Bret Easton Ellis vielleicht? Wahrscheinlich nicht mal der. Auch nicht Rainald Goetz.