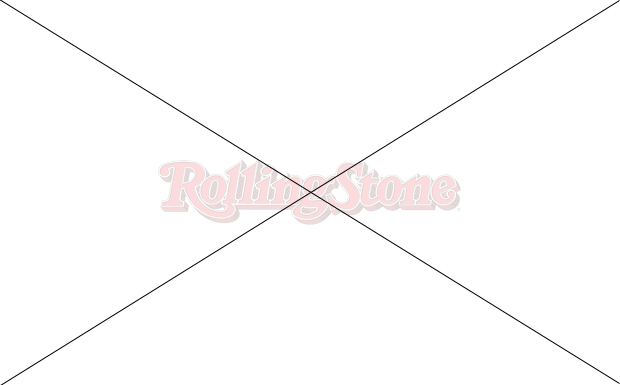PJ Harvey: Die Gewinnerin des Mercury Prize im Interview
PJ Harvey hat mit ihrem Album "Let England Shake" den renommierten Mercury Prize gewonnen und bei der Gelegenheit "The Words That Maketh Murder" live gespielt. Aus diesem Anlass hier noch mal unser Interview, das wir kurz vor ihrer Tour führten.
PJ Harvey ist nun auf eine weitere Weise in die Musikgeschichte eingegangen: Sie ist die erste Künstlerin, die zweimal in ihrer Karriere den Mercury Prize gewonnen hat. Bereits 2001 erhielt sie den renommierten britischen Musikerpreis für ihr Album „Stories From The City, Stories From The Sea“ und war damit der erste weibliche Soloact, der den seit 1992 bestehenden Award gewann. Zehn Jahre später erhielt sie ihn nun für ihr grandioses Album „Let England Shake“. In ihrer kurzen Rede sagte sie: „Ich hoffe, ich werde den Preis in zehn Jahren noch einmal mit einem anderen Album gewinnen können. Es ist mir sehr wichtig, dass ich Musik mache, die auch für andere, und nicht nur für mich Relevanz hat.“ Zudem erinnerte sie sich an den von 9/11 überschatteteten Award von damals: „Vor zehn Jahren war das eine sehr surreale Erfahrung. Ich glaube, das ging jedem so. Ich erinnere mich eigentlich nur noch daran, in meinem Hotelzimmer zu sitzen und im Fernsehen zu sehen, wie das Pentagon brennt. Die Preisverleihung war so weit weg von mir an diesem Abend, dass es sich wirklich seltsam anfühlte. Was wohl allen Anwesenden so ging. Hier und heute also noch einmal diesen Preis zu bekommen, bedeutet mir sehr viel.“
Vor der Verleihung am gestrigen Dienstag spielte PJ Harvey noch eine wunderbare Live-Version von „The Words That Maketh Murder“. Hier ist sie, und im Anschluss noch einmal unser Interview:
–
Wir ergriffen kurz vor ihre Tour im Juli die Chance, noch einmal mit ihr am Telefon zu sprechen – obwohl wir das ja schon zum Release von „Let England Shake“ getan haben. Aber Interviews mit PJ Harvey sagt man nun mal nicht ab – und sei es auch nur, um zu erfahren, ob sie wirklich so schwierig ist, wie man immer wieder hört und liest. Während man also – auch als abgewichster Musikjourno mit ausreichend Interviewerfahrung – ein wenig nervös am Hörer wartet, sich überlegt ob man sie nun „Polly“ oder „Miss Harvey“ nennt und dabei natürlich eine trockene Kehle bekommt, werden schon mit den ersten Worten alle Sorgen wegcharmiert: „Hi Daniel, it’s Polly. Polly Harvey. Nice to talk to you.“
Hallo, äh, Polly. Schön, dass du dir noch mal Zeit für uns nimmst. Man hört ja immer wieder, dass du Interviews eher ungern absolvierst.
Das stimmt so nicht. Wie es wird, liegt an den jeweiligen Gesprächspartnern. Oft kommen sehr interessante Konversationen zustande, und dann habe ich große Freude daran. Aber ich zeige es eben auch, wenn mich Jemand langweilt, oder wenn ich das Gefühl habe, da interessiert sich Jemand nicht wirklich für meine Kunst. Aber ich weiß natürlich auch, dass es eben so funktioniert: Als Künstler sollte man dankbar sein, eine Plattform zu bekommen, in der man sich präsentieren kann. Da muss man auch einfach mal die Zähne zusammenbeißen.
Na, dann hoffe ich mal, dass ich die richtigen Fragen habe…
(Lacht) Ich wollte dich damit jetzt nicht unter Leistungsdruck setzen.
OK, dann starte ich gleich mit der originellsten Frage: Wie würdest du deine Musik beschreiben?
Neeeiinnn! Bitte nicht (lacht, ja – tut sie wirklich).
Als ich „Let England Shake“ bekam, las ich auf der Heimfahrt von der Arbeit die Lyrics sehr aufmerksam, ohne die Musik hören zu können – und merkte bei „In The Dark Places“, dass sie mich selbst ohne Musik ungemein packten. „We got up early, / Washed our faces, / Walked the fields / and put up crosses.“ Das Bild war so stark, dass ich es sogleich vor Augen hatte. Später las ich, dass du der Meinung bist, deine Sprache erst jetzt so gut im Griff zu haben, dass du solch düstere Themen auf dem Papier niederringen kannst. Siehst du dich immer noch als Lernende, wenn es um das Schreiben geht? Obwohl du seit 20 Jahren Songs schreibst?
Ja. Ich lerne immer. Und je mehr ich lerne, desto stärker wird das Gefühl, ich müsste noch mehr lernen. Ich liebe das Lernen – mein ganzes Leben schon. Dieser spürbare Prozess, sich zu verbessern ist ein wunderbares Gefühl. In dem Interview, das du ansprichst, wollte ich klarstellen, dass ich bei „Let England Shake“ anders gearbeitet habe als zuvor. Ich habe erst die Worte zu Papier gebracht, und dann überlegt, wie die Musik klingen soll. Das fing schon bei der Arbeit zu „White Chalk“ bei einigen Songs an, aber diesmal habe ich es konsequent durchgezogen. Ich wollte genau diese Qualität erreichen – dass die Worte die Kraft haben, auch für sich stehen zu können.
Da liegt natürlich die Frage nahe, ob es für dich nun auch zur Option wird, eine neue Disziplin der Kunst zu beginnen – und vielleicht einen Roman zu schreiben?
Bevor ich sterbe, möchte ich noch ein Buch geschrieben haben – einen Roman oder eine Sammlung von Kurzgeschichten. Aber jetzt, zu diesem Zeitpunkt, bin ich dafür einfach noch nicht gut genug. Ich bin eine Songwriterin – das kann ich. Ich versuche zwar, meine künstlerischen Fähigkeiten in Sachen Poesie und Prosa oder meine Malerei zu verbessern, aber ich konzentriere mich weiterhin auf meine Stärke. Es wäre natürlich schön, die Zeit zu haben, mich auf allen Spielfeldern der Kunst zu schulen, die mich begeistern – aber das geht eben nicht.
Mein Kollege Jörg Feyer, der das Interview mit dir zum Albenrelease führte, nannte seinen Text: „Die unheimliche Patriotion“. Das war aufgrund des Albums und deiner Antworten schlüssig – aber trotzdem zuckte ich kurz zusammen und fragte mich: Willst du wirklich in dieser Ecke stehen und Patriotin genannt werden?
Ich akzeptiere, dass jeder seine eigene Interpretation hat zu meiner Musik. Und wenn man die schlüssig an andere vermitteln kann – um so besser. Ich selbst gebe nämlich grundsätzlich keine Interpretationen aus. Ich mag es nicht, wenn ein Künstler sein Werk erklärt. Weil das eigentlich egal sein sollte. Das Schöne an der Kunst ist ja, dass sie eigene Assoziationen und Gefühle wachsen lässt. Ich kann also diese Lesart nicht falsch nennen. Ich habe versucht, „Let England Shake“ so offen wie möglich zu schreiben, und es nicht zu genau in einer bestimmten Zeit zu verorten. Und auch, wenn es um mein Heimatland geht, wollte ich die Gefühle dafür so allgemeingültig wie möglich beschreiben. Ein Song wie „England“ ist zwar klar nach meiner Heimat benannt, aber das Thema bewegt uns ja alle – egal, aus welchem Land man stammt. Wir alle plagen uns mit der Hassliebe für unser Land, empfinden Wut über die Regierung und sorgen uns um die Außenwirkung unseres Landes in der Welt. Mal empfinden wir Stolz, mal Scham.
Ich möchte nochmal auf den Song „In The Dark Places“ zurückkommen: Diese Beschreibung der jungen Männer, die auf das Schlachtfeld ziehen und Gräber für ihre toten Kameraden graben, wirkte sehr literarisch für mich. Es erinnerte mich an einen Autor aus meiner Heimatstadt – Erich Maria Remarque – und seinen berühmten Roman „Im Westen nichts Neues“. Welche literarischen Vorbilder standen bei diesen Szenen Pate?
Ich lese viel – eigentlich immer, wenn ich die Zeit finde. Deshalb kann ich mich nicht dagegen wehren, dass viele literarischen Werke in meine Arbeit einfließen. In der Entstehungszeit des Albums habe ich viele Geschichtsbücher über vergangene Kriege gelesen – daher vielleicht die harte, direkte, nüchterne Sprache. Aber auch die Filme, die ich geschaut habe, waren wichtig. Stanley Kubriks „Barry Lyndon“, „Paths Of Glory“ und „2001“. Ken Loachs „The Wind That Shakes The Barley“. Ari Folmans „Waltz With Bashir“.
Wenn ich Texte lese, stelle ich mir immer vor, wie sie wohl entstanden sind. Bei Bukowski und Hemingway habe ich das Hämmern einer mechanischen Schreibmaschine im Ohr, bei dieser modernen Lifestyle- und Befindlichkeits-Prosa denke ich an glatte Menschen, die ihre Texte in ein poliertes MacBook streicheln. Wie schreibst du?
Ich schreibe mit einem Füllfederhalter. Auf weißem Papier. Meist auf recycletem Papier, das auf der Rückseite mit irgendwas bedruckt ist. Ich brauche sehr viel Zeit, bis ein Text so reif ist, dass ich ihn als Song sehe. Ich ändere und streiche unheimlich viel. Es kann zwischen sechs Monaten und einem Jahr dauern, bis ich mit einem Song fertig bin – wobei ich natürlich dazwischen auch an anderen Songs arbeite – meist sind es 30 bis 40 gleichzeitig.
Wenn ich das höre, muss ich an Nick Cave denken, der mal erzählte, dass er jeden Tag in sein „Büro“ geht, um dort 9to5-mäßig Songs zu schreiben. Bis er Feierabend hat. Wie sieht ein Arbeitstag bei dir aus?
Meine kreativsten Zeiten sind die frühen Morgenstunden. Ich stehe also früh auf und arbeite bis zum Mittag. Dann, nach einer Mittagspause, verbringe ich den Nachmittag damit, Informationen und Inspirationen zu sammeln. Ich lese, schaue Filme, recherchiere im Internet. Diese Tagesteilung funktioniert sehr gut für mich. Morgens der Output, nachmittags der Input.
Ich sehe gerade – unsere Zeit ist fast um. Eine Frage hätte ich aber noch: Gab es eigentlich einen Schlüsselmoment, der dir zeigte: ‚Ich bin Sängerin! Nicht Regisseurin, nicht Autorin, sondern zu allererst Sängerin?‘
Das war der Tag, an dem ich meine erste Gitarre bekam. Da war ich 16. Ich spielte schon seit dem 11. Lebensjahr Saxophon und hatte meine Freude an der englischen Sprache und am Schreiben von Geschichten entdeckt. Es gab diesen Aha-Moment, als ich plötzlich merkte, dass ich mein Schreiben und meine Musik zusammenbringen kann. Ich begann meine Worte mit den Akkorden, die ich lernte, zu verbinden – und das gab mir ein Gefühl, dass ich so stark nie zuvor empfunden hatte. Eine Mischung aus Euphorie und Befriedigung, die ich bis dahin nicht kannte.
Heute kann mal wohl sagen, dass die Sache mit dem Songwriting verdammt gut gelaufen ist…
Ja. Ich hatte sehr viel Glück. Ich liebe meine Arbeit. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann nicht mehr Musik und Worte zu verbinden.
Ein schönes Schlusswort. Dann danke für das Gespräch – ich hoffe, es war nicht eines dieser Interviews, von denen wir am Empfang sprachen.
(lacht) Keineswegs. Hab noch einen schönen Tag!
PJ Harvey hat für jeden Song aus „Let England Shake“ von Seamus Murphy einen Kurzfilm drehen lassen. Die Bilder zu den einzelnen Songs entstanden während eines Roadtrips, den Murphy im Vorfeld bewältigt hatte, um einen neuen Blick auf seine Heimat England zu bekommen. Hier gibt es die bisher fertigen Filme – und hier die drei neusten: