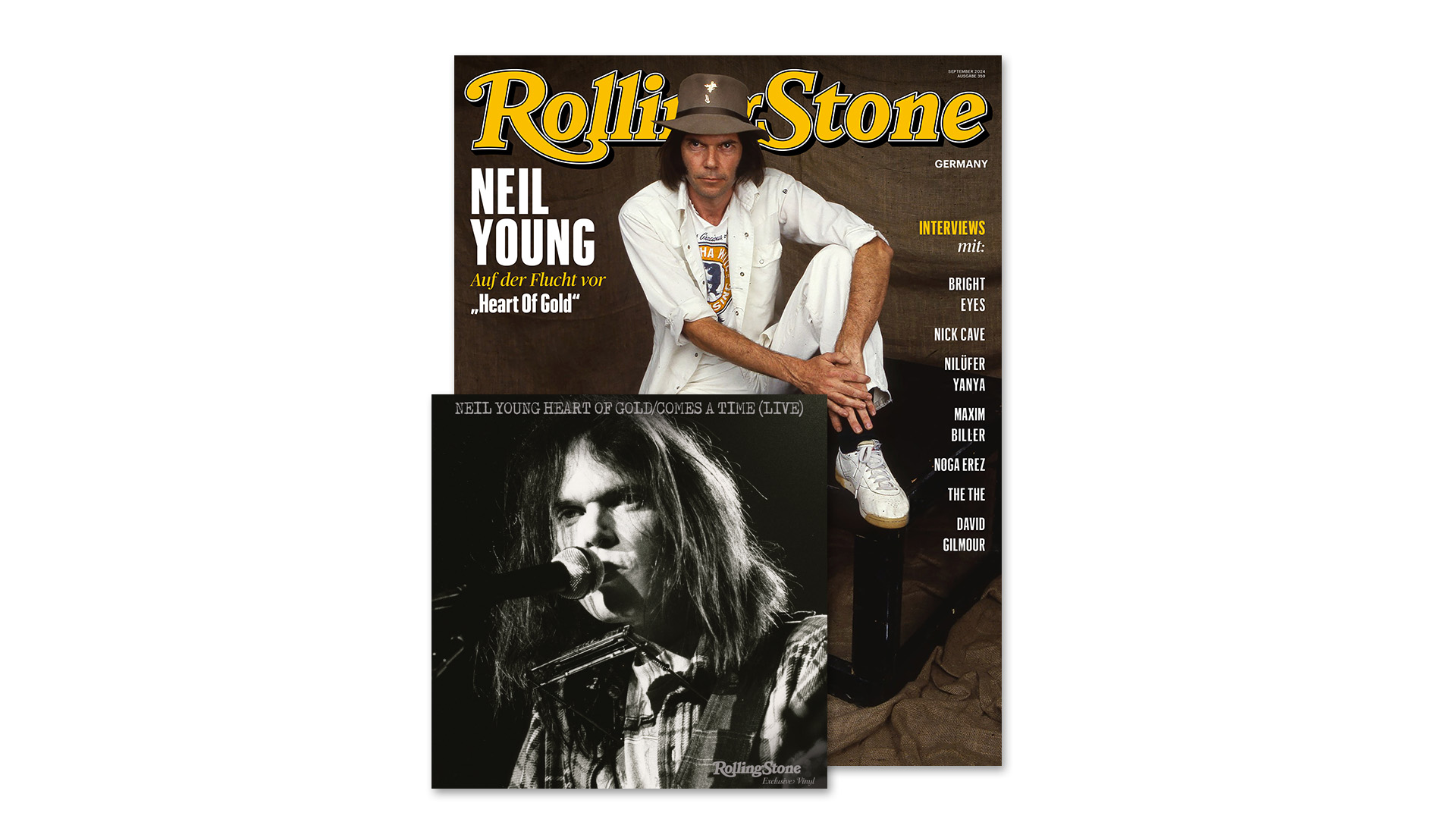Bright Eyes – Every Day And Every Night :: Saddle Creek
Jetzt kommt alles auf den Tisch, die Wahrheit ans Licht. Jedes genialische Frühwerk, jede EP, jeder Schnipsel von Bright Eyes. Wir höten die Zukunft der obsessiven, phantasmagorischen Frickelmusik, und ihr Name ist – Potzbütz -Conor Oberst. Vom Ende her betrachtet, lässt sich gut rekonstruieren, weshalb „Lifted“ eben keine Offenbarung ist, sondern schon die Erfüllung (und letztlich der schwerste, der gewaltigste Brocken des Jahres 2002).
Es ging „Fevers And Mirrors“ voraus, ein stupendes, unter anderen (was nützt es nur?) an Smog, The Cure, Peter Gabriel und Paul Simon geschultes Werk, das Oberst auf dem an Dramatik nicht zu überbietenden Höhepunkt mit einem profanen Radio-Interview unterbricht, bei dem er selbst über die Platte reflektiert, auf der das alles konserviert ist. Zugleich nimmt er vorweg, was bald darauf in der Wirklichkeit (mit deutschen Journalisten) passieren sollte: Fragen nach Autobiografie, Kindheit, Obsessionen, Ängsten, Katholizismus, Empathie. Da ist schon alles versammelt, sogar die souveräne Selbstreferenz, die Meta-Beobachtung. Oberst war 21 Jahre alt. Aufgenommen in den Tagen vor dem Jahres- und Jahrtausendwechsel 1999.
Jetzt auch veröffentlicht: das Album „Oh Holy Fools: The Music Of Son, Ambulance And Bright Eyes“. Auch Son, Ambulance ist so eine idiosynkratische, gewitzte, hochmelodische Saddle Creek-Band. Beide Ensembles teilen sich die Platte mit je vier Stücken, und beide zielen viel höher als bloß auf eine Talentprobe. Das Zirkushafte, Gauklerische, Mittelalterliche der Coverzeichnung reicht bis die Songs hinein. 4,0
Das gilt zumal für die EP „Every Day And Every Night“ von 1999: Conor Oberst als Hysteriker, Zauberer und manischer Beobachter, der Textlawinen ohne Refrains speit und die Worte auch noch in rummelplatzhafte, schwindelerregende Melodien zwängt, dabei heiser ausbrechend, panisch, erleuchtet. Die Trilogie „A Line Allows Progress, A Circle Does Not“, „A Perfect Sonnet“ und „On My Way To Work“ ist das bis dahin beeindruckendste und sogar für Obristen überraschende Zeugnis dafür, wie weit der Depressionskünstler aus Omaha über alle Vorbilder hinausgeht: „Besides, we are all making money and we are all fucking alone and we don’t know what we are/ The older ones are dying/ Maybe we are all dying“, keucht Conor wie ein Bruder Holden Caulfields. Seit den frühen Platten von Will Oldham und Bill Callahan hat es solch ein Talent nicht mehr gegeben.
Die frappierenden, erratischen Vorstudien, noch schwer erhältlich (und manchmal schwer erträglich), gibt es auf „A Collection Of Songs Written And Recorded 1995-1999“ (3,5).
Da klingt der 15-Jährige mitunter wie ein greiser Lungenkranker, die Gitarre schrummt und schabt, alles ist Chaos, und dazwischen passen auch noch ätherische Duette, live aus dem Kinderzimmer.