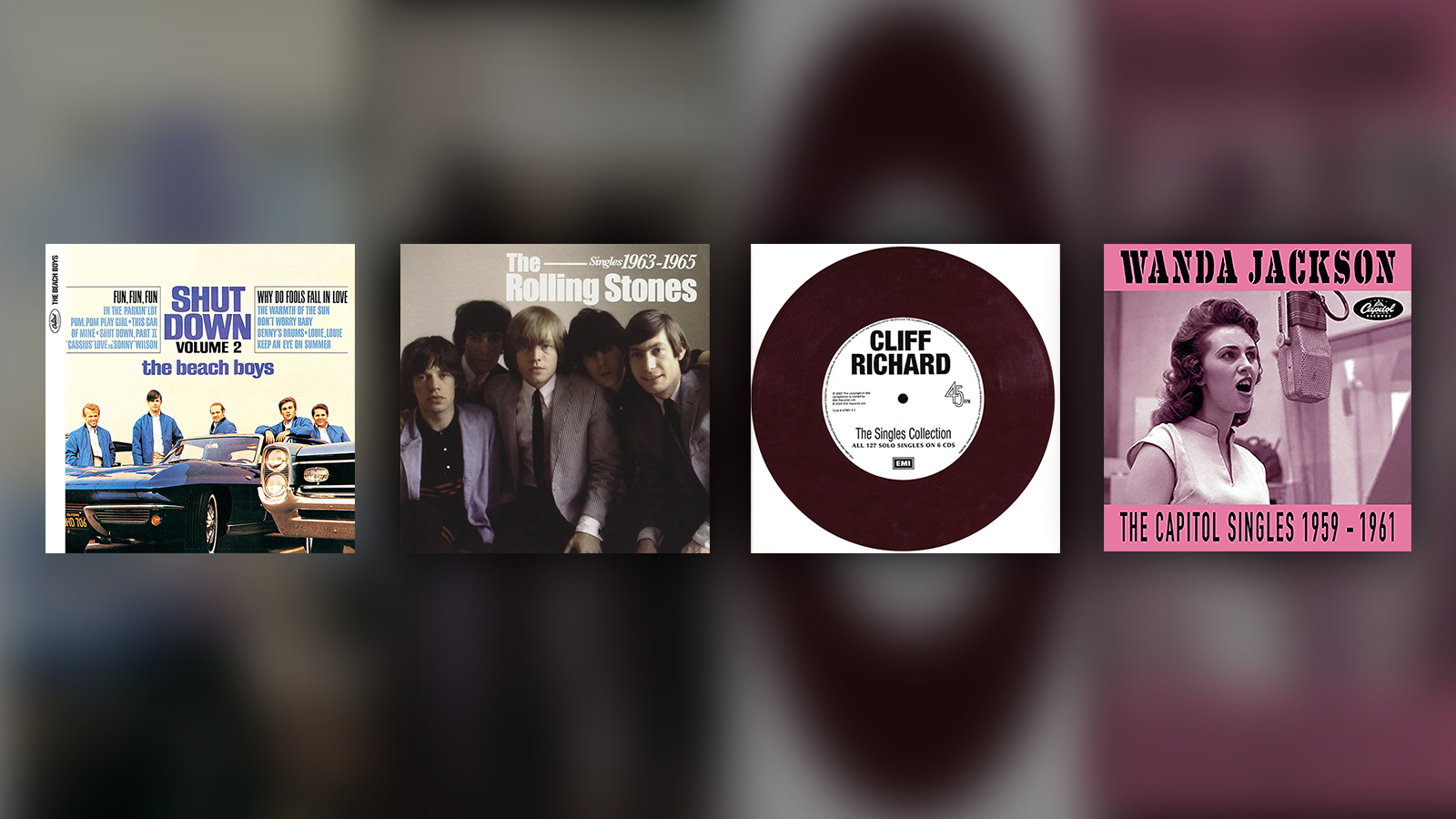„Mein Publikum ist mir nicht gefolgt“
Anfang der 70er Jahre war er nicht nur Stammgast im deutschen Feuilleton: Als Pop-Ikone wurde Wolf Wondratschek auch vom literarischen Mainstream gefeiert. Mag sein, sagt er inzwischen, dass es das falsche Publikum war, dass es überhaupt nicht an Literatur und seinem einsamen Ringen um Worte interessiert war. Denn das - und nur das - sei heute sein literarisches Kriterium.
Früher „begannen für ihn die Tage mit einer Schußwunde“, heute schreibt er Briefe. In den 70ern saß er in „Chuck’s Zimmer“ und schrieb über tote Typen, die Rock’n’Roll tanzen – und dass Henry Miller wieder auf den Strich geht. Eine Dekade später fragte er sich schließlich, ob er nicht das Arschloch der 80er Jahre sei und lamentierte über „die Einsamkeit der Männer“. In den 90ern, nachdem er immerhin 200 000 Exemplare seiner Gedichtbände verkauft hatte, lamentierte er, nur noch „einer von der Straße“ zu sein und schrieb über „das Mädchen und den Messerwerfer“. Im letzten Jahr erschienen seine „Kelly Briefe“, ein imaginärer Briefwechsel zu einer bizarren Liebesgeschichte, der die Distanz zwischen zwei Liebenden, zwischen Phantasie, Realität und Wahnsinn und zwischen Wien und New brk geringer werden lässt.
Doch nicht New York, sondern Saarbrücken ist Schauplatz eines Gespräches mit dem geläutert wirkenden Berufslyriker. Nicht New York – dort, wo ein Großteil seiner „Kelly Briefe“ spielt -, nicht London und noch nicht einmal Berlin, Hamburg oder München. Einfach nur Saarbrücken. Keine Metropole, in der die Schickeria Smalltalks mit Proseccos zelebriert und Kunst wie Kitsch gleichermaßen zu Kultur kürt. Einfach nur Saarbrücken,
Kappengasse 12, „Hotel zum Fuchs“. Zimmer Nr. 7 ist Schauplatz eines Gespräches mit dem einstigen enfant terrible der deutschen Literatur.
Zimmer Nr. 7. Ein Zimmer, das dem eines Stundenhotels ähnelt Ein Zimmer in der Art, wie es ein junger Wondratschek schon oft gesucht hat, von denen ein älter gewordener Wondratschek (56) offenbar genug gesehen hat. „Eine Ungeheuerlichkeit, mich in einer solchen Kaschemme unterzubringen“, grummelt die Subkultur-Ikone der deutschen Pop-Literatur. Vermutlich wollte ihm der Literaturprofessor, der ihn zu Lesung und Seminar einlud, damit sogar einen Gefallen tun. „Einzige Prämisse Wondratscheks war, dass es ein Hotel in der Altstadt sein sollte“, entschuldigt sich der Professor später. Egal, dieses Zimmer ist wie kein anderer Ort geeignet, Wondratschek einmal mehr das Klischee eines Underdog der Kulturszene erfüllen zu lassen.
„Dieses Zimmer ist schlimmer als jede Kaschemme in einem Stundenhotel“, wiederholt indes Wondratschek und bietet einen Platz zu seinen Füßen an. „Sorry, einen Stuhl gibt’s hier nicht“, meint er sarkastisch, „setzen Sie sich einfach aufs Bett und beginnen Sie, Ihre Fragen zu stellen.“
Ja, so stellt man sich ihn schon vor, wenn man seine Schriften verinnerlicht hat. Schließlich wirkt er immer noch genauso, wie er sich früher selbst dargestellt hat Wie ein Mann, der in „Chuck’s Zimmer“ sitzt und sich die Worte abringt Zum Beispiel über ,James, Jimi und Janis“ und deren Freitod-Festivals.
„Doch das ist Vergangenheit“, erklärt er und hat sich damit auf das Spiel der Fragen und Antworten eingelassen – wie ein passionierter Schachspieler, der vielleicht noch an einem aufgebauten Schachbrett vorbeigehen, aber niemals der Versuchung widerstehen kann, auf eine Eröffnung durch einen Gegenzug zu reagieren. „Viele der damaligen Gedichte waren Fingerübungen, Übungen zur Perfektionierung des literarischen Handwerks. Die Pflicht, um zur Kür gelangen.“ Irgendwie, obwohl er es nicht ist, wirkt er wie ein altgewordener Macho, der seine Zeit überlebt hat und nicht mehr in die jetzige passt. Nein, ein Foto, wie er da in Jeans, viel zu weit offenstehendem Hemdkragen, Cowboy-Stiefeln und schwarzem Wollmantel auf dem Bett flezt, verweigert er.,,Nein, das ist privat“, sagt er und erinnert sogleich an die Fragen, die ich eigentlich stellen und er nicht beantworten wollte. „Am Abend vor einer Lesung gebe ich keine Interviews“ meinte er eine Stunde zuvor am Telefon. „Da konzentriere ich mich auf meine Arbeit Und nach meiner Arbeit möchte ich meine Ruhe.“
Ja, irgendwie stellt man ihn sich genau so vor: ein wenig arrogant, selbstherrlich und egozentrisch. Begegnet man ihm, vermischt sich der ursprünglich erfahrene Eindruck von Arroganz mit einer Nuance von Weltmüdigkeit und plötzlich aufkommender Sympathie. Wondratschek vermittelt auch im Gespräch die Atmosphäre seiner Lyrik. Es ist dieses Gefühl, das einst ein Kritiker mit den Worten „Entweder man liebt seine Gedichte – oder man liest sie heimlich“ beschrieb. Und mein Gott: Der Mann spricht tatsächlich so, wie er schreibt Fast immer druckreif. Manchmal andächtig, immer aber auf der Suche nach dem richtigen Wort für die richtige Stelle zum richtigen Zeitpunkt Mal zynisch, ironisch, mal trivial, immer aber prägnant und akkurat Seine gesagten Worte gehen so glatt ins Ohr wie seine geschriebenen. Und es macht Spaß, ihm zuzuhören.
„Für mich sind Schönheit, Stille, Präzision und Musikalität die Aspekte, die die Macht der Wörter ausmachen. Aber vor allem ist es der Zauber, den Wörter erzeugen können und letztendlich das, was mich an ihnen fasziniert“, erklärt er seinen Trieb, noch immer solche Worte produzieren zu müssen.
„Durch die Kombination der verschiedenen Möglichkeiten, mit Worten umzugehen, entsteht aus den realen Worten, die die Realität meiden, Irrealität. Also das, was wir das Poetische nennen, oder auch das, was man bei Raymond Chandler ,den Zauber‘ genannt hat Daher ist es für den Schriftsteller immer eine Genugtuung, wenn es gelingt, aus diesem Rohmaterial Funken zu schlagen, Zauber herstellen zu können. Das Wesen der Macht liegt darin, überhaupt die Möglichkeit und Fähigkeit zu haben, mächtig sein zu können. Und dabei rede ich nur über Literatur – nicht über Politik. Leider hat das Wort derzeit keine Lobby, keine Sponsoren, die es solchen Wörtern erleichtern, in die breite Öffentlichkeit zu dringen…“
Gibt es jemanden, dem man die Schuld für diesen Zustand geben kann?
Schuld sind wohl viele, voneinander abhängige Faktoren. Vielleicht ist es das Millenium, das Schuld hat. Es wird sich erst wieder ändern, wenn sich alles wieder auf das Wesentliche reduziert Es ist ja nicht so, dass keine Bücher gekauft werden, egal, ob sie gelesen werden oder nicht. Aber es gibt zu viele Leute, die nur lesen, um die Zeit totzuschlagen, zu viele, die nicht um des Lesens willen lesen.
Das klingt, als seien Sie mit dem momentanen Kulturbetrieb nicht sonderlich zufrieden?
Mich stört lediglich der Zustand der gegenwärtigen Feuilletons, das nur noch angepasst berichtet Daher stehe ich der Provinz mit vollem Respekt gegenüber, denn in der Provinz ist die Übersättigung noch nicht derart fortgeschritten wie in den Metropolen. Hier herrscht im Gegensatz zu der schnöden Besserwisserei in den Metropolen vielleicht noch ein Hunger nach Information, auch ein Hunger nach Literatur. Ich rede dabei von einer Literatur, die sich im Wesentlichen an Stil und Sprache orientiert, nicht von Literatur, die sich an dem Niveau von Soap-Operas, wie sie im Fernsehen zu sehen sind, orientiert Wenn Sie sich die Feuilletons der letzten Jahre anschauen und dabei eine Rangliste erstellen, wie oft die einzelnen Genres vertreten sind, was thematisch verhandelt wird, ist es im Wesendichen Theater. Man
fragt, welcher Jungregisseur macht’s diesmal, wer übernimmt die „Schaubühne“, wo inszeniert Luc Bondy, wird Peter Stein den „Faust“ inszenieren, all diese Fragen stehen auf Platz Nummer 1. Auf Nummer 2 steht Musik, stehen die Bayreuther Festspiele, die Salzburger Festspiele oder die Frage: Kann sich Berlin drei Opern leisten? Das sind die Fragen unserer derzeitigen Kulturdebatte.
Wenn wir Glück haben, kommen noch die Rolling Stones und Bob Dylan nach Deutschland, obwohl ich es ja wunderbar finde, dass man noch über Dylan schreibt Und dann kommt noch etwas über Malerei. Das ist die Wirklichkeit der deutschen Kulturdebatte Ende dieses Jahrhunderts. Erst ganz weit hinten und immer seltener können wir über den Gegenstand des Schreibens lesen, über Literatur – und dann leider auch nur, wenn es sich dabei um die sogenannten Stars handelt.
>y An einer Tür ist die Klinke auch nicht in der Mitte“ lautet das „erste Buch“ Ihres Romans ,ßitier von der Straße“. Ist dies einfach nur Ihre Art zu schreiben oder die Suche nach Themen, die nie einen Weg der Mitte beschreiben? Oder sind Sie es stets selbst, der sich mittels neuen – und dabei nie den Weg der Mitte beschreitenden – Themen quasi im Spiegel zeigt?
Um etwas aufzumachen, um etwas zu öffnen, ist der Mittelweg der völlig falsche. Das Wichtige ist, an den Rändern zu suchen. Die Eingänge und Übergänge, die Bedeutungen sind von den Rändern her zu suchen. Für mich hat das Bild der Klinke an einer Tür eine perfekte Stimmigkeit, die für jeden augenscheinlich ist Eigentlich ist das ein Bild, das gar kein Rätsel hat Übrigens ist dieses Bild auch eines, das den sogenannten Underground widerspiegelt Der Underground verstand sich ja als eine Gegenbewegung zum Mainstream. Der Mainstream, der sich sozusagen in der breiten Mitte ergießt, beobachtet von den Medien und gefördert, im Gegensatz zum Underground, der sich an den Rändern befindet, dort eben, wo sich die Außenseiter aufhalten. Um also nicht in dem beamteten Kulturbetrieb unterzugehen oder sich diesem zu unterwerfen, bleibt einem nichts anderes übrig, als nicht den Weg der Mitte zu gehen. Deswegen isoliert man sich auch von der Kultur, die quasi beamtet darüber befindet, was in dieser Republik wertvoll und würdig ist, darüber befindet, wie dieses Land kulturell vertreten wird. Da sind Leute wie ich doch sehr unauffindbar. Ich fühle mich nur von meiner eigenen Kraft gefördert Was ich tue, hat mit dem Kulturverständnis der Feuilletonschreiber so gut wie nichts zu tun. Die Ränder liegen nicht im Blickfeld kultureller Berichterstattung.
Im Laufe der Zeit gingen Ihre Auflagen zurück. Versäumten Sie es, ein neues Publikum zu rekrutieren?
Es ist zwar neues Publikum hinzugekommen, doch das Publikum, das meine Gedichte in den 70etn geradezu verschlungen hat, ist mir nicht gefolgt Aber genau dieses Publikum – so muss man es sagen – waren „Nicht-Leser“. Das Sonderbare daran war, dass das Leute waren, die sonst kaum lasen, aber dennoch zu meinen Gedichten gegriffen haben. Sie haben nicht den Autor wahrgenommen, sondern nur eines seiner Produkte – und sind ihm in seiner Entwicklung nicht gefolgt.
Zurück und abschließend zu der Macht des Wortes und dabei zum Produzenten dieser Macht: Macht sich auch der Schriftsteller mit der Macht des Wortes mächtig?
Nein, es ist das Wort an sich, dem diese Macht vorbehalten ist; der Schriftsteller ist lediglich auf der Suche nach dieser Mächtigkeit der Sprache. Nicht der Schriftsteller ist mächtig – die Sprache ist es. Und der Schriftsteller ist dann erfolgreich, wenn er warten, Sprache beobachten kann, um sie dann zu benutzen, wenn sie einem mächtig erscheint., wenn sie ihre volle Macht entfalten kann.
Was klingt, ab wäre dieser Arbeitsprozess ein arg mühseliger und einsamer?
Wie Sie wissen, vergleiche ich diese Suche nach dem Glück gerne mit dem Training eines Boxers: allein sein, konzentriert sein, aufbauen, handeln mit dem festen Blick auf ein Ziel und im richtigen Augenblick – zuschlagen. Das verbindet den Schriftsteller mit einem Boxer. Ein Wort kann ein Gedicht zum Sieger und Verlierer machen. Ein Wort, das fast beiläufig fallt, kann eine Kettenreaktion von Assoziationen auslösen. Ein Vorgang übrigens, dem keine Logik zu Grunde liegt Ein Vorgang auch, der nicht die Regel ist, sondern eben nur den gerade genannten Glücksmoment wiedergibt Sie schreiben nur einen Satz, Sie lesen nur einen Satz und finden sich plötzlich, von einem Moment zum anderen, mitten in einer Story wie der, in die Sie ohne diesen Satz, ohne dieses Wort nie geraten wären. Es ist einfach faszinierend, wenn man genau daraufwarten kann.
Selbst wenn ich auf meine früheren Sachen zurückblicke, ab mir all dies unbewußt widerfahren ist, kann ich diese Momente erkennen. In diesen Momenten empfinde ich alles andere als Einsamkeit, im Gegenteil, ich möchte sie sogar ganz bewusst allein erleben.
Widerspricht die bei Wondratschek festzustellende Präzision in der Produktion seiner Worte nicht dem Ausschlachten dieser Glücksmomente – und wie kann das gar unbewusst geschehen sein?
Nein, gerade bei meinen frühen Sachen war viel Glück des Anfangers dabei. Heute denke ich noch viel mehr nach und bin ausdauernden Es ist ganz selbstverständlich, dass man nach 30 Jahren Schreiben nicht mehr mit der Naivität des Anfängers an das Schreiben herangeht Man wirft nichts mehr mit der Leichtigkeit der Jugend aus sich heraus, man arbeitet mit einem ganz anderen Bewusstsein, was ein ganz anderes Schreiben zur Folge hat. Heute habe ich im Schreiben andere Interessen, das ist es, was es anders macht Ist es das, was Wondratschek auch mit Künstlern der Pop-Generation verbindet, nämlich das, nicht mehr so sein zu wollen wie zu Beginn der Karriere?
Auch das, schließlich wäre es schlimm, wenn man sich nicht weiterentwickelt oder wenn heute die Rolling Stones noch so klingen würden wie in den 60er Jahren.
Sie gelten als Pop-Poet. Fühlten sie sich in Ihrem Schreiben jemals von Rock- und Pop Musik inspiriert?
In den 70er Jahren ganz ohne ZweifeL Meine Bands waren Grateful Dead, The Velvet Underground, Rolling Stones, Jefferson Atrplaine und natürlich Bob Dylan.
Der ebenso wie Sie einen Wandlungsprozess durchgemacht hat…
Wenn Dylan auftritt, ist es faszinierend zu hören, wie er sich an die kreative Zerstörung seiner eigenen Figur macht Selbst bei bekannten Songs fragte ich mich, was der Mann eigentlich gerade spielt Natürlich spielt er seine Songs innerhalb seiner Musik und sie haben einen Wiedererkennungswert, aber was das Faszinierende dabei ausmacht: Er stellt sich nicht einfach hin und spielt seine Songs herunter, im Gegenteil, plötzlich geht er in den inneren Kosmos seiner Balladen und zelebriert das Destruktive. Das, was er früher straight gespielt hat, präsentiert er heute zerfasert, analog zu Jimi Hendrix, als der die amerikanische Hymne zerriss.
Bob Dylan weiß seinen Destruktionsprozess voranzutreiben, ohne sich selbst dabei zu zerstören und obendrein dabei noch etwas Neues zu produzieren. Ein durch und durch kreativer Prozess, wie er eigentlich auch durch die Moderne definiert wird. Der Begriff der Moderne wird mit der rapture definiert, mit dem Bruch, mit dem Schnitt, nach dem nichts mehr ist, wie es zuvor war. Zu der Zwölftonmusik sagten plötzlich alle Leute: Das ist Destruktion. Man muss der Destruktion das Kriegerische oder die Assoziation zu Bomben nehmen, um in der Zerstörung Kreativität sehen zu können. Destruktion und Zerstörung sind lediglich das Auseinandernehmen des Vorhandenen mit der kreativen Absicht, daraus etwas anderes zu machen.
Burroughs hat es mit „Cut-Up“ vorgemacht, als er die Seiten zerschnitt und sie mit anderen wieder zusammensetzte und gegenüberstellte. Joyce tat es in „Ulysses“, Arno Schmitt hat alles zerbröselt und zerfasert. Marcel Duchamp sagte bereits, dass „Kunst nicht mehr die Gleiche sein kann, wenn plötzlich ein Pissoir an der V&and hängt“.
Das heißt, Dylan macht sich also über eigene Traditionen her, um der Destruktion den Charakter des Zerstörerischen und als Aggressivität Misszuverstehenden zu nehmen. Der Destruktor muss lediglich darauf achten, womöglichen Schaden zu begrenzen. Begrenzung ist in diesem Sinne das Bewusstsein von Kunst Die amerikanische Pop-Generation hatte Burroughs, die deutsche hatte Wondratschek. Sehen Sie sich als eine Ikone der Pop-Generation?
Das ist zwar eine schöne Umschreibung, halte ich allerdings für etwas übertrieben. Es ist zwar sehr schmeichelhaft, wenn Blixa Bargeld von den Einstürzenden Neubauten die Hälfte von „Chuck’s Zimmer“ auswendig kennt und es mir vorträgt, doch macht einen das noch nicht zur Ikone. Nein, es ist lediglich ein schönes Gefühl, wenn auch die nächste Generation etwas mit deiner Lyrik anfangen kann.
In den 70ern interviewten Sie sich einmal selbst. War das aus dem Grund, weil Sie glaubten, dass nur Sie die wirklich intelligenteren Fragen stellen könnten?
Nein, das wäre vermessen, aber das Motiv dieses Interviews war ein anderes, denn die Fragen, die nicht an der Oberfläche bleiben, die etwas behandeln, was vielleicht faul ist die einem selbst vielleicht noch unklar sind, sind Fragen, die auch gestellt werden sollten, weil sie bestimmt keine unwichtigen sind. Das, was der Mensch mit sich verhandelt, wenn er in einem Hotelzimmer für sich alleine ist, wenn er aufhört zu betrügen, das sind die Sachen, die viel interessanter sind, und diese Fragen kann man sich nur selbst stellen.
Wie kommt ein Mensch darauf, ein Buch „Früher begann der Tagmit einer Schußwunde“ zu nennen?
Wenn ich ihnen die wirkliche Geschichte, die hinter diesem Titel steckt, erzähle, sind Sie enttäuscht Dieser Titel ist ja kein Titel, sondern wurde zu einem Titel. Es ist lediglich ein Satz-aus meinem Manuskript für mein erstes Buch, der eher zufällig im Zuge einer Endlektüre ausgewählt wurde, weil uns kein besserer einfiel. „Nur die Sätze zählen“ habe ich damals geschrieben. Ich war ja nie Erzähler, sondern bin als Stilist aufgetreten. Ich habe eine bestimmte Art von Stil produziert, der mir einleuchtete.
Haben sich Ihre Träume verändert?
Nein, ich weiß noch ganz genau, welches Lebensgefühl ich mit 14Jahren hatte, und ich weiß noch, wie viel es mir bedeutet hat, und es bedeutet mir heute noch das Gleiche. Natürlich klang es vor 30 Jahren anders, und es klingt heute wieder anders. Aber der Inhalt meiner Träume hat sich nie geändert Ein Lebensgefühl war immer, dass ich mein Leben allein leben werde. Ja, ich werde mein Leben allein leben.