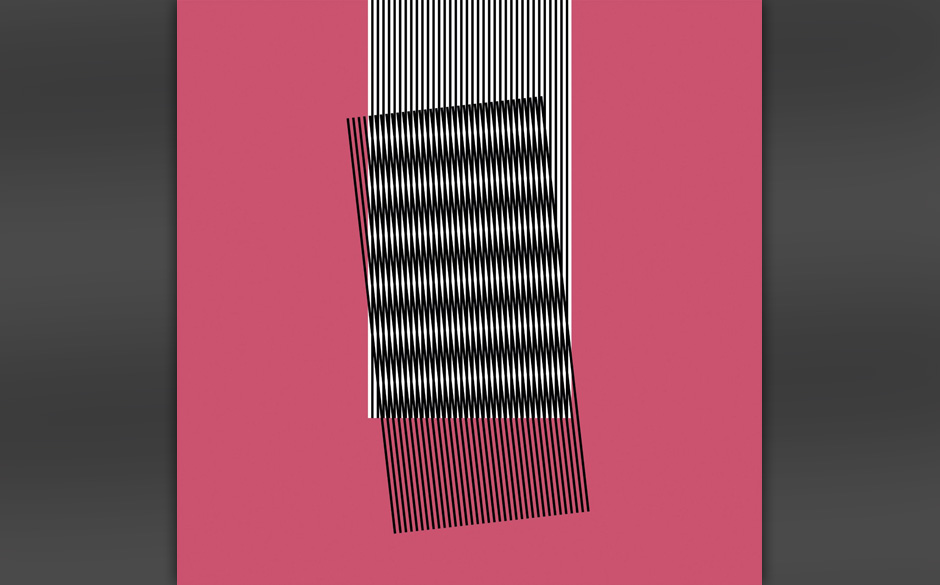Alabama Shakes :: London, Boston Arms
Eben noch im amerikanischen Hinterland, jetzt auf britischen Bühnen: Eine Band entsteht vor den Augen des Publikums.
Am Abend davor war Russell Crowe im Publikum, hinterher hat er acht T-Shirts gekauft. Jeder erzählt einem das am nächsten Tag, bevor die Alabama Shakes das zweite ihrer drei aufeinanderfolgenden London-Konzerte spielen, bis man sich irgendwann fragt: Wenn Crowe schon da war, wo waren eigentlich Johnny Depp oder Agyness Deyn? Haben sie eine gute Entschuldigung?
Dass diese drei Shows innerhalb von Minuten (oder Stunden oder ganz wenigen Tagen) ausverkauft waren, obwohl die Band noch nie zuvor überhaupt außerhalb von Amerika gespielt hat, dass eine Karte für die Alabama Shakes aus Athens, Albama an diesem Donnerstag das definitiv heißeste Ticket der Stadt ist, das hat dagegen keinen Newswert mehr. Schon um Weihnachten herum, als die ersten Listen mit den Musiktipps für 2012 auftauchten (die natürlich self-fulfilling prophecies sind), konnte sich keiner mehr leisten, die Shakes nicht zu kennen. Ihre Herkunft vom Lande, die fehlende Anbindung an irgendeine uns bekannte Szene, die nicht vorhandene Platte, das waren alles Argumente, keine Einwände. Und wer sich grundsätzlich über solche Hypes aufregt, hat nie gemerkt, wie unendlich süß das duftet. Das Blut wird warm, die Spannung steigt. Endlich wieder etwas Greifbares, ein Ereignis. So wie ganz früher.
Das Boston Arms in Tufnell Park, am nordwestlichen Arsch von London, ist tatsächlich ein Pub. In den Nebenraum mit Bühne passen vielleicht 250 Leute – nicht wirklich der Ort für eine derart große Ankunft, aber hier fand bis 2009 immerhin die „Dirty Water Club“-Nacht statt, in der nicht nur die White Stripes, sondern viele andere US-Bands mit Fifties-Sixties-Appeal ihre Europa-Premieren feierten. Den authentischen Backstage-Muff mögen die vier Alabama Shakes aber nicht, deshalb haben sie Räucherstäbchen angezündet. Sängerin Brittany Howard, 23, Jogginghose, Kapuzenpullover, in ihrer Heimatstadt als unerschrockene Postbotin bekannt, erzählt vom Hühnerleber-Parfait, das sie nachmittags probiert hat, wie von einer Mutprobe. Den Job musste sie kürzlich kündigen, zu viele Konzertreisen. Fühlt sich das nach Urlaub an? „Ja“, krächzt sie mit Garagen-Soul-Sprechstimme. „Tagsüber Bier trinken, das haben wir zu Hause nie gemacht.“
Dass die Alabama Shakes ursprünglich eine Tanzkapelle waren, die in Bars Led Zeppelin und AC/DC coverte, dass sie in diese große Sache einfach nur reingerutscht sind, weil die richtigen Leute ihnen rechtzeitig zuhörten, daran muss man sich immer wieder selbst erinnern. Weil Brittany Howard ebenso gut eine optimierte Spezialzüchtung sein könnte, aus Amy Winehouse, Adele und Beth Ditto, übergewichtig und mit schwarzer Haut, das Beste für alle Vorlieben der 2012er-Kundschaft. „Es ist schon komisch“, sagt mit treuen Augen Gitarrist Heath Fogg. „Gestern hatten wir Probleme, daheim Auftritte zu kriegen, heute spielen wir ausverkaufte Gigs jenseits des Ozeans.“ Ist das verstörend? „Nein“, antwortet er. „Aber vielleicht haben wir eine andere Vorstellung von, verstörend‘ als du.“
Das Konzert startet mit „Hang Loose“, einem herrlichen Stück Taugenichts-Gospel-Soul mit einem Stakkato, das die Band nicht hämmert, sondern federnd boxt. Brittany steht im Blumenkleid wie eine Putzfrau da, aber singt wie eine Königin, pardon: eine Queen.
Und schon da merkt man, dass die Alabama Shakes absolut nichts mit Punk zu tun haben. Dass hier nichts transformiert, umgedeutet oder gefleddert, sondern nur praktiziert wird. Elektrische Gebete wie bei Al Green, der beim Engtanz „Boys And Girls“ zu dirigieren scheint, Stürme, mit weit aufgesperrtem Mund, wie bei Janis Joplin in „I Found You“, einem dringender wirkenden Schrei. Nicht einmal die Standards der Rockgesten hat die Band geübt, Gitarrist Fogg und Bassist Zac Cockrell stehen fast still, und wenn Brittany einmal über die Gitarre hinweg mit einer Hand ins erregte Publikum gestikuliert, ist schon verdammt viel los. Bis vor kurzem hat ja auch keiner richtig zugeschaut, in den Bars von Athens.
Heutzutage eine seltene Sache: eine Band, die nicht schon mit einem fertigen Bild von sich selbst daherkommt, die sich noch dabei zu beobachten und zu studieren scheint, wie sie die ersten großen Schritte geht. Als Konzerterlebnis etwas langweilig, als Projekt interessant. Was wird aus ihnen werden? Werden sie die richtige Mission finden? Zum Schluss covern sie „20th Century Boy“ von T. Rex. Es klingt wie dick mit Butter bestrichen.
Ach ja, Jarvis Cocker war im Publikum. Ergriffen. Er hat kein Hemd gekauft.