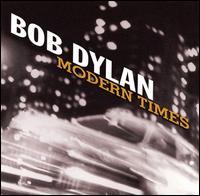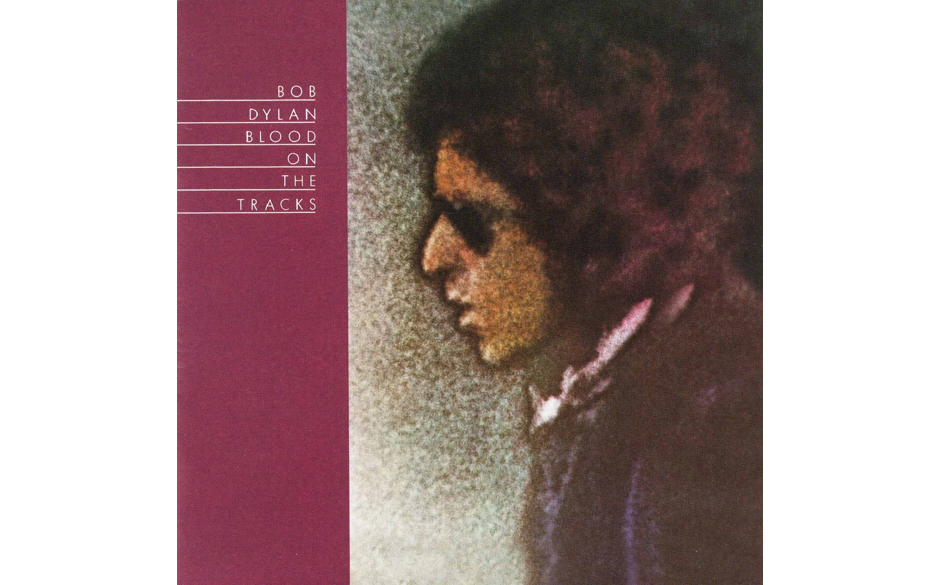Bob Dylan
Modern Times
Smi Col (Sony Music)
Tief im Gestern, nah am Jetzt: der letzte Überlebende einer fernen Zeit
Die Nacht hat sich über die große Stadt gelegt. Ein alter Mann steht am Straßenrand unter einer Laterne und studiert die „Times“, ein Taxi fährt vor dem Museum of Modern Art vor, und ein Tramp steigt aus. Im Radio dudelt Musik aus lang vergangenen Zeiten, als der Weltempfänger noch, wie in Woody Allens Reminiszenz „Radio Days“, der Mittelpunkt jedes Hauses war, als Walter Winchell die Lage der Nation kommentierte und der junge Orson Welles mit seiner H.G.-Wells-Hörspiel-Adaption „War OfT he Worlds“ die Menschen für einen kurzen Moment glauben ließ, das Ende der Welt wäre nahe.
Wir hören nicht etwa die wunderbare Geschichtsstunde „Theme Time Radio Hour“ with your host Bob Dylan, die zur Zeit im US-Satellite-Radio läuft, sondern das neue – Historiker sprechen vom 31. – Studioalbum des Mannes, der von sich sagt, er sei der letzte Überlebende eines fernen Zeitalters, der noch verbleibende Link zum mythischen Amerika, zu all den alten Blues-, Country- und Folksongs, den Geschichten und Legenden, den hobos und tricksers.
„Modern Times“ heißt das lang erwartete Werk. Eine Anspielung auf den kulturpessimistischen Begleittext zu „World Gone Wrong“ vielleicht, in dem Dylan die modernen Zeiten als „the New Dark Ages“ apostrophierte? Oder auf Chaplins Meisterstück, in dem der Tramp, der sich gegen Ende ja auch als Sänger mit sehr eigenwilligem Stil entpuppt, in eine Ungewisse Zukunft entlassen wird? Ted Croners Schwarzweiß-Fotografie „Taxi, New York Night“ auf dem Albumcover deutet zunächst in die Vergangenheit, auch in Bob Dylans eigene. Denn so begann ja alles, als er Anfang der Sechziger in den Kaffeehäusern von Greenwich Village spielte und sich selbst als Tramp – with 110 direction home -inszenierte.
In New York beginnt auch „Modern Times“, genauer gesagt in Hell’s Kitchen, Midtown Manhattan, wo der Prolog „Thunder On The Mountain“ Halt macht. Wohl weil das so nach Sünde und Fegefeuer klingt. Wir erfahren, dass Alicia Keys, die das lasterhafte Gotham in „Streets Of New York (City Life)“ selbst schon in dunklen Farben gelautmalt hat, dort aufgewachsen ist. Dylan entwirft zu federndem Boogie ein apokalyptisches Szenario, ein großes Welttheater: die Verdorbenheit, die Kunst der Liebe, Gott und ein solitärer Kämpfer treten auf.
Die Methode ist die gleiche wie auf den letzten beiden Alben – und wie schon so oft auf vielen großen Dylan-Platten zuvor: Die neuen Stücke entstehen aus dem historischen Zitat, dem Weiter- und Umschreiben überlieferter Songs. Dylan hat Text und Musik dieses Mal nicht zum kargen, unheilvollen Existenzialismus von „Time Out Of Mind“ montiert, auch die lustvolle Dada-Collage „Love And Theft“ diente nicht als Blaupause. In „Modern Times“ hat er mit den Fäden der Vergangenheit eine neue Erzählung gesponnen.
Er glaube nicht den Rabbis und Predigern, er glaube den Songs, hat der Ex-Born-Again-Christ jüdischer Herkunft mal sein religiöses Verhältnis zum American Songbook beschrieben. Die alten Lieder sind auf „Modern Times“ immer gegenwärtig, beschreiben eine Utopie, stehen für einen paradiesischen Ort, von dem der Sänger nach seinem Sündenfall vertrieben wurde. „I want to be with you in paradise/And it seems so unfair/ I can’t go back to paradise no more/ I killed a man back there.“ Nun stolpert er wie der abgehalfterte Star Jack Fate in „Masked & Anonymous“ durch die im Zerfall begriffene Welt. „The buying power of the proletariat’s gone down/ Money’s getting shallow and weak/…/ It’s a new path that we trod/ They say low wages are reality/ If you want to compete abroad“, singt Dylan zu Spieluhr-Piano und Violine im „Workingman’s Blues #2“. Thematisch ist das nah am Joschka-Fischer-Lieblingslied „Union Sundown“, die aufgesetzte Empörung von „Infidels“ ist allerdings einer fidelen Altersweisheit gewichen. Die emporstrebende Melodie, der in lyrischen Lakonismus gekleidete Glaube an bessere Zeiten – neben „Not Dark Yet“ ist dieser Arbeiterblues das beste Stück des späten Dylan.
Trost und Hoffnung in dieser lasterhaften Welt findet der Sänger nur in der Erinnerung und den Verheißungen der bejahrten Songs. „Well, the place that I love best is a sweet memory.“ Er beschwört lieblich in „Spirit On The Water“ eine alte Liebe, in „Nettie Moore“ die entzückende Heldin eines Folksongs, badet den Existenzialismus von „Time Out Of Mind“ im Sentiment von „When The Deal Goes Down“ und setzt dazu die Sinatra-Maske auf, singt Bluesklassiker wie „Rollin’And Tumblin“‚ und „Someday Baby“ und verlängert sie lyrisch in die Gegenwart, flüchtet sich in einem Song mit dem jenseitigen Titel „Beyond The Horizon“ in den Kitsch der Unterhaltungsmusik seiner Jugend. Mit seiner aktuellen Tourband gibt Dylan diesen Liedern einen warmen, von Pedal Steel und Geige verzierten, nostalgischen Sound, der wenig hat vom straighten, robusten „Love And Theft“-Altmännerspaß.
Dylans Gesang war selten klarer, prononcierter, facettenreicher. Es ist die Stimme eines alten Mannes, die nicht – wie auf „Time Out Of Mind“ aus der Echokammer des Mythos erklingt oder die Schlaglöcher des eigenen Lebensweges – wie auf „LoveAndTheft“ – stolz ausstellt. Die Stimme auf „Modern Times“ ist in ihren reichen Schattierungen ebenso mehrdeutig wie der Albumtitel. In,The Levee’s Gonna Break“ etwa oszilliert sie zwischen beschwingt rezitierter Bluesmetapher unddunkler Endzeitstimmung- dazwischen schimmert die Flut von New Orleans.
Am Ende nimmt Dylan die Bewegung des Albums noch einmal auf: in der majestätischen Westernballade „Ain’t Talkin‘, Just Walkin'“, deren Refrain er bei der alten Stanley Brothers-Nummer „Highway Of Regret“ geborgt hat. Der Protagonist wird aus dem „mystic garden“ vertrieben und wandelt als maulfauler, einsamer, gottesfürchtiger Krieger durch die Welt. Er kommt einem vor wie eine Mischung aus dem abgewrackten Helden in Eastwoods „Unforgiven“ und dem Gott suchenden Ritter Antonius Block aus Bergmans „Das siebente Siegel“. „I practise a faith that’s long abandoned/ Ain’t no altars on this long and lonesome road.“ Als der Sänger schließlich in den Garten Eden zurückkehrt, ist der Gärtner verschwunden. „Ain’t talkin‘, just walkin’/Up the road. around the bend/ Heart burnin‘, still yearnin’/ In the last outback, at the world’s end.“
Gott hat uns verlassen, die Welt ist am Ende, im Radio läuft „Modern Times“, und der alte Mann am Straßenrand schaut auf seine antike Taschenuhr – sie hat keine Zeiger mehr.