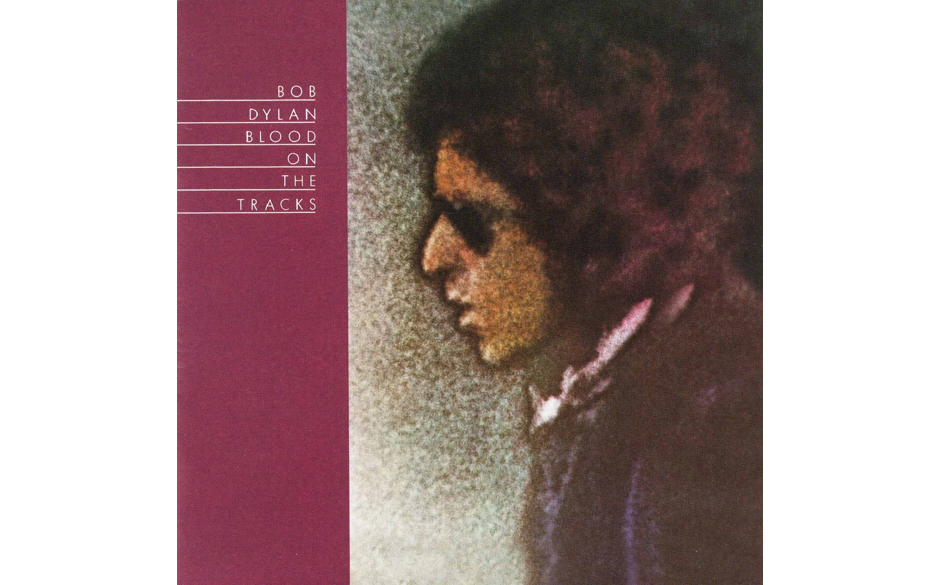Hanne Hukkelberg – Hamburg, Fabrik :: Ohne Kühlschrank gut
Die erste Frage ist natürlich: Sind die Kühlschränke vom letzten Album „Blood From A Stone“ auch dabei? Hanne Hukkelberg hat sich ja nicht zuletzt dadurch einen gewissen Ruf erworben, dass sie Dinge auf Bühnen stellt, die da nicht unbedingt hingehören, und diese irgendwie zum Schwingen und Klingen bringt. Doch nichts von alledem an diesem Sonntagabend im Mai im intimen Rahmen der Fabrik.
Nur ein matt glänzendes PowerBook wird für sparsam ausgewählte Samples noch schnell dezent auf einem Stuhl vorne links platziert, bevor die Norwegerin in mintgrünem Kleid ihre vierköpfige Band auf die Bühne führt. Es ist eine fast konventionelle Besetzung, die Hukkelberg da aktuell um sich schart. Mal abgesehen davon, dass der Schlagzeuger ein eigentümlich kombiniertes Set streichelt und prügelt, das geradewegs von der Resterampe zu kommen scheint. Und dass ein Bass nur in Form eines Gitarristen vertreten ist, der seine sechs Saiten meist wie vier spielt und dabei gelegentlich einen Geigenbogen zu Hilfe nimmt, was dann aber schon das Höchste experimenteller Gefühle darstellt. Na, und dann noch dieser verwegen geschnittene Pony der Keyboarderin, die außerdem die zweite Stimme singt oder bisweilen zur Gitarre greift. Aber sie spielen sich und ihre kleine Frontdame frei aus dem nicht mehr präsenten Kuriositäten-Kabinett. Vor allem wenn Hukkelberg die Musiker mal so richtig von der Leine lässt. Da galoppieren dann plötzlich einsame Wüstenreiter durch unterkühlte Torch-Song-Derivate, da verlieren sie sich entschlossen in nervös synkopierten Ensemble-Ekstasen, die Jazz nicht mal komisch riechen lassen. Und der kleine, handzahme Retro-Wave-Hit „In Here/Out There“ mutiert unerwartet zum donnernden Staccato-Überflieger, der die Fabrik enthusiasmiert, bevor Hukkelberg das Tempo mit „Blood From A Stone“ und dem Pixies-Cover „Break My Body“ noch mal rausnimmt, ohne dabei wesentlich an Intensität einzubüßen.
In der Zugabe schließlich kündigt sie „a very famous song“ an. Was, denkt man, könnte jetzt noch kommen: Madonna? Nirvana? Die Beach Boys? Allein, es ist dann doch nicht so berühmt, sondern bloß Ray Davies‘ ewiggrüner Kinks-Klassiker „All Day And All Of The Night“. Den freilich frisieren sie gekonnt und mit einem Heidenspaß gerade so weit, dass Gralshüter der reinen Lehre leise „Ketzerin“ flüstern könnten. Danach bleibt nur noch ein kleines Gute-Nacht-Lied auf norwegisch. Und dann aber nichts wie ran an den Kühlschrank – hinter der Bühne.