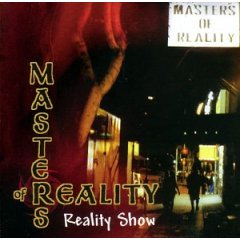MASTERS OF REALITY – HOW HIGH THE MOON :: Malicious Vinyl/Semaphore
Rick Rubins Imperium ist längst vom Zeitgeist überholt. Der Produzenten-Guru, Gründer von Def Jam und Def American, hält sich über Wasser, indem er den alten Recken (AC/DC, Johnny Cash, Donovan) zu neuer Inspiration und gesteigertem Platten-Absatz verhilft. Ende der Achtziger jedoch kaufte man bedenkenlos jede Neuerscheinung, auf der das Def American-Logo prangte, weil man wußte: Was Rubin anfaßt, wird vielleicht nicht gleich zu Gold, läßt sich aber in jedem Fall gut hören. Das war beim ersten Black Crowes-Album so, aber auch 1989 bei einem opulent gestalteten Werk im Klappcover mit einem Gemälde vorn drauf, das an Prog-Rock-Auswüchse wie von Emerson, Lake And Palmer oder Yes erinnerte. Ein Sticker titelte Masters Of Reality, beteiligt war eine fünfköpfige Band aus Syracuse, N.Y., und drinnen dröhnte purer Rock ’n‘ Roll – mythisch, schwer und düster, aber unbelastet vom Quast überkommener Psychedelik – also Blues-Rock auf dem Weg in die Neunziger, später aufgegriffen von Alice In Chains und den Stone Temple Pilots.
Vier Jahre dauerte es, bis ein zweites Album folgte. Von den Original-Masters waren nur Sänger und Gitarrist Chris Goss und sein treuer Bassist Googe geblieben. Als Schlagzeuger bat man Cream-Legende Ginger Baker ins Studio, auf Rubins Hilfe konnte man verzichten. „Sunrise On The Sufferbus“, im schlichten Cover-Weiß ein haarsträubender Gegensatz zum Debüt, blieb dem originalen Sound treu, brachte es jedoch auf den Punkt: Als Trio entfaltete diese Band jene modernen Blues-Roots-Merkmale, die Jon Spencer kurz darauf mit Punk vermischte und Blues Explosion nannte. Dazu sang Goss wirre Phantasien über Ameisen in seiner Küche.
Nach abermals vier Jahren Pause kehren Goss und Goose (ohne Baker, dafür wieder zum Quartett gewachsen) nun mit einem Live-Album zurück, das zehn Songs aus einem Set enthält, den die Band in Johnny Depps Hollywood-Bar Viper Room an zwei Abenden zum besten gab. „How High The Moon“ spannt eine Brücke zwischen ganz alten („The Blue Garden“, „John Brown“), alten („Ants In The Kitchen“) und drei neuen Songs. Chris Goss, inzwischen erfolgreicher Produzent von Kyuss, hat dabei merklich Spaß. Lässig und entspannt wird der gute alte Blues-Rock in fast reinster Form zelebriert, atmosphärisch dicht und so gut abgehangen wie ein T-Bone-Steak. Daß Scott Weiland für die ergreifende Ballade „Jindalee Jindalie“ auf die Bühne springt wie ein Schüler, der seinem Lehrer das Gelernte demonstrieren will, erscheint dabei fast logisch.