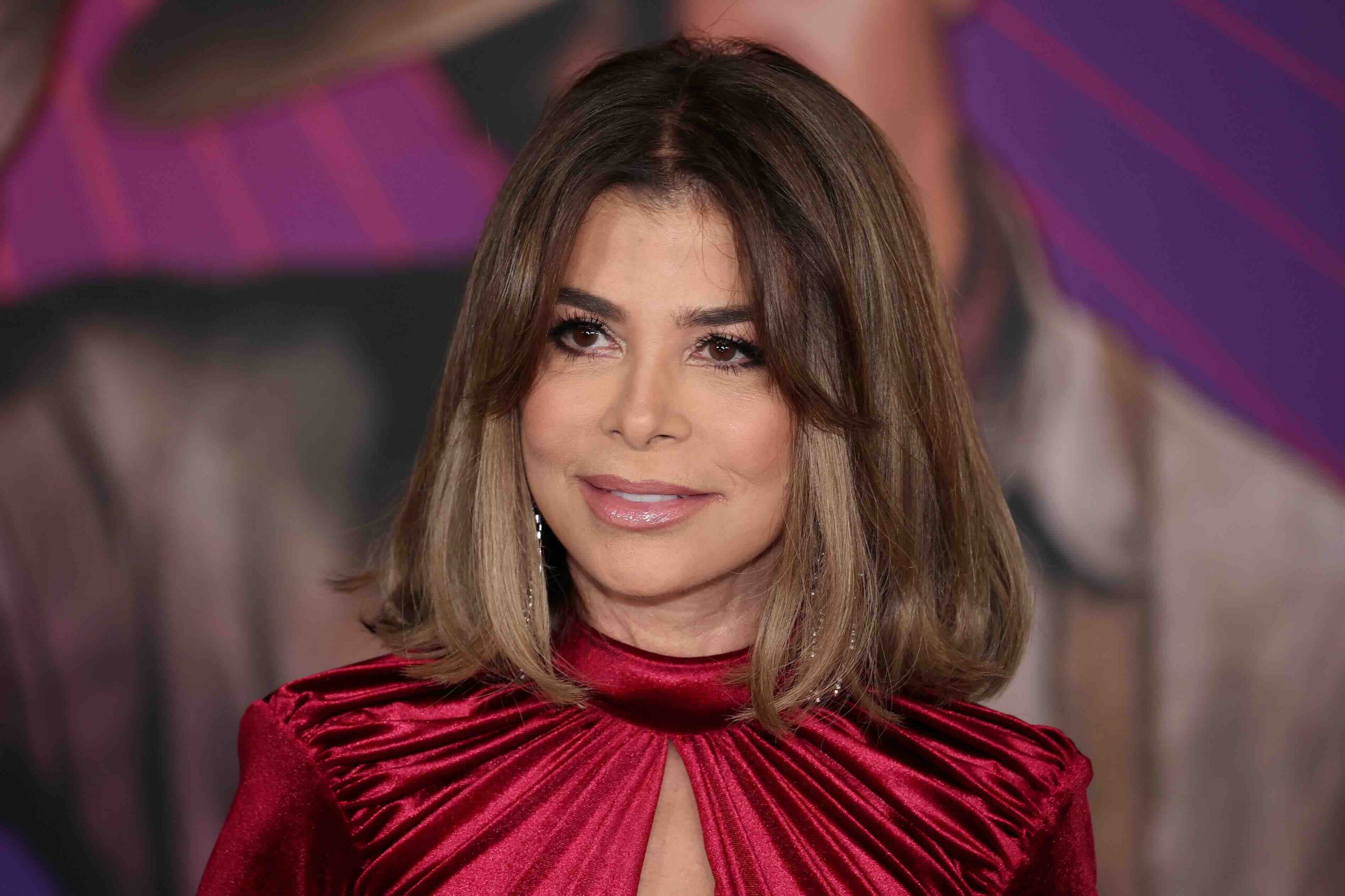VED :: The Bell Laboratory
Alasdair Roberts & Friends
Das schönste, epischste Werk des Folksängers und Songschreibers
Viele Musiker, die man heute mit dem Etikett Folk belegt, sind ja eigentlich das Gegenteil: Innerlichkeitsporno zur akustischen Gitarre, geschrieben, um Frauen ins Bett zu kriegen oder Männer zu vergessen. Alasdair Roberts dagegen ist ein lupenreiner Folksänger. Zudem ist er ein toller Songwriter, der in seinen eigenen Stücken die Tradition fortschreibt. Daher ist es fast egal, ob er nun ein Album mit Neuinterpretationen traditioneller Lieder macht wie zuletzt „Too Long In This Condition“ von 2010 oder das meiste selbst komponiert wie nun wieder auf „A Wonder Working Stone“. Man hört all seinen Platten seine Herkunft und die Überlieferung an, und doch hat jede einen sehr eigenwilligen Charakter.
Das neue Werk, „A Wonder Working Stone“, ist ohne Frage sein bisher schönstes, epischstes. Alle zehn Songs sind weit über fünf Minuten lang, und doch gibt es nicht eine Note sinnlosen Gegniedels, nicht eine Sekunde selbstgefälligen Virtuosentums. Man wird Zeuge eines herrlichen Ensemblespiels, das auch nichts von seiner Intimität verliert, wenn es mal mit Bläsern, Streichern, Flöten und Akkordeon fast orchestral wird. Die Arrangements sind sublim, und die Harmonien klingen nur oberflächlich wie im Pub um die Ecke aufgenommen; bei genauerem Hinhören offenbaren sie ihre Präzision und Komplexität. Ben Reynolds erdet die Stücke mit seinem E-Gitarren-Spiel, das ein bisschen an Emmett Kellys Beiträge zu den Platten von Bonnie „Prince“ Billy erinnert. „A Wonder Working Stone“ ist eine beseelte Feier des Musikantentums, eine heilige Messe des Folk und eines der besten Songwriteralben der vergangenen Jahre. (Drag City/Rough Trade) Maik Brüggemeyer
VED ★★★1/2
Meditativer Krautrock aus Malmö, mit Orient-Einflüssen verziert
Jetzt ziehen sich alle mal nackt aus und begrüßen tanzend den Sonnenaufgang: Die Musik von VED fließt, plinkert, rasselt und groovt wie in einer norddeutschen Hippie-Kommune anno 1972. Busuki-, Gitarren und Zither-Klänge werden getrieben von lasziv schlängelnden Bassläufen und einem minimalistischen Beat. Natürlich ist das irgendwie Krautrock – auch wenn VED aus dem schwedischen Malmö stammen.
Gitarrist Mattias Nihlén startete die heute fünfköpfige Band vor einigen Jahren als Soloprojekt. In den Jams erkennt man noch immer das dem Homerecording geschuldete Zwiebel-Prinzip sich gegenseitig überlagernder Klangschichten. Ein weiterer wichtiger Einfluss – und das stärkste Unterscheidungsmerkmal zum schwergängigeren Krautrock – stammt aus der Nachbarschaft: Der Möllan Distrikt ist ein schwedisches Kreuzberg, ein Durcheinander aus hippen Clubs und Cafés von Einwanderern aus dem Orient. Der Geruch von Mokka und Minze liegt hier ebenso in der Luft wie die Trance induzierenden Rhythmen von Rai und al-Jil. Das Debüt von VED ist deshalb erfüllt von einem Schaukeln und Wippen, zwischen denen sich Saiten-Instrumente und Keyboards in ornamentalen Mustern ausbreiten – und es hat dabei eine meditative Ruhe, die glücklicherweise nur selten langweilig wird. Auch zum Ausdruckstanz sind VED bestens geeignet. (Adrian/Broken Silence) Jürgen Ziemer
Lord Huron
Lonesome Dreams ★★★
Benji Schneider schreibt fern von jeder Ironie gefühlige Songs
In jener lang vergessenen Zeit, in der Simon and Garfunkel sich problemlos im Plattenregal neben den Small Faces platzierten, und zwar durchaus bei Männern zu Hause, wäre einer wie Lord Huron gar nicht aufgefallen. Erst viel später, als Fishmob „Männer können seine Gefühle nicht zeigen“ feststellten, wurde das ironiefreie Songwriting wieder meistens Frauen überlassen. Lord Huron ist zu jung für beides, und darum ist es ihm wumpe.
Nach zwei EPs, die von Indie-Fans, Emos, neuen Männern, alten Frauen und allen anderen Gefühlssicheren gefeiert wurden, hat der in Los Angeles lebende Musiker, der eigentlich Benji Schneider heißt, und sich nach dem See benannt hat, an dem sein Vater immer Wandergitarre spielte (sic!), ein Album aufgenommen. Aus „Lonesome Dreams“ plingelt diese, nun ja, eierlose, aber schöne Musik in ihrer reinsten Form heraus: Echo- statt Fuzzgitarren, Percussion statt Drums, zweite und dritte Stimmen statt Druck, Dur statt Moll, Folk statt Rock, Wiederholung statt Irritation. Ein paar Steeldrums, zwitschernde Vögel, gesampelte Streicher und internationale Sounds bewahren das Ganze erfolgreich vor dem Abdriften ins Belanglose. Und überhaupt, sollte man nicht froh sein, dass jemand so selbstverständlich seine inneren Zustände preisgibt? (PIAS) Jenni Zylka
Aaron Neville
My True Story ★★★
Hemmungslose Nostalgie, unterstützt von Keith Richards
Das menschliche Riff hatte im großen Jubiläumsjahr schon ein paar Termine mit seiner Hausband. Doch als Produzenten-Buddy Don Was anrief, musste er kaum mehr als „Ich mache jetzt ein Doo-Wop-Album mit Aaron Neville“ sagen. So viel Zeit war dann natürlich doch. Wie Keith Richards konnten auch Greg Leisz und Benmont Tench verständlicherweise nicht anders, als einer Stimme, die ja nur der Himmel geschickt haben kann, ganz irdisch zuzuarbeiten.
Die Ironie ist nun, dass diese Stimme auf „My True Story“ nicht ganz so schnell vom Himmel fällt wie sonst, wenn sich Aaron Neville hier in „Money Honey“ hineintastet, den Clyde-McPhatter-Knaller, den 1972 schon Ry Cooder im Repertoire hatte. So wie später selbst Donald Fagen die lässige Vocal-Schmiere von der nächsten Straßenecke auflas, mit dem hier ebenfalls von Neville interpretierten Drifters-Hit „Ruby Baby“.
Der große Sänger sucht jenseits der puren Genre-Seligkeit von „My True Story“ oder „Ting A Ling“ auch nach jenem Punkt, an dem Doo-Wop vor fünf Dekaden seine Unschuld an Soul und Rock’n’Roll verlor, mit Curtis Mayfields „Gypsy Woman“, vor allem mit Hank Ballards Zote „Work With Me Annie“, die aus diesem Mund aber einfach nicht so ordinär klingen will, wie sie sollte. Wobei als einziger echter Fehlgriff aber nur eine schwül runtergedimmte Variante des Spector’schen Ronettes-Monuments „Be My Baby“ durchschlägt, mit einem – ist das ein Blockflöten-Solo? Klingt jedenfalls so.
Natürlich ist das alles hemmungslos nostalgisch, gesungen an einem Ort, an dem nur noch die Erinnerung das Himmelstor zu öffnen mag. Aaron Neville klopft nicht vergeblich, Keef und Co. umspielen mit Gusto. Doch die eigentlichen Stars dieser Show sind vier eher unbekannte Männer, die tatsächlich „Doo-Wop“ und all das andere Background-Zeugs machen. Hätte Keith keinen Termin gefunden – na ja, schade. Ohne die Stimmen von Eugene Pitt, Bobby Jay, Dickie Harmon und Joel Katz aber wäre selbst Aaron Neville auf „My True Story“ ziemlich verloren gewesen. (Blue Note/EMI) Jörg Feyer
Acts ★★
Ein Nebenprojekt alter Grunge-Veteranen – klingt etwas bemüht
Ich stelle mir vor, wie ein paar langhaarige Kerle, alle nicht mehr die Jüngsten, in ihre halb leeren Biergläser starren, während im Hintergrund dieses Album läuft. Das Trio hockt in einer Kneipe, im Hinterzimmer steht ein Billardtisch, und die beiden Fernseher an der Decke zeigen Sport. Es ist trostlos hier, aber die drei Männer am Tresen haben den Kopf voller Erinnerungen. Sie schwärmen von Zeiten, in denen Platten „Ultramega OK“ hießen oder „Superfuzz Bigmuff“, als Grunge noch der heiße Scheiß war und sie selber jung. Mit RNDM kann man hier weniger anfangen: „Das ist das neue Hobby von Jeff Ament, dem Bassisten von Pearl Jam„, knurrt einer. „Ja, ja, schon gehört“, brummelt ein anderer, „der Singer/Songwriter Joseph Arthur ist auch dabei. Und der Schlagzeuger Richard Stuverud, ein alter Kumpel von Ament aus Seattle.“
Schweigend blicken sie wieder auf den Grund ihrer Biergläser, während Songs vorbeiziehen, die „What You Can’t Control“ heißen oder „Walking Through New York“ – und auch so klingen. Oft drängeln sich muskulöse Gitarren in den Vordergrund, „Bretter“ sagten die Jungs früher dazu. Aber es fehlt die wahnwitzige Übersteigerung, die sie damals bei Mudhoney und Soundgarden liebten. Auch beim Gesang spürt man den Nachhall der frühen Neunziger, aber alles, was damals frisch und euphorisch klang, wirkt hier plötzlich bemüht. Schrammel-Gitarre, klagende Mundharmonika, rollender Bass, wirbelndes Schlagzeug – alles da. „Ganz okay“ findet das der älteste von den drei alten Grungern. Trotzdem sind sie unzufrieden.
„Acts“ weckt Erinnerungen an eine Vergangenheit, die 20 Jahre zurückliegt. Doch das Album zeigt weder die Leidenschaftlichkeit, mit der damals der Rock’n’Roll wieder einmal neuerfunden wurde, noch bringt es neue Ideen und gute Songs ins Spiel.
„Noch mal drei Bier, bitte!“ (One Little Indian) Jürgen Ziemer
A.C. Newman
Shut Down The Streets ★★★
Der New-Pornographers-Mann singt Lieder über Geburt und Tod
Als Gründer der New Pornographers hat Allan Carl Newman vor allem süffigen Power-Pop zum Mitsummen, Tanzen und Feiern fabriziert. Solo indes schlägt er leisere Töne an, gibt eher den nachdenklichen Singer/Songwriter als die Rampensau. Geschuldet ist diese sanfte Kehrtwende vor allem zwei einschneidenden Erlebnissen, die er auf seinem neuesten Alleingang, gesanglich unterstützt von Bandkollegin Neko Case, verarbeitet. Zum einen ist da der Tod seiner Mutter, die er im abschließenden, bewegenden Titelsong betrauert; zum anderen widmet er gleich mehrere Stücke der Geburt seines Sohnes Stellan, die seine Sicht auf das Leben merklich verändert hat. „We’ve been waiting for you“, heißt es etwa immer wieder im feierlichen „Strings“, während das von Flötentönen durchzogene „Hostages“ das Glück in Worte zu fassen sucht: „High fives all around we can speed off the surface.“
Gelassen und hoffnungsvoll wirkt Newman auf „Shut Down The Streets“, das von einem leicht psychedelischen Sound der späten 70er-Jahre geprägt ist. Dass nur weniges (wie beispielsweise das energische „Encyclopedia Of Classic Takedowns“) an die Aufgekratztheit und Überschwänglichkeit seines Schaffens mit der Band aus Vancouver erinnert, ist zu verschmerzen. Deren Melodien mögen eine Spur eingängiger und die Hooks unwiderstehlicher sein, aber was Newman hier mit Gitarre, Synthesizer, Banjo, Percussion, Holzbläsern und elektronischen Einsprengseln anstellt, ist gewiss auch nicht von schlechten Eltern. (Fire/Cargo) Alexander Müller
Rick Springfield
Songs For The End Of The World ★★1/2
Nicht schlecht: Der Mainstream-Rockstar weiß, was er tut
In mancher Hinsicht ist Rick Springfield das Sinnbild des US-amerikanischen MOR-Sound der mittleren 80er-Jahre (als die Leute noch wussten, dass MOR „Middle Of The Road“ heißt). Jedenfalls im Rückblick; sucht man nach den Vorbildern von Bands wie Rooney, Orson und in Anteilen sogar Matchbox Twenty, kommt man nicht zuletzt bei Liedern wie „Jessie’s Girl“, „Love Somebody“ oder „Celebrate Youth“ an. Springfield trug damals dick auf, doch es mischte sich auch etwas Integres, Schörkelloses in diese Musik, die viele gute amerikanische Musiktraditionen fortführte.
Seither bespielt der Australier den Classic-Rock-Zirkus der USA und taucht gelegentlich als Schauspieler auf – diese zweite Karriere begann Ende der Siebziger parallel zu der des Musikers mit Auftritten bei „Detektiv Rockford – Anruf genügt“, „General Hospital“ und „Kampfstern Galactica“ (sic!). Zuletzt war er auch in „Californication“ zu sehen – als: Rick Springfield. Vor zwei Jahren erschien zudem eine (ausgesprochen erfolgreiche) Autobiografie.
Das neue Werk bietet den strammen US-Pop-Rock, den man von Springfield kennt. Es wird recht hart gerockt und mit modernem Elan gespielt: Ermüdungserscheinungen sind nicht zu erkennen, obwohl der Mann ja tatsächlich schon die Sechzig überschritten hat. Am Anfang steht das pumpende „Wide Awake“, dessen wilde Drums und Cyberpunk-Gitarren den Liedtitel trefflich illustrieren. Es folgen einige jener Poprock-Melodien, für die man Springfield damals liebte, AOR-Hymnen wie „You And Me“ und eine Art 80s-Groove-Rock, den neben Springfield damals Bands wie Dan Reed Network spielten. Guilty pleasures, but nice ones!
„Songs For The End Of The World“ ist ein erstaunlich frisches, selbstbewusstes und sowohl im Songwriting als auch der Performance und der Produktion souveränes Album. Rick Springfield rettet sich in eine weitere Runde – diese (seine) Welt ist noch nicht am Ende. (Frontiers/Soulfood) Jörn Schlüter
Green Day
¡Dos! ★★★
Unterhaltsam, nicht überraschend: Vollendung der Punkrock-Trilogie
Klingt wie „¡Uno!“ (siehe RS 11/12) – und auch wie „¡Tré!“ (ebenfalls gerade erschienen). (Warner) Birgit Fuss
Junkie XL
Synthesized ★★
Der DJ-Prof macht alles selbst, hat aber wenig originelle Ideen
Tom Holkenborg alias Junkie XL hat seine persönliche Mondlandung bereits erlebt: Er war der Mann, der als Erster Elvis remixen durfte. Nun möchte er sich noch mal, nachdem er zuletzt Videospiele und Filme (u. a. „The Dark Knight Rises“) beschallte, als One-Man-Show inszenieren und spielt auf seinem sechsten Album alle Instrumente wieder selber. Das Singen jedoch überlässt er glücklicherweise anderen. Wenn dann jemand wie Curt Smith (Tears For Fears) ins Spiel kommt, wohnt dem Titel („When Is Enough Not Enough“) sogar mehr Pop-Appeal inne als den Singles von Holkenborgs Big-Beat-Brother Fatboy Slim, dessen „Slash Dot Dash“ hier mit „Twilight Trippin“ seine Fortsetzung findet.
Andere Kooperationen gehen allerdings in die Hose: „Gloria“ mit einem sich auf einer Festzeltbühne wähnenden Fredrik Saroea von Datarock donnert in einer ZZ-Top-mäßigen Endlosschleife über uns hinweg und weist in etwa so viel Street-Credibility auf wie Vanilla Ice oder die Schlümpfe im Technogewand. Darüber hinaus im Alter von 45 Jahren eine Nummer „Kill The Band“ zu nennen, ist schlichtweg albern.
Der Professor (am ArtEZ Conservatorium im niederländischen Arnheim) sollte sich auf seine wenigen Mainstream-Momente besinnen und nicht den Fehler begehen, zu sehr nach den Dancefloors dieser Welt zu schielen. Seine Studenten werden da den heißeren Scheiß kennen. Und Supermax‘ „Lovemachine“ von 1977 kann man einfach nicht mehr verbessern. Schon gar nicht, wenn man auf den berüchtigten „Ah-Huga“-Part verzichtet. (Nettwerk/Soulfood) Frank Lähnemann
Rüdiger Oppermann
The Winding Road ★★★1/2
Der Hendrix der Harfe reist rund um die Welt und in die Elektronik
Er hat „Weltmusik“ schon vor ihrer Einführung als Marktsegment gespielt, und er wird das wohl auch noch tun, wenn sie als Genrebegriff ad acta gelegt sein wird. Oppermann, musikalischer Globetrotter, Initiator des Klangwelten-Festivals und Revoluzzer auf der Harfe resümiert die letzten sieben Jahre seines Schaffens mit einem opulenten Doppelpack und mit über 50 beteiligten Musikern. Er verzahnt im Titelstück türkische Derwischpoesie mit keltischer Bardenharfe, begibt sich hinein in den archaischen Gesang Ungarns, lässt auf dem „Mekong Journey Diary“ die Old-Time-Musik der Appalachen auf laotische Schalmeien treffen. Vor seiner elsässischen Wahlheimat verneigt er sich mit Gnawa-Grooves und chinesischer Zither, armenische Melancholie klagt zu ugandischem Daumenklavier. Ein „Galata Blues“ dient ihm dazu, seinen Ruf als Hendrix der Harfe zu erneuern, während er im „Crystal Forest“ feine Minimalgespinste zwischen Philip Glass und Claude Debussy spinnt.
Und dann ist da noch die unbekannte Seite des Weltmusikpioniers: Seine Kompositionen für Tanztheater und Nouveau Cirque führen aufs elektronische Parkett, das er teils mit dem Hamburger Soundscaper Sven Kacirek beschreitet, das aber auch Berührungspunkte mit dem Klang alter Gambenmusik hat. In der Tat ein „gewundener Pfad“, dessen Biegungen der selbst ernannte „Global Player“ auch dieses Mal ganz ohne Anbiederungen an den Worldpop beschreitet. (Klangwelten/Sunny Moon) Stefan Franzen
Asaf Avidan
Different Pulses ★★★1/2
Ob dezent ambient oder dramatisch: Avidans Gesang ist magisch
Mit dieser Stimme kann man nicht viel falsch machen. Asaf Avidan, dem mit dem Wankelmut-Remix von „One Day/The Reckoning Song“ hierzulande ein relaxter Nummer-eins-Hit gelang, hat seine Begleitband The Mojos und damit auch den Folkrock vorerst ad acta gelegt. Stattdessen stellt der 32-jährige Israeli sein kratzig androgynes Organ nun in den Dienst des Groove. Sein Soloalbum, an dem er gemeinsam mit dem Produzenten Tamir Muskat (Balkan Beat Box) gearbeitet hat, rumpelt und pumpelt wie Wackersteine, mal dezent ambient, mal höchst dramatisch oder leicht folkloristisch.
Während Keyboards, Schlagzeuggeklöppel, eine einsam schmachtende Trompete und elektronische Klänge die Gitarre zumeist in den Hintergrund drängen und gelegentlich eine an TripHop erinnernde, leidsüchtige Atmosphäre schaffen, schnarrt, säuselt, maunzt, gurrt und greint Avidan, als gäbe es kein Morgen. Da er seine Platte mit folgenden Zeilen einläutet, hat er wohl generell kein allzu rosiges Bild der Zukunft: „My life is like a wound/ I scratch so I can bleed.“ Ähnlich niederschmetternd geht es weiter im Text des Titelsongs, in den der Tod seine Wurzeln geschlagen hat. Traurigschön, ergreifend und verstörend ist das, langweilig oder überkandidelt wird es nie. „Different Pulses“ kommt also nicht gerade wie der klassische Chartsbreaker daher, hat dafür aber genügend Tiefgang, Rotzigkeit und Eigensinn, um sich von seelenloser Durchschnittsware deutlich abzuheben. (Universal) Alexander Müller
Elements Of Light ★★★★
Spannend: Glockenspiele treffen auf präzise Elektronik-Sounds
Ding Dong! Der kleine Prinz der elektronischen Konzeptmusik ist wieder da! Für sein neues und viertes Album „Elements Of Light“ hat sich der Hamburger Produzent Hendrik Weber alias Pantha du Prince mit dem norwegischen Komponisten Lars Petter Hagen und sechs Perkussionisten zusammengetan, die unter dem Namen The Bell Laboratory ein gewaltiges Glockenspiel bilden. In seine meist eher ruhig voranschreitenden Dub-Techno-Rhythmen schlagen, klöppeln und dengeln sie mal harmonische Glockentonmelodien, mal forsche Kirchturmuhr-Beats; manchmal kann man auch sekundenlang den Schwingungen und Obertönen lauschen, die ein einzelner Schlag auslöst.
Schon auf seinem herausragenden letzten Album, „Black Noise“ aus dem Jahr 2010, hatte Weber auf allerlei Glocken geschlagen; doch hörte man damals daraus zumeist Gottesdienste und Beerdigungen erklingen: „Black Noise“ war in einer Schweizer Berghütte auf den Überresten eines von einem Erdrutsch verschütteten Dorfes entstanden. Auf „Elements Of Light“ hingegen sind die Glockentöne meist eher säkularer Natur. Die meisten von ihnen stammen von einem Carillon, einer im alten China entwickelten mechanischen Apparatur mit 50 Bronzeglocken. Aber auch Tubular Bells, Klangvasen, Marimbas und Xylofone sind zu hören, wenn Pantha du Prince in seiner fünfteiligen Symphonie mit Titeln wie „Particle“, „Photon“ und „Quantum“ das Wesen des Lichts zu ergründen versucht. Reizvoll ist das vor allem wegen des Kontrasts zwischen den frei ausschwingenden Glockentönen und den präzis konturierten elektronischen Sounds: Streng minimalistische Beats werden mit Klangornamenten geschmückt; Kalkül und musikalischer Zufall treffen aufeinander in spannungsreicher, nicht selten auch erhabener Weise. (Rough Trade) Jens Balzer
Kyla La Grange
Ashes ★★★
Verwunschener Gothic-Pop, der die Lust am Leiden zelebriert
Vielleicht liegt es ja am bösen Ex-Freund. Vielleicht aber auch am Philosophiestudium, das Kyla La Grange in Cambridge abgeschlossen hat. „Ashes“, das Debüt der Songschreiberin aus Watford, vertont jedenfalls das Verlangen und die Furcht vor der Vergänglichkeit, gerät dabei neurotisch, pessimistisch, episch, melodramatisch – und klingt wie ein später Versuch der 26-Jährigen, die teen angst hinter sich zu lassen.
Kyla La Grange empfängt einen bereits schweren Herzens: „Get up get up get up my heart is heavy“, warnt sie im dunkel-beseelten „Walk Through Doors“. Später in der somnambulen Seufzersonate „Woke Up Dead“, die sich in einen hypnotischen Chant steigert, übersetzt sie ihre Verlassensängste in morbide Fantasien: „One fine day when I woke up dead/ She was on your arm and filled your head.“ Und auch sonst hätten Psychoanalytiker ihre Freude daran, die finsteren Musikträume zu deuten, die Kyla La Grande mit ihrer großen, wandelbaren Stimme verrät.
Mit „Ashes“ haust sie in einem Gothic-Pop-Märchenwald – irgendwo zwischen Anna Calvi, Florence & The Machine und Lana Del Rey – und trägt Verzweiflungsnummern vor. Zwar öffnet sich die Musik in viele Richtungen, immer aber schlummert in ihr die Erkenntnis, dass das Herz eine miese Gegend ist. (Sony) Gunther Reinhardt
Everything Everything
Arc ★★★1/2
Ein unberechenbarer und exzentrischer Genre-Mix aus Manchester
Die Arche, mit der uns Everything Everything retten wollen, mutet zunächst wie von Fantasy-Künstler Roger Dean entworfen an. Die Jon-Anderson-Gedächtnisplakette – sie gebührt Jonathan Higgs schon für seinen Falsettgesang. Für Momente fühlt man sich in eine Zeit versetzt, in der zu Art Rock gekifft wurde, der Genesis-Sänger Peter Gabriel hieß und Andersons Band Yes und ihr Hausgrafiker Dean als Maß aller Dinge galten.
Die einlullenden Elemente aber haben die Wahl-Mancunians in den 70er-Jahren gelassen und verbreiten stattdessen eine betriebsame Hektik. Willkommen beim Multi-Mash-up von Supertramp und XTC, Tears For Fears und Passion Pit! Hyperaktiv, unberechenbar und exzentrisch hopsen Everything Everything von Tonart zu Tonart, von Genre zu Genre. Elektro, Prog Rock, R&B, Jazz, Afrobeat, Kammerpop, New Wave – bei Unvollständigkeit bittet der um Atem ringende Rezensent um Nachsicht. Erst hauen einem die vier die HipHop-Beats um die Ohren oder scheinen sich in Mucker-Workouts zu versteigen, dann warten sie plötzlich mit dem einschmeichelndsten aller Refrains auf. Wer Ähnlichkeiten zu UK-Größen wie den Arctic Monkeys und Franz Ferdinand sucht, findet sie bei US-Musikerkollektiven wie Dirty Projectors und Of Montreal. Es dürfte schwierig werden, diese Schlingel zu kopieren. (Sony) Frank Lähnemann
Kendrick Lamar
Good Kid, M.A.A.d City ★★★★
Das HipHop-Album des Jahres kommt direkt aus Compton
Immer wenn man denkt, HipHop reißt auch nichts mehr, wird langsam zum Nischenthema für Nerds, so wie Metal und Minimal Techno, dann biegt mit Sicherheit ein Vogel wie Kendrick Lamar um die Ecke und wirft alles über den Haufen: Das zweite Album des 25-jährigen Rappers verbindet Kunst und Realität mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, wie es das im zurückliegenden Jahr nur selten gegeben hat.
„Good Kid, M.A.A.d City“ beginnt nicht mit Pistolenschüssen, wie man es von einem Rapper aus Compton möglicherweise erwartet – sondern mit einem Gebet. Kendrick Lamar ist ein guter Junge in einer durchgedrehten Stadt, der hier die Geschichte seines Lebens erzählt. Gleich nach dem Gebet – eine O-Ton-Einspielung, von denen es auf dem Album viele gibt – treibt die Geilheit den jungen Kendrick in ein weit entferntes Viertel: „I was in heat like a cactus.“ Leider fehlt hier der Platz, um auf die Detailfreude einzugehen, mit der Lamar eine Welt beschreibt, in der sich Klischee und Realität permanent gegenseitig befruchten. Wo Zärtlichkeit mit fantasievollen, aber markigen Sprüchen umschrieben wird, weil das eben die Sprache ist, die hier gesprochen wird. Überhaupt hat Kendrick Lamar eine Vielzahl von Stimmen, mit denen er sich sehr unterschiedlich artikuliert.
Es eröffnet sich eine Welt zwischen „Halle Berry and Hallelujah“, zwischen dem Profanen und dem Göttlichen, in der kleine Sünder wie Lamar herumstolpern, auf der Suche nach ihrem Platz. In der umwerfenden Gangsta-Rap-Hommage „M.A.A.d City“ taucht dann auch der Veteran MC Eiht auf, bekannt aus dem Film „Menace II Society“ und von der Gruppe Comptons Most Wanted. Das klingt, als würde sich plötzlich der Himmel verdunkeln und die Luft zum Atmen knapp werden, altmodische Breakbeats poppen hoch, Splatterfilm-Melodien erfüllen den Raum und man sieht förmlich, wie dazu die Custom-Made-Cars aus den alten Dr.-Dre-Videos hoppen und boppen. Später, in „Compton“, schaut Dr. Dre tatsächlich noch mal in das Album rein, aber da hat ihm MC Eiht schon längst die Show gestohlen.
Ach, man könnte noch so vieles zu „Good Kid, M.A.A.d City“ schreiben, aber eins ist klar: Es gab 2012 kein besseres HipHop-Album als dieses. Word. (Universal) Jürgen Ziemer
Love & Money
The Devil’s Debt ★★★1/2
James Grant kehrt mit seiner Band zurück – dunkler und edler
Reunion-Konzerte haben manchmal nicht nur auf treue Fans eine euphorisierende Wirkung. Diese Erfahrung machte der Sänger James Grant, als er 2011 mit seiner alten Band Love & Money nach 16 Jahren Bühnenabstinenz auf dem Celtic Connection Festival auftrat und sich die Zuschauer klatschend von ihren Sitzen erhoben, bevor Grant und Co. einen einzigen Ton gespielt hatten. Immerhin haben die Schotten zwischen 1986 und 1993 vier brillante Pop-Alben veröffentlicht, die musikalisch in eine Reihe mit Aztec Camera, ABC und Orange Juice gehören.
„The Devil’s Debt“ ist nun die unverhoffte Studio-Rückkehr. Der Ton ist unverkennbar dunkler, Grants Stimme gereift wie ein edler Single Malt. In „This Is The Last Time“ kommt er der Melancholie eines Roddy Frame nahe, dazu schollert die elektrische Gitarre wie in einem Pulp-Stück. Und im schwärmerischen „Sin Of Pity“ singt Grant fast so bitter-beseelt wie der späte Warren Zevon. Manchmal stört der allzu gepflegte Gestus in den wohligen Songs, doch es ist ein Glück. dass Love & Money die Eleganz jederzeit der Virtuosität vorziehen. (DA/ Vertical) Max Gösche
Walking Papers
Walking Papers ★★★
Songwriter-Neo-Blues/Rock mit prominenten Gästen aus Seattle
Mit Freunden wie diesen brauche man keine Feinde, singt Jeff Angell von Walking Papers am Anfang dieses Albums – er meint wohl nicht seine Mitmusiker. Auf „Walking Papers“ spielen neben Angell (von The Missionary Position) und Schlagzeuger Barrett Martin (früher Screaming Trees) Duff McKagan (früher Guns N‘ Roses) und Mike McCready (Pearl Jam). „Walking Papers“ listet die letztgenannten zwei Musiker nur als Gäste, doch die beiden Rockstars verschaffen der erst 2012 gegründeten Band aus Seattle ordentlich Aufmerksamkeit.
Mit Recht. Angell und Martin kreieren einen schweigsamen, verführerischen Sound aus dunklen Tremologitarren, kantigen Keyboards und reduziertem Schlagzeug – ein konspirativer, hinter vorgehaltener Hand gesungener Songwriter-Neo-Blues, der sich von hinten anschleicht.
Doch die Walking Papers haben eine zweite Seite. Lieder wie „The Whole World’s Watching“ und „Your Secret’s Safe With Me“ sind Blues-Hardrock und Seattle-Grunge, sinnlich und sinister gespielt, immer eher cool als unkontrolliert. QOTSA trifft auf The Doors trifft auf Mark Lanegan trifft auf Joe Henry, so ungefähr. Das dunkle Herz! Es schlägt laut in Angells Brust. (Sunyata/Alive) Jörn Schlüter
I Am Kloot
Let It All In ★★★★
Erhaben: Das Trio aus Manchester umarmt wieder die Dunkelheit
Hallo Dunkelheit, alter Freund. Die Festbeleuchtung ist bald wieder aus, das Feuerwerk verglüht, der Frühling ein vages Versprechen. Und I Am Kloot schenken den Tresenhängern, den Stadt-Desperados und den an Liebe und Leben Verzweifelten wieder mal zehn wunderschöne, schwarzsamtig leuchtende Lieder. Kassandrarufe zur Zukunft, traurige Träumereien und Lovestorys mit blutigen Beinen und verzweifelten Umarmungen. Alles sehr „klootish“, auch weil zum dritten Mal Guy Garvey und Craig Potter von Elbow die Band produzierten.
Gewann aber „Sky At Night“, der Vorgänger von 2010, dem Trio aus Manchester noch mit Xylofon, Cello, Harfe, Sax und breitwandiger Inszenierung viele neue Hörer, richteten Guy und Craig diesmal meist den Stripped-down-Klang der Shows ein und den des kargen Debüts. Stimme, Gitarre, Bass, Drums. Wenn John Bramwell im Eröffnungssong „Bullets“ voller Lakonie „I tell you the tales of glory“ ankündigt, nur begleitet vom sanften „Fever“-Shuffle seiner Akustischen, bevor ein bisschen Jangle, etwas Pochen und Wischen hinzukommen, dann ist die Direktheit mit Händen zu greifen. „Hold Back The Night“, ruft diese durch Mark und Bein gehende Stimme, dann türmt sich das Drama auf, hier flankiert von immer größeren Sounds: „I cannot help but see“ und „we just can keep on running“, gesteht der Sänger, aber Verstecken gilt nicht.
Auch diesmal gibt es Extras, eine einsame Trompete („Some Better Day“), einen tollen Beach-Boys-Chor („Masquerade“) oder die tiefe Verbeugung vor dem Pop-Großarrangeur George Martin und den indischen Experimenten seiner Klienten („The Days Are Mine“). Doch es sind vor allem die Momente der strikten Reduktion und erhabenen Stille, etwa in „Let Them All In“, in denen der Atem stocken möchte. Große Songs, große Band. (PIAS) Rüdiger Knopf
Horace Andy
Broken Beats ★★
Zu viele Dub-Kollegen unterminieren Horace Andys Gesangskunst
Horace Andy muss man einfach lieben. Nicht nur für seine Arbeiten bei Studio One oder Bullwackies, sondern auch für das stimmliche Veredeln einiger Massive-Attack-Songs. Deswegen darf er durchaus auf Nachsicht hoffen – die hier aber Song für Song aufgebraucht wird. Denn gebrochene Beats sind von Haus aus Gift für Horace Andy, der seine besten Momente stets mit kontinuierlichen Riddims hatte, auf denen sein Falsettgesang, der so einzigartig zwischen Romantik und Geisterbahn oszilliert, Dramaturgie und Intensität aufbauen konnte. Eine Riege aktueller Dubkünstler aus England, Deutschland, Österreich und der Schweiz, von Bristols Rob Smith über Trance Vision Stepper aus Hannover bis zu Dub Spencer & Trance Hill und Dubblestandart beamt nun die Sci-Fi-artigen Songs mit allerlei Flirren und Bleeps in den Weltraum, statt erdigem Grund und Boden den Vorzug zu geben.
Selten bilden Musik und Gesang eine Einheit, und es fällt schwer, so etwas wie eine Seele zu erkennen. Das Vocal-Dub-Album ist immer dann gut, wenn die Songs am wenigsten gebrochen sind („She Say“, „Bad Man“). Der Hörer wird nicht umhinkommen, die hier neu eingespielten Klassiker wie „Money Money“, „Cuss Cuss“ und „Skylarking“ mit alten Versionen zu vergleichen, und dabei schneidet diese manisch-depressive Musikmacherei gar nicht gut ab. Aber das liegt nicht an Horace Andy. (Echo Beach/ Indigo) Hans Peters
Kitty Hoff & Forêt-Noire
Argonautenfahrt ★★★1/2
Von diesen deutschen Chansons lässt man sich gern bezirzen
Die Berliner Sängerin Kitty Hoff hat viele schöne Formulierungen. Etwa diese: „Im Grunde ist alles ein uralter Hut/ Wir rütteln am Karma und werden nicht gut.“ Oder diese: „Im Grunde ist alles ein grandioser Schmu/ Wir spielen Theater, und keiner schaut zu/ Der eine spielt Schiller der andere spielt schlecht/ (…) Das ist Gleichgewicht.“ Die Zeilen stammen aus einem schnell gespielten Latin-Swing namens „Gleichgewicht“, mit Jazzgitarre und glockigem Klavier, Kitty singt dazu mit ihrer romantischen Stimme. Man lässt sich gern bezirzen.
Der leise deutsche Chanson ist das Metier von Kitty Hoff, natürlich auch auf „Argonautenfahrt“. Die glückliche Melancholikerin, die amüsierte Poetin, die kluge Träumerin – alles gute Beschreibungen für die Frau aus dem Münsterland. Dass ihre Musik so vollständig und sinnlich und vielseitig ist, hat auch viel mit der Band dahinter zu tun. Bei „Was auch geschieht“ wird eine akustische Gitarre gezupft, das Lied ist eine Art Americana-Swing, „Kugel-die-sich-dreht“ Sixties-Chamber-Pop mit Cembalo, Mellotron und klingelnder E-Gitarre. Das nicht nur im Titel frankophile „En Route De La Vie“ mischt Burt-Bacharach-Bläser ins Arrangement. Und der traumverhangene Blues-Chanson „Dark Friend“ steigert sich in eine wundervoll schwelgende Improvisation aus Klavier, Geigen und Gitarre. Kitty Hoff auf großer Fahrt! (Herzog/Edel) Jörn Schlüter
Alicia Keys
Girl On Fire ★★★
Vom Wunderkind zur Dame: Keys‘ moderate Soul-Modernisierung
Bob Dylan hat einmal über die New Yorker Soulsängerin Alicia Keys gesagt, dass es nichts an ihr geben würde, dass er nicht mag („There’s nothing about that girl I don’t like.“). Und spätestens seit ihrer phänomenalen 2009er-Kooperation mit Rapper Jay Z, „Empire State Of Mind“, schwebt sie engelsgleich über ihren Kolleginnen aus der US-Superstar-Abteilung. Zwar hat Souljazz-Multiinstrumentalistin Norah Jones in etwa genauso viele Platten verkauft und bei Rihanna gibt es mehr Bling-Bling. Doch seit ihrem Debüt „Songs In A Minor“, das sie mit gerade mal 20 einspielte, ist die Keys ziemlich cool geblieben. Und das will etwas heißen in jenem Revier der Unterhaltungsbranche, wo Paparazzi-Fotos, Klatschmeldungen und rote Teppiche wichtiger erscheinen als die Musik.
Alicia Keys ist mittlerweile 31 und hat über fünf Alben bewiesen, dass sie ihr künstlerisches Talent weiterhin zu pflegen versteht. All die belanglosen Interviews mit Promi-Reportern mal außen vor. Dazu kommt, dass sich in der amerikanischen R&B-Szenerie zuletzt massiv Euro-Dance-Klänge von der Stange eingeschlichen haben – David Guetta und Co. sei Dank. Keys versucht all diese Seichtigkeiten auszublenden, wenn sie eine junge Schar von amtlichen Mitstreitern wie Emeli Sandé, Gary Clark Jr. oder Jamie xx (!) versammelt. Der Titelsong oder auch „Brand New Me“ scheinen sich an der Magie des Mega-Erfolges „Empire State“ zu orientieren, was nur zu 73 Prozent gelingt. Überhaupt ist „Girl On Fire“ eher ein gut gemeintes als ein geniales Neo-Soul-Album. Am besten ist sie, wenn sie fast schon minimalistisch am Piano sitzt. Somit bleibt die „neue“ Alicia Keys eine der Großen. Aber auch diese können nicht immer zaubern. (Sony)
Ralf Niemczyk
Wild Billy Childish & The Spartan Dreggs
Dreggredation, Coastal Command, Tablets Of Linear B ★★★★
Gleich drei Alben vom umtriebigen Garagenrock-Multitalent
Die musikalische Karriere von Billy Childish hat vermutlich mindestens ebenso viele Schattierungen wie sein Werk als bildender Künstler. In den vergangenen zehn Jahren machte er Alben mit The Buff Medways, The Chatham Singers, The Musicians Of The British Empire, The Vermin Poets und The Spartan Dreggs. Die personellen Überschneidungen zwischen den Bands sind groß, stilistisch und thematisch gehen sie alle in unterschiedliche Richtungen. Die Vermin Poets und die Spartan Dreggs zum Beispiel sind quasi identisch: Childish am Bass, Wolf Howard am Schlagzeug, Neil Palmer (Ex-Fire-Department) spielt Gitarre und singt, manchmal begleitet von Childishs Frau Nurse Julie. Doch während die Poets eine psychedelische Popband sind, tendieren die Dreggs eher zu humanistischem Garagenrock – humanistisch, weil Palmer von griechischer Mythologie, Geschichte und Literatur singt.
Nun gibt es drei neue Spartan-Dreggs-Alben; zwei kann man kaufen, eines bekommt man, wenn man die Coupons auf den Covern ausschneidet – ein Scherenstich ins Plattensammlerherz – und einschickt. Vermutlich braucht man tatsächlich alle drei, denn schon die uns vorliegenden „Dreggredation“ und „Coastal Command“ (beide mit einer Spielzeit weit unter 30 Minuten) sprühen vor mit schroffen Gitarren und flatterndem Bass gespielten eingängigen 60s-Pop. Zusammen mit dem dritten Album, „Tablets of Linear B“, müssten das mehr große Melodien sein, als selbst Guided By Voices in einem Jahr zustande bringen. (Damaged Goods/Cargo) Maik Brüggemeyer
Dakota Suite
An Almost Silent Life ★★★
Die Kunst des Selbstmitleids: In sich versunkener Slowcore
Ach, welch tiefe Betrübnis. „I know I let you down/ That’s all that I know“, singt Chris Hooson, und um ihn herum scheint die Musik vor Kummer zu erstarren. Eine E-Gitarre ringt sich ein paar Töne ab, Besen schleifen über die Snaredrum, aus der Ferne hallen dürre Harmonien vorüber. „Last Flare From A Desperate Shipwreck“ ist wie die meisten Songs auf „An Almost Silent Life“ eine Zeitlupenstudie des Seelenschmerzes.
Man muss Hoosons Selbstmitleid, die quälende Langsamkeit aushalten können, um diese Platte zu mögen. Und man muss wissen, dass Hooson – der Dakota Suite ist – noch viel trauriger sein kann (nachzuhören auf der Trilogie „The End Of Trying“, „The North Green Down“ und „The Side Of Her Inexhaustible Heart“, die zwischen 2009 und 2012 entstand). Und dass der Mann aus Leeds sein neuestes Werk nun vergleichsweise fröhlich findet.
„An Almost Silent Life“ versammelt hochempfindliche, atmosphärische Slowcore-Nummern – völlig in sich versunkene Lieder, die von der Einsamkeit, vom Selbstzweifel, von Schuld und Sühne erzählen; Meditationen über Songideen, die statt nach einem Ausweg zu suchen, ums eigene Leid, um Melodieskizzen kreisen. Der zur betulich gezupften Akustikgitarre vorgetragene Titelsong „An Almost Silent Life“ vertieft sich letztlich in die gleiche karge Tonfolge wie die Lieder „I Recoiled So Violently I Almost Disappeared“, „Comfortable Lie“, „I Know Your Desolate Places“ oder der lahmende Walzer „I See Your Tears“.
Zu den Klavierakkorden, die Quentin Sirjacq in „If You’ve Never Had To Run Away“ oder „Every Lies“ beisteuert, zu Dakota Darlings Cello in „Don’t Cry“ kommt Hooson einem fast unerträglich nahe. Ein Launebär wird der nicht mehr. In Instrumentalstücken wie dem folkloristischen „Lumen“ oder dem vielschichtigen „Top Rocker“ lässt er allerdings zumindest eine gewisse Distanz zur eigenen Bekümmertheit zu.
Alle Songs versteht Hooson aber als „small hymns to my trusted friend and partner for life, Johanna“ – auch vor allem „Without You“, das mit dem Mantra „Without you, without you, this is how it feels, without you“ eine weitere Anleitung zum Unglücklichsein liefert. (Glitterhouse/Indigo) Gunther Reinhardt