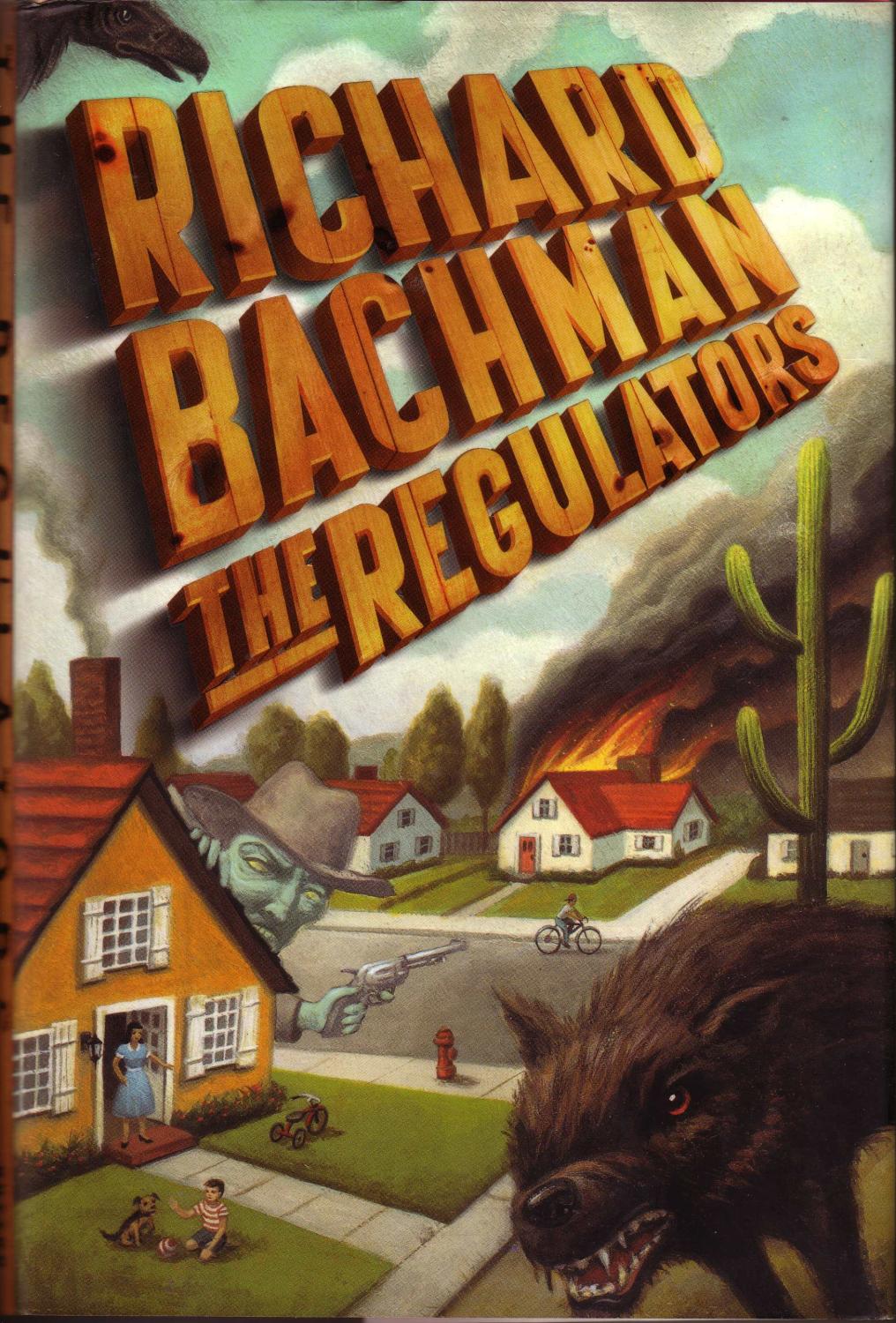Zadie Smith :: London NW
Die Zeiten, in denen man sich von Schriftstellern die Welt erklären lassen möchte, sind vorbei, wie zuletzt der unglaublich eitle Briefwechsel zwischen J. M. Coetzee und Paul Auster zeigte: zwei alte Männer, die den Weltläufen hinterhecheln und sprachliche Nebelkerzen werfen, um das zu verbergen. Gut, bei Zadie Smith verhält es sich ein bisschen anders. Wie die britische Autorin vor 14 Jahren mit gerade mal Mitte 20 in „White Teeth“ (dt. „Zähne Zeigen“) die großen Themen der Zeit im Kleinen verhandelte, anhand dreier Immigranten-Familien ein Tableau der modernen, globalisierten Gesellschaft aufzog, über kulturelle Identitäten und die Gefahren des Fundamentalismus schrieb, das war schon eine Offenbarung. Nachdem sie sich in „The Autograph Man“ zwei Jahre später ziemlich unterhaltsam in postmodernen Verweisen vergaloppiert hatte, nahm sie ihren – um den Kritiker James Wood zu zitieren – „hysterischen Realismus“ zurück, in dem alles mit allem zusammenhängt und alles vorgibt, von Bedeutung zu sein. „On Beauty“ (dt. „Von der Schönheit“) war 2005 ein emphatisches, viktorianisch anmutendes Porträt zweier Familien in der Tradition von E. M. Forsters „Wiedersehen in Howards End“. Smith zeigte hier nicht mehr, wie die Welt funktioniert, sondern wie sie sich für ihre Figuren anfühlt. Aber eigentlich – so schrieb sie drei Jahre später in einem Essay – müsse Literatur beides zugleich leisten: die emotionale Erfahrung beschreiben und die gesellschaftliche Mechanik dahinter.
In ihrem neuen Roman „NW“, der 2012 erschien und jetzt in der deutschen Übersetzung von Tanja Handels als „London NW“ vorliegt, zeigt sie, wie eine solche neue Form des sozialen Realismus aussehen könnte. Dafür geht sie nach Willesden zurück, den sozial schwachen, von Immigranten geprägten Stadtteil im Nordwesten Londons (postalischer Code: „NW“), in dem schon „White Teeth“ spielte.
Der Roman besteht aus drei Teilen, jeder ist einem Protagonisten gewidmet. Alle drei sind in derselben Hochhaussiedlung aufgewachsen und ihr entkommen – allerdings nicht besonders weit; das Viertel haben sie nicht verlassen. Leah Hanwell ist eine irischstämmige, rothaarige Mittdreißigerin, deren berufliche Karriere nach dem Philosophiestudium nicht in Gang kam. Sie arbeitet als einzige Weiße im Büro einer Wohlfahrtsorganisation, ihre Kolleginnen beneiden sie um ihren Mann, Michel, einen ziemlich gut aussehenden schwarzen Friseur, sie liebt aber vor allem ihren Hund Olive. Ihre beste Freundin, Keisha Blake, hat es immerhin bis zur Rechtsanwältin geschafft. Sie hat ihren Namen in Natalie geändert, führt die perfekte Ehe mit zwei Kindern und gibt glamouröse Dinnerpartys – sie scheint ihr eigenes Schicksal in der Hand zu haben (im ihr gewidmeten Teil des Romans wird man allerdings eines Besseren belehrt). Und dann ist da noch Felix Cooper, ein ehemaliger Drogendealer, der versucht, sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen.
Jeden dieser drei Charaktere stellt Smith in einem anderen Stil vor. Die Geschichte der launischen, fahrigen Leah, die sich selbst als Spielball der Zeiten begreift, beginnt als Stream-of-Conciousness, spielt mit Elementen der konkreten Poesie und des Cut-up, stottert und stockt. Felix’ Schicksal erscheint uns als lineare, nahezu naturalistische Narration, und das Leben der rationalen, zielstrebigen Juristin Natalie wird in 185 (mehr oder weniger) kurzen, folgerichtig aufeinander aufbauenden Paragrafen erzählt.
Man lernt durch die verschiedenen Herangehensweisen nicht nur etwas über die mentale Disposition der jeweiligen Figuren, sondern auch über realistisches Erzählen und seine Wirkung. Denn natürlich ist es der im klassischen Stil geschilderte Felix, der einem gleich ans Herz wächst, schon allein, weil in dem ihm gewidmeten Teil der süffige anspielungsreiche Sound früher Smith-Romane am ehesten zu finden ist. Leahs literarisch ambitioniert umgesetzte Geschichte wühlt auf und lässt den Leser aufgekratzt, aber auch ein bisschen unbefriedigt zurück und Natalies kühle Story hinterlässt eine gewisse Leere.
Was die drei Protagonisten, deren Geschichten sich an einigen Punkten berühren und alle eine entscheidende, mehr oder weniger schicksalshafte Wendung durch den Kleinkriminellen Nathan Bogle erfahren, trotz ihrer unterschiedlichen Horizonte und Schicksale in jedem Moment eint, ist ihre soziale Herkunft, der sie nicht entkommen können. Identität ist nicht länger – wie in „White Teeth“ – ein postmodernes Spiel, sondern wird von den gesellschaftlichen Umständen bestimmt. Niemand ist nach dem Ende des britischen Wohlfahrtsstaates noch seines Glückes Schmied oder im existenzialistischen Sinn der Autor seines eigenen Lebens.
Die einzige Freiheit, die Smiths Charaktere haben, liegt darin, auf ihre jeweils eigene Art von ihrer Unfreiheit zu erzählen.