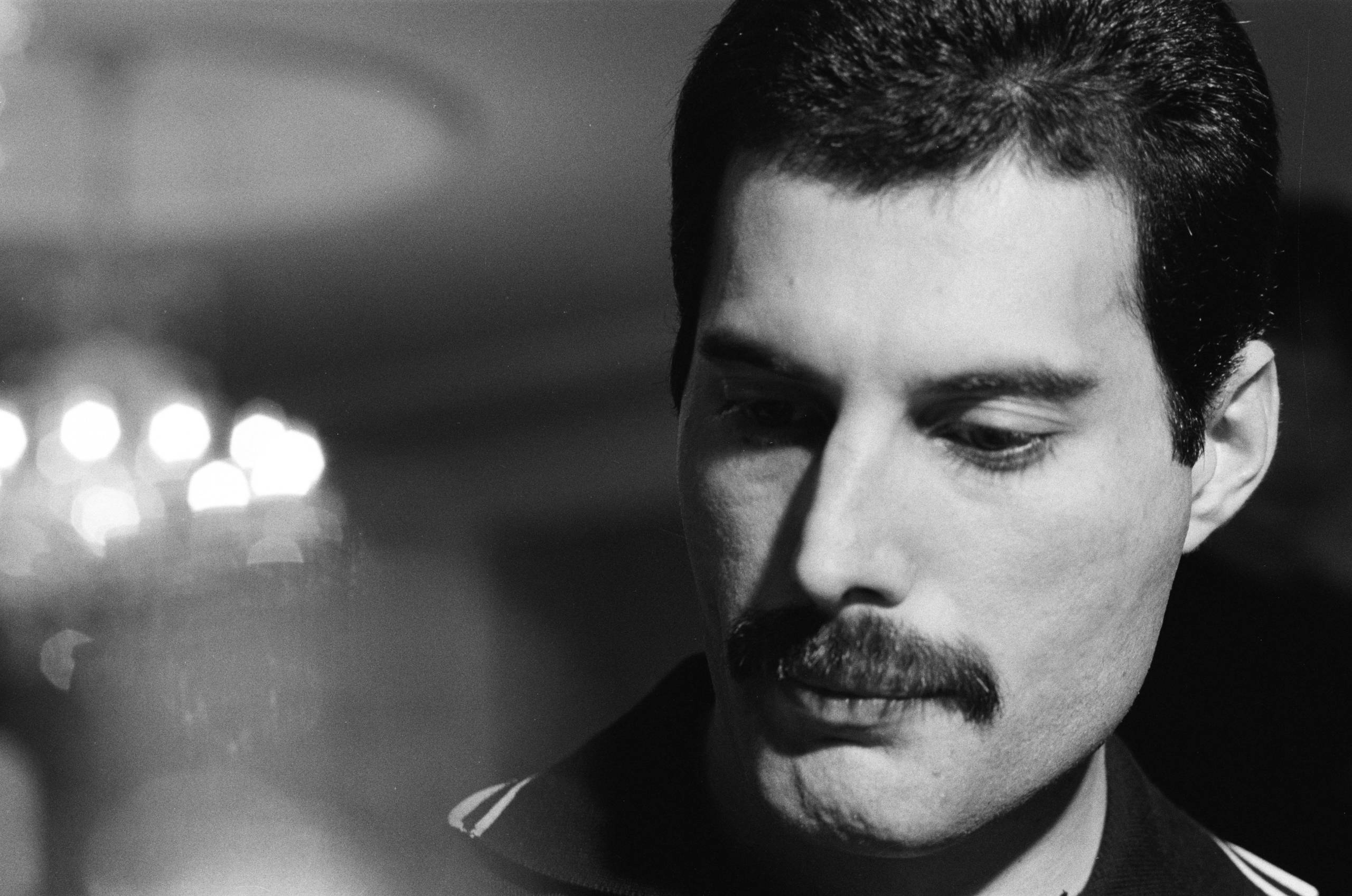25 vergessene & verkannte Meisterwerke
Ob bei Erscheinen ignoriert oder erst später aus dem kollektiven Gedächtnis verbannt, ob nur in Kennerkreisen kanonisiert oder ein Nischendasein fristend: Wolfgang Doebeling rückt auch im 7. und letzten Teil unserer Serie so grandiose wie vernachlässigte Alben aus allen Epochen ins rechte Licht.
Frank Sinatra – In The Wee Small Hours (Capitol 1955)
Man kann diese Apotheose der Einsamkeit und ziellosen Nachtschwärmerei schwerlich als verkannt bezeichnen. Immerhin feierte Sinatra damit Erfolge und wurde von der Kritik auf Händen getragen. Gerade seine Capitol-Alben gelten mit Recht als unwiderlegbare Beweisstücke seiner einzigartigen Phrasierungskunst. Ein kurzes Plädoyer wider das Vergessenwerden scheint indes nicht überflüssig, in Anbetracht sinkender Auflagen jüngerer Reissues. Nicht der historischen Bedeutung der Platte als frühes Konzept-Album, sondern unvergleichlicher Hörerfahrung wegen. Selten waren Nelson Riddles Arrangements subtiler, nie atmosphärischer als auf diesen Balladen der Entsagung und vergeblichen Sinnsuche. Hoagy Carmichaels „I Get Along Without You Very Well“ bewahrt nur der Zusatz in Parenthese davor, purer Selbstbetrug zu sein: „(Except Sometimes)“. Piano, Bass und Schlagzeug geben stoisch Begleitschutz, die Streicher trösten nicht, die Glockenspiel-Anmutung einer Celesta klingt wie Hohn. The Voice brilliert, macht jeden Ton zum Geschenk, flirtet mit Jazz, um Ava Gardner aus dem Kopf zu kriegen. „As he sang“, übertreiben die Liner Notes nicht, „he created the loneliest earlymorning mood in the world.“
Hank Thompson – Songs For Rounders (Capitol 1959)
Western Swing war ursprünglich Tanzmusik für die nach Vergnügung lechzenden Arbeiter in den Oil-Towns von Texas, entsprechend wild und ungezügelt ging es zu, auf der Bühne wie auf den Dielen der Ballrooms. Geboren 1925 in Waco, erlebte Hank Thompson den Boom zwar noch als Youngster, spielte später diesen von Bob Wills geprägten Stil auch mit seiner Band, den Brazos Valley Boys, jedoch auf eigene Weise: weniger rabaukig, weitgehend ohne Soli und näher an der Songtradition des Honky Tonk. Auf „Songs For Rounders“, seiner ersten in Stereo aufgenommenen LP, konvergiert beides, Thompsons Swing-Gefühl und sein Storytelling-Talent, mit Songmaterial, das für Kontroversen sorgte. Nicht weil es darin um Ausschweifungen aller Art ging, um Spieler, Mörder, Betrüger, Säufer, Herumtreiber und anderes Gelichter, nein, der „Cocaine Blues“ brach ein Tabu, nicht tolerierbar.
Hank Mobley – Soul Station (Blue Note 1960)
Jazzbuffs dürften darob die Nase rümpfen, doch ist Hank Mobley außerhalb des Blue-Note-Universums ein eher unbesungener Künstler. Weder wird dem Tenorsaxofonisten aus Georgia allenthalben Genialität bescheinigt wie einem John Coltrane, noch versah er sein Spiel mit der Dringlichkeit eines Sonny Rollins. Mobley pflegte einen melodisch runden Stil, nicht um Einfälle verlegen, aber auch nicht auf den Effekt aus. Vom Blues kommend, diente er etlichen Solisten als Sideman, bevor er als Bandleader zum Zuge kam, nirgendwo beeindruckender als auf „Soul Station“. Wynton Kelly am Piano, Paul Chambers am Bass und Art Blakey am Schlagzeug hinter sich wissend, bläst sich Mobley auf den Tracks dieses Ausnahme-Albums nachdrücklich ins Gemüt, sorgt für Nervenkitzel. Ob in lyrischer Laune, passioniert oder elegant, diese solistischen Finessen begeistern jedesmal aufs Neue.
Lil Hardin Armstrong – Lil Hardin Armstrong And Her Orchestra (Riverside 1961)
Keiner der an diesen Sessions im September 1961 beteiligten Musiker hätte es krumm genommen, wäre ihre Musik seinerzeit als alter Hut bezeichnet worden. An Louis Armstrong mochte die Entwicklung des Jazz vorübergegangen sein, seine Tiraden wider Bebop lassen daran wenig Raum für Zweifel, doch Lil Hardin Armstrong, mit der er in den 20er-Jahren verheiratet war, schätzte die Moderne, insbesondere Thelonious Monk. Weshalb sie, als Riverside-Produzent Chris Albertson mit der verwegenen Trad-Jazz-Idee bei ihr vorstellig wurde, entgeistert fragte:“Who’s going to listen to that old stuff?“ Ein Vorschuss in cash half, Hardins Skepsis zu zerstreuen, und so fand sie sich auf dem Piano-Schemel eines Studios in Chicago wieder, denselben Anschlag praktizierend wie vierzig Jahre zuvor als Mitglied von King Oliver’s Creole Jazz Band. Die Musiker an ihrer Seite waren kaum jünger und hatten einen Mordsspaß dabei, ihre Jugend wieder aufleben zu lassen: fulminant!
Hoyt Axton –Hoyt Axton Explodes! (Vee-Jay 1964)
Vor 15 Jahren starb dieser Grizzly von einem Mann, nach einer vier Dekaden umspannenden Karriere als Sänger und Songwriter, die so memorable Songs wie „Greenback Dollar“ und diverse Hits für Steppenwolf oder Three Dog Night abgeworfen hatte, sowie fast zwei Dutzend sehr hörenswerter LPs. Und doch war manchem Nachrufer der Umstand wichtiger, dass es seine Mutter, Mae Axton, gewesen war, die „Heartbreak Hotel“ geschrieben hatte. „Hoyt Axton Explodes!“ mag nicht das perfekteste Album im Portfolio des lebenslang kreativen Dynamos sein, doch bringt Axton hier sämtliche Musiktraditionen aufs Trefflichste in Einklang, die ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt worden waren: Blues, Country, Folk und Pop. Plus „Heartbreak Hotel“, eher zornig als traurig der Seele entrungen.
The Graham Bond –Organization The Sound Of ’65 (Columbia 1965)
So anregend ihre Verschmelzung von Rhythm & Blues und Modern Jazz auch war, für einen Platz im Rampenlicht der Beat-Szene fehlte den vier Virtuosen neben einem Anflug von Jugendlichkeit vor allem Sex-Appeal. Was nicht weiter auffi el, solange man zu diesem potenten Mix von Platte tanzte, etwa in den Mod-Clubs von London. „They are musicians who are technically brilliant“, heißt es über das notorisch zänkische Quartett auf dem LP-Cover, „they can produce sounds that a few years ago would not have been believed possible by British musicians.“ Wohl wahr, dennoch machte das große Publikum einen Bogen um den „Hoochie Coochie Man“ im Jazz-Mantel, da mochte Graham Bonds Orgel noch so herrlich wummern und Dick Heckstall-Smiths Sax noch so cool rumoren, es half nichts. 1966 ging man getrennte Wege, es blieb beim Sound von ’65.
Junior Wells‘ Chicago Blues Band – Hoodoo Man Blues (Delmark 1965)
Der urbane Blues hatte sich nach 1948 wie sein ländlicher Vetter verbreitet, auf 45rpm mithin. Es wurde durchaus elektrifizierter Blues auf LPs veröffentlicht, doch waren das Compilations von wiederverwertetem Material. Keiner der Altvorderen, weder Muddy Waters noch Howlin‘ Wolf oder Jimmy Reed war je ins Studio gebeten worden, um ein genuines Album im Chicago-Style aufzunehmen, frei von kommerziellen Erwägungen im Hinblick auf den Singles-Markt. Es entbehrt also nicht einer gewissen Ironie, dass es dann ein mit 30 Jahren verhältnismäßig junger Musiker war, dem dieses späte Privileg zuteil wurde. Und das zu einem Zeitpunkt, als Chicago Blues längst nicht mehr den Stellenwert hatte wie noch in den Fifties. Der Harmonika-Beschwörer und Sänger Junior Wells machte das denkbar Beste aus der sich überraschend bietenden Gelegenheit. Gemeinsam mit dem Gitarristen Buddy Guy, dem Bassisten Jack Myers und dem Drummer Billy Warren nahm Wells zwölf spannungsgeladene Tracks auf, die sich mittels Elan, schierer Wucht, einem redlich rauen Klangbild und der No-Nonsense-Geradlinigkeit dieser Songs zu einem veritablen Genre-Klassiker verdichten. Umwerfend.
Lefty Frizzell – The Sad Side Of Love (Columbia 1965)
Nur Hank Williams war als Sänger und Songwriter so bedeutend und stilbildend für die Country Music wie Lefty Frizzell. Doch starb Hank früh, während es Lefty vergönnt war, sogar die Sechziger erfolgreich zu überleben und noch in den Siebzigern auf dem Plattenmarkt mitzumischen. Sein letzter großer Hit war „Saginaw, Michigan“ 1964, dieses letzte herausragende Album erschien im Jahr darauf. Da war Frizzell 37 Jahre alt und in Liebesdingen erfahren genug, um einem Songzyklus über die Schattenseiten von Beziehungen als Interpret autoritativ gerecht werden zu können. Drei Songs steuerte er selbst bei, darunter das selbsterklärende „I Don’t Trust You Anymore“, doch ist der Tenor durchweg bitter, die Grundfarbe dunkelblau. Natürlich geht es ums Verlassenwerden, ums Fremdgehen, um Vergeltung und Verzagen. „How Far Down Can I Go“ grenzt an Selbstaufgabe, Lefty hadert, droht den Halt zu verlieren, Grady Martins Gitarrenton ist fest und beiständig, Pete Drakes Steel sympathisiert weinend mit dem Gedemütigten.
The Marvelettes – Sophisticated Soul (Tamla Motown 1968)
Vorneweg die Hits, zwei Wunderwerke der Soul-Sophistication, auf einer Stufe mit den besten Aufnahmen der Supremes: „My Baby Must Be A Magician“ und „Destination: Anywhere“. The Andantes geben den Chor, The Funk Brothers den Beat, Smokey Robinsons Produktion setzt auf Dramatik und greift tief in die Trickkiste vordergründiger Effekte, besonders auf dem aus seiner Feder stammenden „Magician“. Melvin Franklin von den Temptations führt sprechend ins Geschehen ein, bevor Wanda Rogers ihrem Lover huldigt: „He’s sure got the magic touch“. Der Track nahm in mehrtägigen Sessions Form an, Miracles-Gitarrist Marv Tarplin wurde für einige Licks eingespannt, Robinson probierte dies und das, doch der Aufwand im Studio Hitsville USA lohnte, das Resultat waren zweieinhalb Minuten Perfektion. Kein Wunder also, dass die restlichen, routinierter aufgenommenen Tracks neben „Magician“ und „Destination“ etwas abfallen, doch ist nur ein leichtes Gefälle zu verschmerzen, kein Cut tut weh. Dennoch meinte man, den Fans diesen neuen, elaborierten Sound wortreich verkaufen zu müssen. „The Marvelettes are basically known for singing fast-moving rock numbers“, wird auf dem Cover eingeräumt, dann vollmundig versprochen: „In this album you’ll dig these young ladies in a fresh new perspective.“ Yeah, dig!
The Seldom Scene – Act 1 (Rebel 1972)
Die Geschichte des Bluegrass verlief keineswegs linear, lässt sich jedoch leicht nachverfolgen, von den waghalsig erfinderischen Anfängen eines Bill Monroe bis zu den hocheffektiven Verwaltungsakten seiner heutigen Nachfahren. Zu Beginn der 70er-Jahre hatten sich verschiedene Traditionslinien etabliert, stilprägende Bands wie die Dillards oder Country Gazette waren längst in Richtung Rock abgedriftet, als mit The Seldom Scene eine Formation von sich reden machte, die dieser Versuchung, bei einem größeren Publikum anzudocken, widerstand. Den fünf Musikern, alle Ausnahmekönner an ihren Instrumenten, ging es nicht um Breitenwirkung, sondern um Vertiefung ihrer Musik. „Act 1“ war der erste Schritt auf einem Weg, der in konzertanten, beinahe kammermusikalischen Bluegrass münden sollte, unterwegs Newgrass absorbierend. Noch war der Verlauf dieser Evolution nicht abzusehen, noch bestand die Innovation nur in raffi niert variiertem Satzgesang aus fünf Kehlen und in den Dobro-Kapriolen von Mike Auldridge, doch brauchte man schon einen Begriff für das Stilgefüge. „Contemporary Bluegrass“ war nicht falsch, „Progressive Bluegrass“ nicht richtig, aber naheliegend. Gleichviel, „Act 1“ war aufregend und verheißungsvoll. Nachfolgende Akte mochten beachtliche Meriten haben, ganz bestimmt, an die Intensität dieser Inauguration reichen sie nicht heran.
Joni Mitchell – For The Roses (Asylum 1972)
Merkwürdig, dass Joni Mitchells andere Meisterwerke, namentlich „Blue“, „Court And Spark“ und „Hejira“ oft genannt werden, wenn es um Faves-Listen oder andere Formen geflissentlicher Kanonisierung geht, das dornige „For The Roses“ jedoch so gut wie nie. Dabei hat dieses Album eine Menge zu bieten, nicht zuletzt musikalische Satisfaktion, verborgen in vielschichtigen Arrangements. Lebte „Blue“ stimmlich von Jonis Konzentration aufs Wesentliche, schichtet sie auf „Roses“ Spur auf Spur, lässt ihre Stimme flattern und steil emporsteigen, duelliert sich mit Holzbläsern, riskiert Mimikry von Blechbläsern, scheint sich überhaupt alles zuzutrauen. So sind auch die Songs, voller Anzüglichkeiten und Innuendo, obschon aussagekräftig und mit unmissverständlicher Botschaft: diese Lady hat ihren Bullshit-Detektor auf Höchstleistung getrimmt. Stellvertretend für etliche Highlights sei auf „Cold Blue Steel And Sweet Fire“ verwiesen, ein ungeheuer einnehmender Track, veredelt von James Burtons Gitarre, als Song trotz attraktiver Melodieführung indes eher verstörend: „Red water in the bathroom sink/Fever and the scum brown bowl/Blue steel still begging but it’s indistinct/Someone’s Hi-Fi drumming Jelly Roll.“ Es war gewiss alles andere als leicht, Joni Mitchell zu sein.
Leon Russell – Hank Wilson’s Back, Vol 1. (Shelter 1973)
Gleich Zelig, Woody Allens allgegenwärtigem Zeugen geschichtlicher Geschehnisse, geistert Leon Russell durch die Musikhistorie. Er wirkte als Session-Musiker, Arranger und Fädenzieher bei Studio-Produktionen, seit Beginn der Sechziger. Wer nicht nur Müll im Plattenschrank hat, muss ihn dort beherbergen, womöglich ohne es zu wissen, denn Russells Name taucht mitunter nur in kleingedruckten Credits auf oder gar nicht. Sogar das Cover seiner Solo-LP „Hank Wilson’s Back“ weist ihn bloß als eines von vier Mitgliedern des Production-Teams aus. Ein Verwirrspiel mit dem Zweck, die Eigenständigkeit von Russells Alter Ego heimzuleuchten. In der Haut des fiktiven Country-Stars Hank Wilson, so mutmaßte der ewige Maverick, ließe sich sein Traum besser realisieren, ein Album mit geliebten Songs eines Idioms zu machen, das seinerzeit in unaufgeklärten Rock-Kreisen noch unter Redneck-Verdacht stand. Gedacht, geplant, getan: Russell scharte eine Gruppe exzellenter Musiker um sich, darunter Johnny Gimble, David Briggs und Charlie McCoy, gewöhnte seiner Gesangsstimme das Grummeln ab und stellte sie auf Twang, selektierte geeignete Tunes von Hank Williams, Lester Flatt, George Jones und Leon Payne, der Rest war ein Fest. An dem man noch heute teilnehmen kann, mitsingend und tanzend, als „Truck Drivin‘ Man“ über den „Lost Highway“ bis zum letzten Exit, Leadbellys unsterblicher Abschiedsrhapsodie „Goodnight Irene“.
The Bothy Band – The Bothy Band (Polydor 1975)
Irischer Folk, das schien in den Sechzigern noch gleichbedeutend mit Guinness-induziertem Gegröl in einschlägigen Pubs. Die Dubliners zementierten dieses Zerrbild mit Hits wie „Seven Drunken Nights“, die Chieftains standen mit ihren kultivierteren Tönen lange auf verlorenem Posten. Als Kunstform erlebte Irish Folk erst in den Siebzigern seine Blütezeit, dank Planxty erstens, und zweitens dank der Bothy Band. Nachgeordnet weniger ob musikalischer Minderbedeutung als vielmehr aufgrund zeitlicher Abfolge. Da Donal Lunny die Bothy Band gründete, nachdem er Planxty verlassen hatte, könnte man gar von einem Ableger sprechen, doch waren die beiden Vorzeige-Bands irischer Folk-Herrlichkeit zu verschieden, um sie über einen Leisten zu schlagen. Instrumental, weil etwa Flute, Fiddle und Harpsichord keinen kleinen Unterschied machten. Zudem war die Musik der Bothy Band delikater, filigraner, pastoraler. Und sie hatten mit der Sängerin Triona Ni Dhomhnaill einen Trumpf, ein feminines Moment, das Planxty völlig abging. Ihr musikalisches Material fanden beide Bands freilich im selben Fundus mündlich überlieferter irischer Weisen, seit Urzeiten ansteckend.
Buddy Emmons – Buddy Emmons Sings Bob Wills (Flying Fish 1976)
Er selbst sei überrascht gewesen, dass er diesen Heiligtümern auch stimmlich gerecht werden konnte, gab Buddy Emmons zu, als sich allenthalben anerkennendes Staunen breitmachte über sein Tribut an Bob Wills. Immerhin kannte man ihn bis dahin nur als einfallsreichen Pedal-Steel-Gitarristen, dessen Picking die Platten von Ernest Tubb, Ray Price, Roger Miller und vielen anderen Sangeskünstlern aufgewertet hatte. Tatsächlich gibt es nur wenige Tribut-Alben, die diesem in puncto Stiltreue und Spielfreude das Wasser reichen können. Als Verbeugung vor dem texanischen Volkshelden wollte Emmons seine Versionen verstanden wissen: „It’s his sound and his music, it’s full of spirit and expression. It’s Western Swing! And I love it!“
The Boys – Alternative Chartbusters (NEMS 1978)
„A case of mistaken identity“, so lautete John Peels lapidare Erklärung für den unbegreiflichen Misserfolg einer Band, die in den Wirren von 1977 widersprüchliche Signale aussandte. Ihre frühen Singles waren Punk, da gibt es nichts zu deuteln, „I Don’t Care“ qua wehender Nihilismus-Flagge, „First Time“ als Entjungferungsfanal. Doch gerade als Letztere die Charts hochkletterte, starb Elvis. Für die Band ein Fiasko, weil ihr Vertrieb RCA prompt sämtliche Press- und Promo-Aktivitäten von Produkten einstellte, auf denen nicht der Name des Kings prangte. Als dann noch durchsickerte, dass die Bandmitglieder ein gewisses Faible für die Beatles teilten, war auch die Punk-Credibility dahin. „Alternative Chartbusters“ fiel im Jahr darauf trotz so fabelhafter Tracks wie „Brickfield Nights“ auf taube Ohren, der Boys-Stilmix aus Glam-Beat, Punkpop und juvenilem Rhythm & Blues ließ keinerlei Lagermentalität erkennen, die Meinungsführer der Musikpresse zeigten sich unbeeindruckt.
Television Personalities – And Don’t The Kids Just Love It (Rough Trade 1981)
Dan Treacy plagte sich nicht mit Identitätsproblemen, scherte sich nicht um Punk-Etikette, ließ sich von spontanen Einfällen leiten, die mit nichts und niemandem im Konventionsdschungel des UK-Tribalismus kompatibel waren. Doch Treacy und seine TVPs liebten es, in diesem popkulturellen Dickicht Verstecken zu spielen. Und so ist ihre Musik: ein zitatwütiges Potpourri aus Post-Punk-Aplomb und Lo-Fi-Psychedelia, amateurhaft grob gezimmert, ohne den geringsten Kunstanspruch, überdies gesanglich neben der Tonart, aber geadelt von naivem Charme und britischem Humor. Ihre erste LP schüttet ein Füllhorn wunderbar exzentrischer Songs aus, mit erhebend simplen Melodien und Texten, die zu denken geben: „I went to see a friend to see how she’s been / But when I got there she wasn’t in.“
Squeeze – East Side Story (A&M 1981)
Die Songperlen von Chris Difford und Glenn Tilbrook waren beinahe klassizistisch in ihrer formalen Vollendung, doch waren sie auch gehaltvoll, geistreich, bürsteten die Dinge gegen den Strich. Das Komponisten-Gespann schrieb so konzise wie herzerwärmende Vignetten über das Alltagsleben in Britannien und die Schwächen seiner Bewohner, auf keinem anderen Album so meisterhaft wie auf „East Side Story“. Squeeze standen in einer Tradition, die mit Ray Davies nicht begann und mit Morrissey nicht endet, wussten sich aber auch amerikanischer Signaturen zu bedienen, etwa auf der Booker-T-Melange „Tempted“ oder dem Country-Tearjerker „Labelled With Love“. Beatles-Harmonies klingen ebenso an wie Tamla-Swing, Co-Produzent Elvis Costello assistierte beim Verfugen des prächtigen Pop-Parketts: schiere Klasse.
The Special AKA – In The Studio (2Tone 1984)
Das Ska-Revival hatten sie mit „Gangsters“ eingeläutet, als Speerspitze der Bewegung waren sie gefeiert und von Rassisten angefeindet worden, doch gehörte all das der Vergangenheit an, als die Gruppe um Jerry Dammers ihr letztes Album in Angriff nahm. Es wurde eine düstere Affäre, Dammers war desillusioniert, das Band-Line-up ständiger Fluktuation unterworfen, die kontroverse Single „War Crimes“ hatte es mangels Airplay nicht in die Charts geschafft, und doch gebaren die nervenaufreibenden, von allerlei Unbill begleiteten Sessions ein formidables Album, das von der Intensität des Ausdrucks lebt und von der Unbeugsamkeit, die aus den Songs spricht. Sprachrohr war dieselbe Rhoda Dakar, deren erschütternd realistische Sechs-Minuten-Chronik einer Vergewaltigungtitels „The Boiler“ eben noch medialen Furor losgetreten hatte, doch blieb „In The Studio“ ähnliche Aufmerksamkeit versagt.
Willie Dixon – Ginger Ale Afternoon (Varese Sarabande 1989)
Blues und heitere Poesie begegnen sich selten, doch in diesem Soundtrack zu einem Film von Rafal Zielinski gehen sie eine Liaison ein, die symbiotisch zu nennen ist. Willie Dixon, bei Chess Records in Chicago einst Dreh-und Angelpunkt historischer Sessions, wusste zuerst nicht so recht, was er von dem Angebot halten sollte, die Musik zu einer Beziehungskomödie zu liefern, ließ sich dann aber mit wachsender Faszination auf das Abenteuer ein, komponierte, arrangierte, sang, spielte, produzierte. Er habe viel dabei gelernt, sagte der Veteran, nicht zuletzt über die Universalität des Blues, die sich auch auf die Sprache der Bilder und Dialoge erstrecke: „The Blues are the true facts of life.“
The Renderers – Trail Of Tears (Flying Nun 1991)
Derweil sich andere Flying-Nun-Acts wie The Clean oder The Chills mit ihrem winkligen Punkpop britischer Prägung international einen Namen erspielten, blieben die Renderers außerhalb Neuseelands obskur. Rätselhafterweise, denn ihren Blues-gesteuerten, Americana-orientierten Klängen wohnte ruhige Überzeugungskraft inne, und in Maryrose Crook hatten sie eine Sängerin, die den zumeist nachtschattigen Songs nuanciert mit dunklem Timbre zu Leibe rückte. Es mag kein Alleinstellungsmerkmal sein, dass die linde psychedelischen Soundscapes auch mittels Synth und Slide erzeugt wurden, doch verschafft die unorthodoxe Kombination ein extravagantes, leicht irritierendes Hörerlebnis.
Paul Quinn & The Independent Group – The Phantoms & The Archetypes (Postcard 1992)
In Paul Quinns Stimme liegen Melancholie und Manie dicht beieinander, auf „Phantoms &Archetypes“ gewinnt mal die eine, dann wieder die andere unliebsame Kondition Oberwasser. Man wird an Scott Walkers elegischere Kunstlieder erinnert, auch an Marc Almonds finsterste Melodramen. Für dieses Album hat Alan Horne damals Postcard Records reaktiviert, den Gitarristen James Kirk angeheuert, Quinns alten Schulfreund Edwyn Collins in den Produzentensessel gesetzt und eine Stange Geld für die Studio-Aufnahmen herausgerückt. Eine Entschädigung dafür gab es, allerdings nur künstlerisch. Paul Quinn gibt den Betrogenen, Getriebenen, Verzweifelten, in trostverweigernden eigenen Balladen wie „Punk Rock Hotel“, aber auch in Coverversionen so disparater Songs wie Vern Gosdins „Hangin‘ On“ und „Superstar“ von den Carpenters, salonfähig überführt in die Schattenwelt seines Pop Noir. Verkaufen ließ sich die Platte nicht, Horne zahlte ordentlich drauf und widersetzte sich lange einer Wiederveröffentlichung, weil die Welt das nicht verdiene. Eine Trotzhaltung, die dem schottischen Dickschädel nur zum Vorwurf machen kann, wer nicht um die weiteren kostspieligen Versuche Hornes in den Neunzigern weiß, Paul Quinn zum Durchbruch zu verhelfen. Vergeblich.
XTC – Apple Venus Volume 1 (Cooking Vinyl 1999)
Mehr Beach Boys als Beatles, mehr McCartney als Lennon, mehr Prachtentfaltung als sonst: XTC erfanden sich mit „Apple Venus“ nicht neu, sämtliche Ingredienzien dieser musikalischen Überwältigung waren auf vorangegangenen Werken bereits angelegt, aber was Andy Partridge und Colin Moulding nach siebenjähriger Studio-Abstinenz hier aus dem Ärmel zauberten, war der letzte Schritt zum Gipfel ihrer Kunst. Das Duo – Dave Gregory war inzwischen ausgestiegen und wird in den Credits nur als „additional musician“ geführt – hatte noch akribischer als gewohnt am üppigen Klangbild gefeilt, das sie „orchustic“ nannten, ein Amalgam aus „orchestral“ und „acoustic“. Das Resultat ist Musik von sublimer, jubilierender Englishness, manchmal in gefährlicher Nähe zum Kitsch. Droht freilich die Evokation von „She’s Leaving Home“, retten XTC ihre Kreation mit Pauken und Trompeten vor dem traurigen Schicksal, wie Maccas Nestflüchtling im Sirup zu versinken.
The Duke Spirit – Cuts Across The Land (Loog 2005)
Die Antithese zur Apfel-Venus, nicht weniger englisch, nicht minder imposant, doch musikalisch umgekehrt gepolt. Bevor The Duke Spirit ihrem Rock’n’Roll auf späteren Platten Benehmen beibrachten, war der furios, rücksichtslos, brutal. Liela Moss und ihre marodierenden Mannen fegten daher wie die Reiter der Apokalypse und gaben mit ihrem sinistren, gärenden Lärm auch abgeklärtesten Skeptikern den Glauben zurück, dass in diesem Genre noch Glut schwelt, die nur angefacht werden muss, um wieder aufzulodern. The Rolling Stones und Sonic Youth, so die Band, hätten Pate gestanden für ihr psychotisches Getöse. Moss war heiß, hungrig, hartgesotten, ihr Sirenengeheul auf „Cuts Across The Land“ lässt das Blut in den Adern gefrieren, die Songs attackieren, nehmen gefangen, subversive Melodien lauern darauf, sich unbemerkt in Gehörgängen einzunisten. Loszukriegen sind sie nicht mehr.
Adrian Orange & Her Band – Adrian Orange & Her Band (K 2007)
Adrian Orange ist männlich, ihre Band ein Zwitter. „Let go of the comfortable familiar“, fordert der Künstler, betitelt den Dissidenten-Song indes „Unconvincing Serenade“. So verrätselt, um mehrere Ecken gedacht und dialektisch verknäuelt ist auch die Musik des vielköpfigen Klangkörpers, dessen ruhestörender Psych-Jazz aus konventionellen Instrumenten wie Klarinetten oder Orgeln gespeist wird, aber alles andere als konventionell ist. Der Platte liegt ein Manifest bei, in dem das Ensemble abschreckenderweise als „leaderless, formless, psychedelic, general liberation project“ charakterisiert wird. Da kostet es Überwindung, die LP aufzulegen, doch wird man es nicht bereuen, auch wenn ein paar Spins nötig sein mögen, bis die erste Perplexität weicht und freudiger Erregung über diese organisch mäandernde Unerhörtheit Platz macht.
David S. Ware Quartet – Live In Vilnius (NoBusiness 2009)
Im Frühjahr 2007 löste David S. Ware das Quartett auf, mit dem er 15 Jahre lang gearbeitet hatte, Free-Jazz-Grenzen erweiternd. „What makes music great is that it’s an infinite thing“, tröstete er seine darüber enttäuschten Bewunderer. Es war das vorletzte Konzert dieser letzten Tour, das hier auf Doppel-LP verewigt ist, ein Dokument improvisatorischer Brillanz, ein Monument mitreißender Avant-Kühnheit, bis hin zum ekstatischen Crescendo auf dem finalen „Surrendered“: Ladies and Gentlemen, the DSWQ!