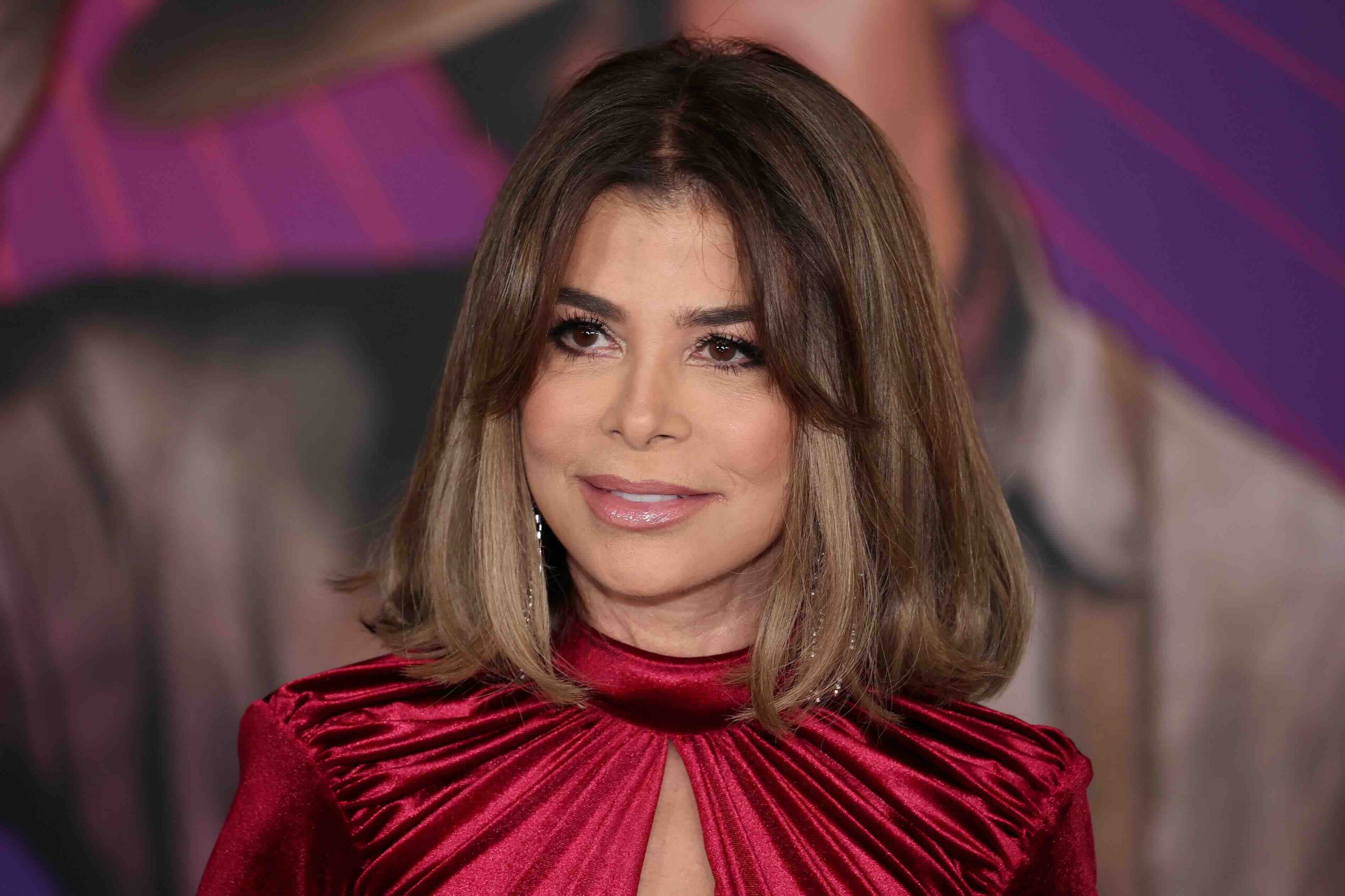Benjamin Clementine: Obdachlos an der Côte d’Azur
Ein Brite in Frankreich: Wie der Einsneunzig-Mann mit Eraserhead-Afro seinen Ton zwischen Pop und Kunstlied fand.
Peng! Ein lauter Ton am Flügel kündigt an, dass Benjamin Clementine im Haus ist. Fast unbemerkt hat er sich auf die tiefe Bühne des Grünen Salons der Berliner Volksbühne geschlichen. Für einen Einsneunzig-Mann mit Eraserhead-Afro, dessen ausladende Wangenknochen ihm auch mal ein kurzes Model-Engagement bei Abercrombie & Fitch eingebracht haben, ist das durchaus bemerkenswert. Fast so ungewöhnlich wie das Wispern, mit dem er sich gelegentlich ans Publikum wendet oder später die ersten Minuten des Interviews fast unhörbar bestreitet. Denn seine Singstimme, zu überprüfen auf seinem Debütalbum, „At Least For Now“, trifft einen nicht nur ganz außergewöhnlichen, sondern auch vollen, ausdrucksstarken Ton, unverwechselbar, bis auf eine ferne Verwandtschaft zur theatralischen Dunkelheit von Nina Simone oder Odetta.
Es geht um alles oder nichts
„Egal wie sehr die Leute schätzen, was man singt und spielt, man ist immer noch ein Niemand. Aber mein Konzert ist eben auch kein Scherz. Es geht um alles oder nichts. Ich kehre zu meinen Wurzeln, meiner Vergangenheit zurück, reiße etwas auf. Das tut weh. Ich haue auf das Klavier, weil die Leute zuhören und mich respektieren sollen. So wie ich das ja auch umgekehrt durch meine Stücke mache.“
Schwer vorstellbar andererseits, dass jemand nicht hinhört. Man kann es kaum anders als charismatisch nennen, wie der 26-Jährige zwischen hellem Bariton und höchster Kopfstimme und mit einer eigenartigen Mischung aus Kunstlied, Broadway, Chanson und Popsong – im Konzert covert er Nick Drake – in expressiven Bildern von Furcht und Unsicherheit und Ablehnung singt und davon, wie man sich behauptet. „Aus dem absoluten Nichts wurde ich, Benjamin, geboren“, singt er in „Condolence“, bevor er Scham und Furcht begräbt. Und in „Adios“ verabschiedet er sich „vom kleinen Kind in mir“ und übernimmt in Stakkato-Intonation die Verantwortung für seine Entscheidung, seine Vision und auch die Lehren, die daraus folgen.
Die Kaspar-Hauser-Geschichte, die seit einem viel gelobten Auftritt bei Jools Holland im vergangenen Jahr verbreitet wird, haut jedoch nur zum Teil hin: Mit 17 zieht Clementine, Sohn ghanaischer Einwanderer, aus der Londoner Sozialsiedlung Edmonton in die Welt hinaus, treibt sich ein wenig herum und nimmt dann einen easyJet nach Paris. Eines obdachlosen Tages legt er den Rucksack vor Sacré-Cœur ab, steigt in die U-Bahn. Und – „genau so war es“ – fängt an zu singen.
Für die strengen, religiösen Eltern habe Musik keine Rolle gespielt. Und wenn die Kinder – er ist das jüngste von fünf – ausnahmsweise mal Michael Jackson oder Antony Hegarty, den er neben Erik Satie und Luciano Pavarotti als prägend erinnert, im Fernsehen sehen durften, war klar: „Das sind nicht wir. Wir werden später ins Büro gehen, als Lehrer oder Anwalt.“ Allerdings kam er durch einen älteren Bruder zum Keyboard. „Er ging in eine coole Kirche, die alle möglichen Instrumente bereitstellte. Ich durfte dort nicht hin und musste in die Kirche meiner Eltern gehen. Sie wollten wohl am Jüngsten beweisen, dass sie gute Eltern waren. Aber ich habe mich zu Hause an sein Klavier gesetzt.“ Auch die Stimme, die man nun hört, ist nicht einfach gewachsen. „Sie ist wirklich keine Gabe“, sagt er, „sondern harte Arbeit und Erfahrung. Sie ist nicht nur eine singende, sondern auch eine sprechende Stimme. Meine Hingabe, manchmal Frustration, brennt sich in den Ausdruck. Natürlich weiß ich, wann ich mich, technisch gesprochen, zurücknehmen oder zulegen muss. Aber der Ausdruck kommt spontan, und mein Hirn weiß, wohin ich mit der Stimme gehen kann und wohin nicht.“
„Ich will mit wenigen Tupfern so viel wie möglich sagen“
Clementine nahm gut fünf Jahre lang die Ochsentour durch Bars, Geburtstagspartys, Hotels. Irgendwann fiel ihm auf, „dass ich kein fremdes Material singen muss. Ich habe Chansons gehört, ich verehre William Blake, ich hatte etwas zu sagen. Ich habe den Leuten meine Songs ins Gesicht gesungen!“ Nachdem er einen Hotelauftritt während des Filmfestivals in Cannes „vor reichen Leuten, die lieber redeten und aßen“, wütend abgebrochen hatte, traf er den Produzenten, mit dem er seine erste EP aufnahm. „Und hier bin ich.“
Man hört seinem Spiel mitunter an, dass die sparsamen oder hämmernd minimalistischen Figuren nicht aus der Musikschule stammen. Aber sie rahmen seinen Gesang höchst effektiv. „Schlichtheit ist ein Teufel. Ich werde nie spielen wie mein Held Erik Satie, ich bin aber ja kein Perfektionist. Aber ich will mit wenigen Tupfern so viel wie möglich sagen. Wir erkennen Musik, die gut für uns ist. Und ich glaube, dass die Leute mir zuhören, weil sie sich zu Hause fühlen, weil ich direkt die menschliche Natur anspreche.“