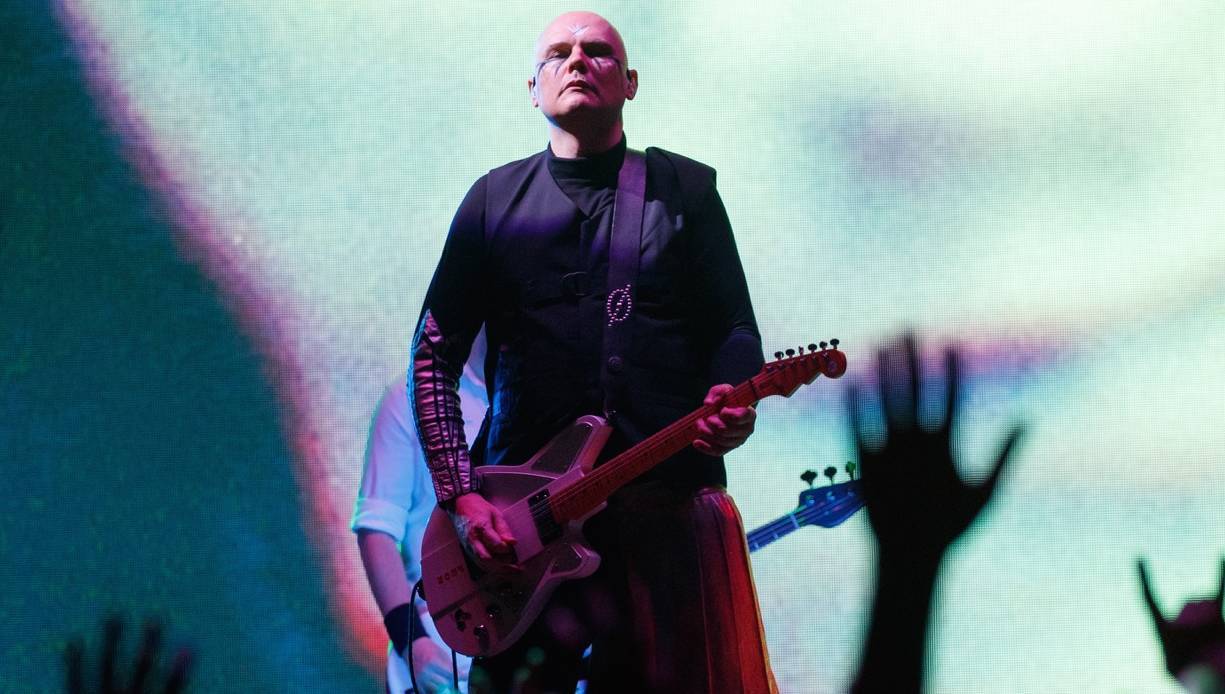Die 40 besten Emo-Alben aller Zeiten
Komm schon, sei traurig: Das Beste vom launischen kleinen Bruder des Punkrock. Die 40 besten Emo-Alben aller Zeiten

Es ist mehr als 30 Jahre her, seit Punkrocks bekennender, tagebuchartiger, offenherziger Ableger „Emo” aus Washington, D.C., auftauchte. Hier sind die besten Alben aus diesem fragilen Genre, in dem Traurigkeit alle so glücklich macht.
40. The Used, „In Love and Death” (2004)
Die Band The Used aus Utah eroberte die Szene mit einem tragischeren, düsteren Emo-Sound, bei dem Sänger Bert McCracken mit rauer Stimme von Selbstzerstörung, Einsamkeit, Selbstmord und Tod schrie. „Take my hand/Take my life” („Nimm meine Hand/Nimm mein Leben”), schreit er aus voller Kehle im Refrain von „Take It Away“. Zwischen den härteren, viszeraleren Songs finden sich ebenso herzzerreißende Powerballaden wie der verletzliche, eingängige Hit „All That I’ve Got“.
Mit ihrer Balance aus Pop und Hardcore haben The Used einen einzigartigen Einstieg in das Genre geschaffen. „Ich denke, alles, was in das Album eingeflossen ist –dDer Verlust zweier Freunde. Spannungen innerhalb der Band und Spannungen mit unserem Produzenten – war größtenteils positiv“, sagte McCracken gegenüber MTV. „Denn all das hat die Songs wie durch Zauberei zusammengebracht.“ B.S.
39. Panic! at the Disco, „A Fever You Can’t Sweat Out“ (2005)
Was hat Pete Wentz da angerichtet? Die grammatikalisch gewagten Panic! at the Disco waren kaum eine Band, als Wentz ihre Demos online entdeckte. Aber innerhalb eines Jahres hatten sie bei seinem Label Decaydance unterschrieben. Und wurden zu Stars, die die Szene spalteten. Mit einer Flut aus wirbelnder Elektronik, orchestralen Klängen und Vaudeville-Camp „A Fever You Can’t Sweat Out“ ist eher The Faint als The Faith. Aber es lässt sich kaum bestreiten, dass es nicht eine Momentaufnahme des „Emo” von 2005 ist, bis hin zu den satzlangen Songtiteln.
Alles, was danach passierte – Bandmitglieder, die die Band verließen, eine Arena-Tour mit einer Zirkuspause (weil sie nicht genug Songs für ein komplettes Set hatten), ein bekifftes, schlafwandlerisches zweites Album – deutet darauf hin, dass Panic! nicht bereit für das Rampenlicht waren. Und obwohl nur noch Gründungsmitglied Brandon Urie übrig geblieben war, bewies dies, dass der genreübergreifende Entwurf, den sie vor einem Jahrzehnt entworfen hatten, wider Erwarten grundsolide war. J.M.
38. Into It. Over It., „Intersections” (2013)
Zu Beginn seiner Karriere als Into It. Over It. war der Chicagoer Troubadour Evan Thomas Weiss vor allem für sein schieres Werkvolumen bekannt. Sein ambitioniertestes Projekt, die Doppel-CD „52 Weeks“ aus dem Jahr 2009, entstand, indem Weiss ein Jahr lang jede Woche einen Song schrieb und aufnahm. Aber diese wilden Jahre ermöglichten es Weiss auch, sich zu entwickeln. Und als er zu „Intersections“ kam, klang er kontrolliert, entspannt und selbstbewusst.
„Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Spaß dabei, ein so trauriges Album aufzunehmen“, sagt er in der Web-Dokumentation zu „Intersections“. Und tatsächlich findet das Album seine Magie in Widersprüchen. Weiss‘ freundliche, spontane Art zu singen ist der Zucker, der die herzzerreißenden Texte von „Intersections“ süß macht, während seine kristallklaren Gitarrenfiguren um das Elend herumtanzen. A.B.
37. Indian Summer, „Science 1994“ (2002)
Diese neun Songs umfassende Studio-Diskografie der kurzlebigen vierköpfigen Band Indian Summer aus Oakland vereint drei 7-Inches und drei Compilation-Beiträge, die ursprünglich zwischen 1993 und 1995 veröffentlicht wurden. Sie besticht vor allem durch ihre markanten Kontraste. Jede Minute der Ruhe wird von einer Lawine der Verwüstung gefolgt.
„Bist du ein Engel?“, flüstert Adam Nanaa, während in der Ferne leise das Knistern einer verwitterten Bessie-Smith-Platte zu hören ist. „Du sagst, du gehst“, singt sie. „Ist das wahr, Engel?“, antwortet Nanaa. Bevor er und Smith in einem dissonanten Strudel aus Gitarren untergehen. Samples aus Smiths Diskografie tauchen immer wieder auf dem Album auf. Und untermalen den kathartischen Swing und Crash von „Woolworm/Angry Son“ bis hin zum ernüchternden Todesmarsch von „Orchard“. Obwohl der raue Punkstil von Indian Summer weit entfernt ist von Bessie Smiths Blues, scheint die Herzensqual universell zu sein. S.E.
36. Orchid, „Gatefold“ (1999)
Nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums im Jahr 1999 wurden Orchid zu einem wichtigen Sprungbrett für die „Screamo“-Bands, die ihnen folgten. Ganz zu schweigen von den zuckersüßen Hybriden, die die Warped Tours terrorisierten. Mit einer Spielzeit von knapp 25 Minuten ist Orchids selbstbetiteltes letztes Album (auch bekannt als „Gatefold“) eine politische Abhandlung in Form von Grindcore.
Sänger Jayson Green flirtet mit postmodernen Gedanken in kreischenden Zeilen wie „Deine wohltätige Objektivität existiert nicht“ und „Ich liebe in der Theorie und befriedige mich in der Praxis“, in denen er sich über linke Intellektuelle lustig macht. Und sich gleichzeitig mit ihnen auseinandersetzt. Mit einem mundreinigenden Ambient-Ausklang hinterlässt Gatefold das Gefühl, einen Bachelor in Kritischer Theorie (mit Nebenfach Marxistischer Dirty Talk) erworben zu haben. S.E.
35. Coheed and Cambria, „Good Apollo, I’m Burning Star IV, Volume One: From Fear Through the Eyes of Madness” (2005)
Während sich Massen von Bands an den Modetrends der Warped Tour und den Hooks von MTV2 festklammerten, schlugen Coheed and Cambria aus New York einen anderen Weg ein. Und hatten damit großen Erfolg. Auf „Good Apollo, I’m Burning Star IV“ gaben sie sich ganz ihren progressiven Rock-Impulsen hin. Ganz zu schweigen von der verworrenen, episodischen Science-Fiction-Erzählung, die sich Frontmann Claudio Sanchez ausgedacht hatte. Er veröffentlichte sogar einen gleichnamigen Begleitcomic. Sanchez schöpfte aus den Tiefen seiner Fantasie, um Inspiration zu finden. Und egal wie tief er auch hinabtauchte, Coheed and Cambria tauchten immer wieder auf. Um direkt in die Magengrube zu zielen. L.G.
34. Owls, „Owls“ (2001)
Owls – alle Mitglieder der Emo-Pioniere Cap’n Jazz aus den Neunzigern außer Gitarrist Davey von Bohlen (der damit beschäftigt war, mit seiner neuen Band The Promise Ring Geschichte zu schreiben)– beschäftigten sich mit fragmentierten Songs. Deren kantige Gitarren, seltsame Taktarten und elliptische Texte an den Indie-Pop von Captain Beefheart and the Magic Band erinnern.
Sänger Tim Kinsella bewies in einem Interview mit „The Quietus“ im Jahr 2014, dass man zwar die Musiker aus dem Emo herausholen kann. Aber nicht den Emo aus den Musikern. „Wenn Leute mit uns über Owls sprechen, konzentrieren sie sich oft auf die Technik und technische Dinge, die für uns alle nicht wirklich interessant sind“, sagte er. „Die Technik stand immer im Dienst des Gefühls.“ A.B.
33. The Jazz June, „The Medicine“ (2000)
Die aus Kutztown, Pennsylvania, stammende Band The Jazz June war ein gefundenes Fressen für Musiktheorie-Fans. Auf ihrem dritten Album „The Medicine“ tobt sich die Band mit sengenden Melodien, schrillen, mathematisch anmutenden Ad-libs und überraschenden Umbrüchen im Takt aus. Die Band schraubt die Verrücktheiten zurück, um in „At the Artist’s Leisure – Pt. 2“ die euphorische Benommenheit zu genießen. Legt dann in „Motörhead’s Roadie“ eine jazzige, sinnliche Kadenz hin. Und krönt dieses Opus mit einem experimentellen 10-minütigen Jam.
Für das Album arbeitete die Band mit Don Zientara und J. Robbins im Inner Ear Studio, das von Dischord frequentiert wird. Und dessen Arbeit Sänger Andrew Low seit seiner Jugend bewundert hatte. „Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich am ersten Tag der Session in einem gewaltigen Schneesturm von Kutztown hergefahren bin“, sagte Low. „Die Straßen waren spiegelglatt. Aber nichts hätte uns davon abhalten können, nach D.C. zu kommen, um dieses Album aufzunehmen. Wir waren so aufgeregt, dass wir dafür gestorben wären.“ S.E.
32. Algernon Cadwallader, „Some Kind of Cadwallader“ (2008)
2008 brach die dritte Welle des Emo zusammen, während der Status des Genres als abwertende Bezeichnung einen Höhepunkt erreichte. Im März desselben Jahres wurde eine Gruppe schwarz gekleideter Emo-Fans in Mexiko-Stadt von einem Mob angegriffen. Algernon Cadwallader ignorierte die Gegenwart des Emo. Und besann sich auf seine Wurzeln. Bassist und Sänger Peter Helmis stellte seine Band in einem Interview 2008 scherzhaft mit den Worten vor: „Wir klingen wie Cap’n Jazz.“ Die Band hatte gemischte Gefühle gegenüber diesem oberflächlichen Vergleich. Aber das Trio aus Philadelphia hätte sich eine schlechtere Referenz aussuchen können.
Algernons rebellischer Akt legte den Grundstein für die aufständische, weitgehend unabhängige vierte Welle des Emo, die sich in die Billboard-Charts einschlich und die Kritiker für sich gewann. Und das wäre nicht passiert, wenn die Gruppe lediglich die nervöse Euphorie von Cap’n Jazz recycelt hätte. Some Kind of Cadwallader besticht durch Algernons verspielte Rhythmusgruppe, Helmis‘ sehnsüchtigen Gesang und den Triple-Lutz-Gitarren des Philly-Punk-Ingenieurs (und späteren Hop Along-Mitglieds) Joe Reinhart. L.G.
31. The Jealous Sound, „Kill Them With Kindness” (2003)
The Jealous Sound haben vielleicht nie denselben Bekanntheitsgrad erreicht wie ihre Kollegen von Sunny Day Real Estate (die The Jealous Sound 2009 auf ihre Reunion-Tour mitnahmen). Aber die Band wurde von anderen Bands ebenso respektiert wie von ihren eigenen Fans. Aus den bittersüßen Trümmern von Knapsack und Sunday’s Best entstanden, verband die Gruppe die palm-gemuteten Rhythmen von Frontmann Blair Shehan mit den glockigen Leads von Pedro Benito. Und das Ergebnis war Pop ohne Pomp. Ein riffgetriebener Sound, der ebenso unvergesslich wie textlich schwer zu fassen war.
„Du könntest wie eine Konstellation brennen. Aber geh nicht, bevor ich weg bin“, singt Shehan in „Naive“. „Die [selbstbetitelte] EP aus dem Jahr 2000 war als Demo gedacht, daher habe ich mich damals gesanglich nicht wirklich ins Zeug gelegt“, sagte Shehan. „Ich hatte gerade Knapsack hinter mir. Und war es leid, mir die Seele aus dem Leib zu schreien. Also habe ich mich bewusst zurückgenommen, als wir die Platte aufgenommen haben. Aber irgendwann hat alles live angefangen zu funktionieren. Und das war genau das, was uns gefallen hat. Und was wir wieder machen wollten.“ J.B.
30. Moss Icon, „Lyburnum Wits End Liberation Fly“ (1994)
Das lautere, schnellere und dissonantere Subgenre „Screamo“ entstand an beiden Küsten. In Kalifornien bildete sich eine kleine, aber vitale Szene um die Indie-Labels Gravity und Ebullition, während an der Ostküste stand die einsame Band Moss Icon aus Maryland ohne Konkurrenz da. Lyburnum Wits End Liberation Fly wurde 1988 aufgenommen. Aber erst 1994 veröffentlicht. Und klingt immer noch seiner Zeit voraus. Die Band mildert ihren rasanten Punk mit Gitarrenkreischen. Und einer Dynamik, die vom britischen Post-Punk und Goth geprägt ist, ohne sich direkt vor diesen zu verneigen.
Textlich setzen sich die Songs mit dem weißen, männlichen, amerikanischen Imperialismus auseinander. „Emo“ in ihrer Intensität. Aber weit entfernt von der Selbstbezogenheit, die ihre Zeitgenossen und Nachfolger prägte. In einem Interview mit „Brooklyn Vegan“ aus dem Jahr 2012 erklärte Gitarrist Tonie Joy: „Unsere Inspiration kam größtenteils aus dem Leben. [Vor allem] aus den beschissenen Aspekten der menschlichen Existenz. Nur sehr wenig Inspiration kam vom Punk/Hardcore. Außer vielleicht die DIY-Einstellung. Wir dachten einfach, wir wären eine Rockband.“ A.B.
29. Brand New, „Your Favorite Weapon“ (2001)
„Your Favorite Weapon“ ist vollgepackt mit allem, was jeder an Emo hasst. Den ausgefeilten Mordfantasien. Dem „-get-the-hell-outta-this-towns. Die Kakophonie weinerlicher junger Männer und ihre übertriebene Verachtung für junge Frauen. Frontmann Jesse Lacey beklagt die Gleichgültigkeit seiner Freundin gegenüber den Smiths („Mixtape“) und ihre autonome Entscheidung, ohne ihn um die Welt zu reisen („Jude Law and a Semester Abroad“). Dennoch haben auch böse Jungs ihren Blues. Und Brand New hat ein Händchen dafür, spritzige Pop-Punk-Hymnen zu schreiben, die die dunkelsten und kindischsten Seiten in uns ansprechen.
Niemand kann das legendäre Liebesdreieck vergessen, aus dem „Seventy Times 7“ hervorging. Ein vernichtender Diss-Track gegen John Nolan von Taking Back Sunday. „Ich habe mehr Rückgrat in Quallen gesehen“, spuckt Lacey. „Ich habe mehr Mut in 11-jährigen Kindern gesehen!“ Die Band hat ihre jugendlichen Theatraliken inzwischen abgelegt. Aber es hat immer noch etwas Liebenswertes, wenn junge Punks gleichzeitig den fiebrigen Rausch von allem und nichts spüren. S.E.
28. Paramore, „Riot!“ (2007)
Hayley Williams & Co. sind zwischen ihrem Mall-Punk-Debüt „All We Know Is Falling“ von 2005 und dem frecheren, kantigeren „Riot!“ schnell erwachsen geworden. Mit diesem Album erkundete die Band straffere Hooks. Und profitierte von einer Spur Bitterkeit, die „Riot!“ zu einem rauen, dunklen, herzzerreißenden Album machte. „Crushcrushcrush“ lässt ein unschuldiges Konzept unheimlich wirken, während „Misery Business“ ein bissiger, gigantischer Crossover-Hit ist, der Paramore nicht nur an die Spitze der Fueled By Ramen-Szene, sondern auch an die Spitze der Rockcharts katapultierte. B.S.
27. Dashboard Confessional, „The Places You Have Come to Fear the Most“ (2001)
Auf dem zweiten Album von Dashboard Confessional gibt es keinen einzigen brachialen Breakdown. Keinen einzigen markerschütternden Schrei. Dennoch packt der täuschend sanftmütige Chris Carrabba mit seinem folkigen, akustischen Ensemble, das eher in ein Café als in ein Punkhaus passt, genug Feuer in seine Songs, um tausend Abercrombie-Läden in Brand zu setzen.
In seinem Durchbruchshit „Screaming Infidelities“ singt er von dem Schmerz, verlassen worden zu sein. Unterstrichen durch die einzelnen Haare seiner Ex-Freundin, die in seinen Sachen hängen geblieben sind. In „Again I Go Unnoticed“ verlässt er die Band. Und spielt auf seiner Akustikgitarre kathartisch den Schmerz heraus, aus dem Leben verdrängt worden zu sein. Damit schuf er einen Präzedenzfall für andere einsame Gitarrenhelden, die sich in ihrem Schlafzimmer zu Hause fühlen. Und im kommerziellen Radio zu Hause sind. S.E.
26. Rainer Maria, „Look Now Look Again“ (1999)
Rainer Maria, ein oft übersehener Klassiker der zweiten Emo-Welle, bringt eine weibliche Perspektive in ein Genre, in dem diese immer schmerzlich vermisst wurde. Songs wie „Feeling Neglected?” und „Breakfast of Champions” geben den gesichtslosen Bösewichtinnen der Emo-Songs der Vergangenheit eine Stimme. Bassistin Caithlin De Marrais und Gitarristin Kaia Fischer harmonisieren ihre unzähligen Beschwerden, während Schlagzeuger William Kuehn raffinierte, spiralförmige Rhythmen schlägt.
Am erschütterndsten sind De Marrais‘ Eingeständnisse in „Broken Radio”. Wo ihre Stimme vor Wut zittert. „Ich bin mir sicher, wenn ich gegen diese Bäume fahre, wird das weniger Chaos anrichten, als du aus mir gemacht hast.” Vielleicht spricht der Mangel an Frauen im Emo für eine Ungleichheit in der Wahrnehmung von Verletzlichkeit. Während „Gefühle“ für Männer im Punk historisch gesehen subversiv sind, sind sie bei Frauen weniger bemerkenswert. Oder einfach nur unerwünscht. „Look Now Look Again“ wirkt wie ein Akt künstlerischer Gerechtigkeit. S.E.
25. Cursive, „Domestica“ (2000)
Zwischen Cursive, The Good Life und seinem Solomaterial hätte Saddle-Creek-Allstar Tim Kasher einen Doktortitel in Emo verdienen müssen. Auf dem dritten Album von Cursive zeigt er sich sowohl von seiner verletzlichsten als auch von seiner bissigsten Seite. Inspiriert von seiner damals noch frischen Scheidung, lässt Kasher seine zerbrochene Beziehung durch projizierte Charaktere wiederaufleben.
Anstatt jedoch lyrische Selbstreflexion zu betreiben, zeigt er mit dem Finger in die andere Richtung. Sei es mit der Behauptung „Deine Tränen sind nur Ausreden“ in „The Martyr“. Oder mit verdrehten Gedankenspielen in „The Game of Who Needs Who the Worst“. Kasher nahm sich auch ein wenig kreative Freiheit.
„Diese Figuren lassen sich nicht scheiden. Sie leben weiter zusammen, weil sie sich dafür entschieden haben“, sagte Kasher. „Auf der CD ist die Explosion keine Trennung. Sondern die Akzeptanz, dass das eben das Familienleben ist.“ J.B.
24. Embrace, „Embrace“ (1987)
Wenn man auf die Hardcore-Szene in Washington, D.C. zurückblickt, sind sogar die Bandnamen bezeichnend für ihre spaltende und konfrontative Natur. Minor Threat. Chalk Circle. Iron Cross. State of Alert. Doch 1985 kam Embrace. Die Band, deren Frontmann Ian MacKaye, Mitbegründer von Dischord Records und ehemaliger Sänger von Minor Threat (später bei Fugazi), war, hielt nur neun Monate, bevor sie – ironischerweise aufgrund von Persönlichkeitskonflikten – auseinanderbrach.
Ihr einziges Album zog jedoch eine klare Grenze zwischen der toughen Attitüde des Hardcore und einer ungezügelten, allumfassenden Selbstdarstellung. Während Minor Threat mit Powerchords, Geschwindigkeit und Schuldzuweisungen, ist Embrace ein klirrendes Midtempo-Werk, auf dem MacKaye verletzlich singt. Und mit dem Finger auf sich selbst zeigt. Das Skateboard-Magazin „Thrasher“ bezeichnete den Sound in einer Rezension des Albums als „Emo-Core“. Aber MacKaye konterte. Und nannte es „das Dümmste, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe“. A.B.
23. Taking Back Sunday, „Tell All Your Friends“ (2002)
„Damals, in den Tagen von ‚Tell All Your Friends‘, hatten wir beide immer unsere kleinen Emo-Notizbücher dabei, in denen wir seitenweise alles Mögliche aufgeschrieben haben“, erzählte Gitarrist John Nolan über das Schreiben der Texte für „Taking Back Sunday“ zusammen mit Sänger Adam Lazzara. Gemeinsam starteten sie ihr Debüt mit einem stählernen, drängenden Gitarrenriff, der sich zu Lazzaras schreiendem Jammern „So sick, so sick of being tired“ steigert.
Diese Dringlichkeit überschritt die Grenze zwischen Punk und Screamo. Und schuf ein Emo-Album, das sich anhört, als würde jemandem das noch schlagende Herz herausgerissen. Die Single „Cute Without the ‚E‘ (Cut From the Team)“ ist der Höhepunkt des Albums. Mit Texten, die dazu gemacht sind, überall mitgeschrien zu werden. Vom Auto bis zum Moshpit. „Why can’t I feel anything/From anyone other than you?“ (Warum kann ich nichts fühlen/Von niemandem außer dir?) B.S.
22. Say Anything, „…Is a Real Boy“ (2004)
„Ich hatte Schwierigkeiten, einen Ansatz für das erste Album zu finden“, sagte Say-Anything-Sänger und Texter Max Bemis. „Und ich wurde von vielen Werken von Woody Allen und Charlie Kaufman inspiriert. Künstlern, die sich über den gesamten künstlerischen Prozess lustig machten. Und sich dadurch von der Masse der durchschnittlichen Songwriter abhoben. Wenn man das anerkennt, wird es irgendwie lustig. Anstatt sich so sehr zu bemühen, die ganze Sache wirklich ernst zu nehmen.“
„…Is a Real Boy“ ist ein manisches Meisterwerk der Rebellion gegen alle Erwartungen an Emo und Pop-Punk. Ein Album, das sich nicht scheut, gleichzeitig theatralisch und punkig zu sein. In einer Welt, bevor Panic! at the Disco und Green Day mit American Idiot den kommerziellen Erfolg vorantrieben. Bemis ist ein hoffnungslos romantischer, selbstzerstörerischer, menschenfeindlicher Genie durch und durch. Auf einem Album, das ebenso humorvoll und surreal wie emotional kraftvoll ist. B.S.
21. The Get Up Kids, „Four Minute Mile” (1997)
Die Audioqualität ist nicht besonders gut. Die Songs sind nicht ausgefeilt. Das Album wurde an einem einzigen Wochenende aufgenommen, damit Schlagzeuger Ryan Pope nicht die Highschool verpasste. Und Songs wie „Last Place You Look” sind so ernst, dass sie an Melodramatik grenzen. Dennoch ist „Four Minute Mile”, das Debütalbum der Band The Get Up Kids aus Kansas City, so viel mehr als seine Mängel.
1997 von Frontmann Matt Pryor als „schwungvolle Tanznummern über das Weinen” beschrieben, haben diese vier Kids aus dem Mittleren Westen, die buchstäblich ihren eigenen Sound entdecken, eine unbestreitbare Anziehungskraft. Es sollte daher nicht überraschen, dass Bands wie Fall Out Boy zugegeben haben, dass es sie ohne sie nicht geben würde. J.B.
20. At the Drive-In, „In/Casino/Out” (1998)
Auch heute gibt es kaum Punkbands, die so eklektisch sind wie At the Drive-In. Man denke nur an die Bongoschläge in „Chanbara”, die die Band zwischen einer Garage in El Paso und einem afro-karibischen Jazzclub hin- und herbewegen. Oder an „Pickpocket”, in dem Omar Rodríguez-López und Jim Ward fragende, No-Wave-artigen Gitarrenklänge hervorbringen.
Sie winden sich disharmonisch nach dem Belieben des kreischenden Cedric Bixler-Zavala, der vor dem Modell der Vorstadt-Kernfamilie warnt, indem er es mit einem kulturellen Atomkrieg gleichsetzt. Ein mitreißender Auftakt zu dem noch unerbittlicheren akustischen Angriff ihres folgenden Albums „Relationship of Command“. „Wir konnten vielleicht 30 % der Ideen, die wir ursprünglich für das Album geplant hatten, aus Zeitgründen nicht umsetzen“, sagte Bixler-Zavala. „Unter Zeitdruck zu stehen ist cool. Ich meine, wir arbeiten unter Druck wirklich gut, finde ich. Das spornt uns richtig an.“ S.E.
19. Brand New, „Deja Entendu“ (2003)
Emo eroberte Anfang der 2000er Jahre den Mainstream-Pop. Aber einer seiner brillantesten Acts steuerte auf das Aus zu. In einem „Spin“-Artikel „Trend of the Year” über „Mainstreamo” in der Jahresausgabe 2003 des Magazins sagte Brand-New-Sänger und Gitarrist Jesse Lacey, Emo werde „wieder wie der Hair Metal der Achtziger. Man kann eigentlich nur versuchen, eine der Bands zu sein, die es schaffen, sich zu behaupten.”
Brand New schaffte es, sich zu behaupten. Auch dank ihres Albums „Deja Entendu” aus diesem Jahr, das die aufgestaute Energie ihres Debüts zugunsten von stimmungsvollen, vielschichtigen, hallenden Songs aufgab, die Laceys bissige Texte untermalten. Der grüblerische Frontmann reizte seinen Charme bis zum Äußersten. Aber trotz all der Galle, die er in alle Richtungen versprüht, zeigt er genug Verletzlichkeit, um die Qualen nachvollziehbar zu machen. L.G.
18. Saves the Day, „Through Being Cool“ (1999)
Through Being Cool kombinierte galoppierende, hardcore-angehauchte Riffs mit Chris Conleys charakteristischem Gesang, um Songs zu schaffen, die unzählige nautische Stern-Tattoos inspirieren sollten. Während die meisten Frontmänner es nicht schaffen würden, über die Sehnsucht nach ihrer Mutter („Shoulder to the Wheel“) und das metaphorische Ausstechen der Augen einer Angebeteten mit einem rostigen Löffel („Rocks Tonic Juice Magic“) zu singen, Conleys Talent, Weezer-würdige Hooks zu schreiben, um seine Selbstbewusstheit auszudrücken, macht „Through Being Cool” zu mehr als nur einem wichtigen Album, es ist ein Initiationsritus.
„Wir haben es in elf Tagen aufgenommen. Neun Tage und dann zwei halbe Tage. Und das inklusive Abmischen. … Wenn man heute ein Album so aufnimmt, denken die Leute, man würde sich beeilen, aber wir hatten einfach nur Spaß“, erzählte Conley dem Alternative Press. „[Schlagzeuger] Bryan Newman und ich sahen uns irgendwann an … und uns wurde klar: ‚Hey, das wird richtig gut, wir sollten einfach ein Jahr lang die Schule sausen lassen und auf Tour gehen.‘ Also beschlossen wir, es einfach zu versuchen, weil die Songs im Studio einfach so verdammt gut klangen.“ J.B.
17. Mineral, „The Power of Failing“ (1997)
Viele Musiker sahen Sunny Day Real Estate als Vorbild und trugen ihre Bewunderung wie ein Abzeichen – aber am besten stand es diesen vier jungen Leuten aus Austin. Während SDRE nach den Sternen griff, gingen Mineral noch einen Schritt weiter. Sie gingen mit ihren musikalischen Fähigkeiten bis an ihre Grenzen und verfehlten gelegentlich die dramatischen Höhepunkte, die sie erreichen wollten – doch ihre Überzeugung macht ihre Versuche umso reizvoller.
Die Heldenverehrung von Mineral droht manchmal, ihre eigene Stimme zu übertönen – „80-37” beginnt mit einer düsteren Melodie, die SDREs „Seven” unheimlich ähnelt –, aber sie hatten den guten Geschmack, sich für Euphorie beim Shoegaze zu bedienen. Wenn Mineral in „Gloria” und „Parking Lot” die Verzerrung aufdrehen, fühlt sich The Power of Failing größer an als die Band, die es geschaffen hat – und sogar größer als die Gruppe, die vor ihr kam. L.G.
16. Drive Like Jehu, „Yank Crime” (1994)
Drive Like Jehu wurde nach der Auflösung ihrer Band Pitchfork von den San Diego-Szene-Größen John Reis und Rick Froberg gegründet und war das antagonistische, aggressive Yin zum ausgelassenen, publikumswirksamen Yang von Reis‘ Rocket From the Crypt – was es umso unerklärlicher machte, dass Jehus Meisterwerk, das zweite Album der Band, bei einem Major-Label landete.
Die Songs auf „Yank Crime“ – allesamt Duell-Gitarren, schräge Beats und ohrenbetäubendes Feedback – wirken abwechselnd wie Rachefeldzüge und Ausdauertests, wobei Frobergs hohe Schreie sich durch den Lärm schneiden. Es mag kein richtiges Emo sein, aber das Album sollte einen enormen Einfluss auf die Emo-Underground-Szene der Neunzigerjahre haben, ebenso wie auf spätere Superstars wie At the Drive-In und Thursday.
Im Gespräch mit dem San Diego Reader anlässlich der kürzlichen Reunion von Jehu sagte Froberg natürlich, dass die Pläne der Band nie so ambitioniert gewesen seien: „Wir wollten lauten, hässlichen Lärm machen und uns austoben – das war’s.“ A.B.
15. Dag Nasty, „Can I Say“ (1986)
Dag Nasty entstand aus der Reife zweier ehemals wütender junger Männer: dem ehemaligen DYS-Sänger Dave Smalley und dem ehemaligen Minor Threat-Gitarristen Brian Baker. Der aus Boston stammende Smalley passte perfekt in die aufkeimende Emo-Szene von Washington, D.C. und erwies sich als introspektiver Sänger als weitaus effektiver als als blutrünstiger Schreiender bei DYS. Und Baker, ein Gitarrenwunderkind aus Kindertagen, der bei Minor Threat nur einen Bruchteil seines Könnens gezeigt hatte, brachte neue Akkordfolgen mit, die alle Hardcore-Bands danach vor neue Herausforderungen stellten. A.B.
14. Weezer, „Pinkerton“ (1996)
Weezer knüpften an ihren Power-Pop-Durchbruch mit einem brillanten zweiten Album an, das sich als einer der besten Emo-Crossovers aller Zeiten herausstellte. Obwohl die Texte gelegentlich kontrovers waren – siehe die ersten Zeilen von „El Scorcho“ –, wurde die Band mit den Riffs härter und heavier, und die bekennenden Songs tauchten tief in die Psyche eines Rockstars ein, der mit dem plötzlichen Ruhm zu kämpfen hatte.
Beeinflusst von den anfänglich negativen Kritiken zu „Pinkerton“ sowie der Verletzlichkeit der Themen, bezeichnete Rivers Cuomo das Album zu Beginn des neuen Jahrtausends als „peinlich“. So wie Kritiker und Fans ihre Meinung über das Album im Laufe der Zeit geändert haben, hat auch Cuomo seine Meinung revidiert. „Es ist super tiefgründig, mutig und authentisch“, sagte er 2009 gegenüber Pitchfork. B.S.
13. Jimmy Eat World, „Clarity“ (1999)
„Bevor Clarity herauskam, versuchte das Label, uns dazu zu bringen, Dinge zu tun, um die Leute auf uns aufmerksam zu machen und ihnen zu zeigen, wer wir sind“, sagte Jimmy Eat World-Bassist Rick Burch. „Sie sagten: ‚Okay, Leute, wir kaufen eine PA, ihr fahrt mit eurem Van los und sucht euch den coolen 7-Eleven, wo die Kids nach der Schule rumhängen … ihr baut euch auf dem Parkplatz auf und spielt um 15:15 Uhr, wenn sie vorbeikommen.‘“
Jimmy Eat World waren eine ganz andere Band, als sie vor 17 Jahren ihr drittes Album „Clarity“ veröffentlichten. Tatsächlich galt es bei seiner Veröffentlichung bei Capitol Records sogar als kommerzieller Misserfolg, obwohl die geradlinige Single „Lucky Denver Mint“ im Mainstream-Radio gespielt und in dem Drew-Barrymore-Film „Never Been Kissed“ verwendet wurde.
Es ist jedoch die dunklere, experimentellere Seite wie die Midtempo-Melodik von „Believe In What You Want“ und das hypnotische 16-minütige Finale „Goodbye Sky Harbor“, die „Clarity“ schließlich zu einem Kultklassiker machten. „Take back the radio“, singt Frontmann Jim Adkins in der aggressiven Hymne „Your New Aesthetic“ und ahnt dabei noch nicht, wie berühmt die Band einmal werden würde. J.B.
12. Texas Is the Reason, „Do You Know Who You Are?” (1996)
Do You Know Who You Are?, ein Album, benannt nach den letzten Worten, die John Lennon angeblich vor seinem Tod gehört hat, ist das einzige Album der New Yorker Band Texas Is the Reason, die nach dem Wutausbruch der Misfits über die Ermordung von JFK benannt wurde. Obwohl die Songs auf wichtige Punkte der JFK-Verschwörungstheorien anspielen, dienen diese nur dazu, die persönlicheren Dilemmata von Frontmann Garrett Klahn zu verschleiern.
Von Anfang bis Ende ersetzt Gitarrist Norman Brannon Klahns Beziehungsprobleme mit glänzenden Schnörkeln. Die zurückhaltende Schwere des instrumentalen Titelsongs bietet einen meditativen Zufluchtsort zwischen dem Lärm der umgebenden Songs, gefolgt vom zarten Aufschwung von „The Day’s Refrain“. S.E.
11. Thursday, „Full Collapse“ (2001)
„’Full Collapse‘ war ein Album, das den Verlauf und die Form meines Lebens verändert hat“, sagte Thursday-Sänger Geoff Rickly. „Wir begannen die Tournee dazu in Kellern und VFW-Hallen, machten weiter, spielten als Vorgruppe für Bands wie Murder City Devils und Rival Schools und wurden schließlich zu einer Vollzeit-Tournee-Band, die Hunderttausende von Menschen traf, mit denen wir tiefe und dauerhafte Verbindungen knüpften.“ So grotesk wie populär war der Durchbruch von Thursday im Jahr 2001, der eine neue, radiofreundliche Ära des Post-Hardcore einläutete.
Von dem Moment an, in dem die Snares einsetzen, entwaffnet „Understanding in a Car Crash“ Frontmann Geoff Rickly, der auf dem schmalen Grat zwischen der Angst vor der Sterblichkeit und der völligen existenziellen Resignation balanciert. Seine einzigartig durchdringende Stimme durchdringt den schlammigen, pulsierenden Lärm von „Cross Out the Eyes” und „Autobiography of a Nation” und verebbt dann unter dem sentimentalen Glanz von „Standing on the Edge of Summer”, das eine ebenso mächtige wie zerbrechliche Liebe beschreibt. S.E.
10. My Chemical Romance, „Three Cheers for Sweet Revenge” (2004)
Gerard Way war von dem Moment an, als er My Chemical Romance gründete, auf einer Mission – der Anblick des Einsturzes des World Trade Centers am 11. September ließ ihn sein Leben neu bewerten. Man kann also verstehen, mit welcher Dringlichkeit er sich seiner Kunst widmete.
„Three Cheers“ war nicht nur ein Konzeptalbum, sondern eine konzeptionelle Fortsetzung, die die kleine Bildschirmgeschichte von „I Brought You My Bullets“ aus dem Jahr 2002 zu einer großbudgetierten Produktion, komplett mit Grübeleien über Leben und Tod („Helena”), bissigen Abschiedssongs („I’m Not Okay”) und einer Reihe dramatischer Musikvideos, die sie zu MTV-Lieblingen machten.
Entstanden aus einem intensiven Verlangen nach mehr und unterstützt durch das Budget eines Major-Labels, markierte „Three Cheers“ den Moment, in dem My Chemical Romance begannen, Ways Ambitionen zu verwirklichen, und sie aus New Jersey auf die Weltbühne hoben. Und obwohl sie mit „The Black Parade“ die Grenzen des theatralischen Rocks noch weiter verschoben, begann ihre zielstrebige Revolution hier. J.M.
9. Fall Out Boy, „From Under the Cork Tree“ (2005)
Fall Out Boy veränderten mit „From Under the Cork Tree“ den Emo-Punk, den Pop-Punk und den Pop selbst. Das Album brachte die Szene in den Mainstream und führte zu einem Popularitätsschub für das Label Fueled By Ramen. Die unmittelbarsten Nutznießer waren Paramore und Panic! At the Disco , aber schließlich brachte das Label auch Cobra Starship, Gym Class Heroes, Fun. Twenty One Pilots und viele mehr hervor.
Cork Tree selbst verbindet witzige Wortspiele und emotionale Dramatik mit raffinierten Riffs und dem gefühlvollen Gesang von Patrick Stump und machte FOB zu einer der größten Bands ihrer Zeit – auf dem Nachfolger konnten sie bereits mit Jay Z als Gast und Babyface als Produzent aufwarten. „Ich glaube, viele Kids haben sich als persönliche Botschafter von Fall Out Boy gesehen“, sagte Wentz 2005 gegenüber Alternative Press. „Der Grund, warum unser Album bei seiner Veröffentlichung auf Platz neun landete, waren all diese Kids – nicht das Radio oder MTV. Das gab es damals noch nicht.“ B.S.
8. Jimmy Eat World, „Bleed American“ (2001)
Das 2001 erschienene Album „Bleed American“ von Jimmy Eat World katapultierte die Band von Auftritten mit Underground-Bands wie Mineral und Christie Front Drive zum Mainstream-Erfolg – mit Platin-Auszeichnung, MTV-Präsenz und einer Top-10-Single. Das Album, das nach den Anschlägen vom 11. September als „Jimmy Eat World“ neu veröffentlicht wurde, bewies, dass Emo nicht nur eine rätselhafte Subkultur war.
Mit eingängigen Hymnen wie „Sweetness” und „The Middle” gelang es der Band, den rauen Sound ihres 1996er Albums „Static Prevails” so zugänglich zu machen, dass er auch für alle interessant war, die über den Kauf eines iPods nachdachten. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist die Erwähnung von Davey von Bohlen von The Promise Ring in „A Praise Chorus”. J.B.
7. Cap’n Jazz, „Burritos, Inspiration Point, Fork Balloon Sports …” (1995)
„Ich würde sagen, 90 Prozent der Texte auf diesem Album wurden in einer einzigen Nacht geschrieben, als ich zum ersten Mal Pilze genommen habe und am Lagerfeuer saß“, sagte Cap’n Jazz-Sänger Tim Kinsella. „Ja, das ganze Album, textlich gesehen, entstand in dieser einen Nacht in den Wäldern von Wisconsin.“ Beim ersten Hören könnte man Cap’n Jazz als schlampiges Experiment einer Gruppe von wild gewordenen Band-Nerds abtun.
Aber niemand ahnte, dass ihr erstes und einziges richtiges Album eine wichtige Blaupause für Dutzende von Emo- und Post-Hardcore-Bands werden würde.
Tim Kinsella slurrt flott Zeilen wie „Hey coffee eyes/You got me coughing up my cookie heart“ und versucht dabei, mit den unregelmäßigen Rhythmen seines kleinen Bruders Schritt zu halten. Kinsellas verrückte Zeilen treffen in „Basil’s Kite“ auf noch verrücktere French-Horn-Klänge.Victor Villarreal und Davey Von Bohlen (später bei The Promise Ring) mildern die Absurdität mit perfekt sublimen Gitarren- und Bassläufen – bevor sie alles in Stücke reißen, am besten zu hören im thrashigen „¡Qué Suerte!“, einem sprunghaften Liebeslied für eine sehr sprunghafte Schwärmerei. S.E.
6. American Football, „American Football“ (1999)
Wenn es eine Sache gibt, die dir niemand über junge Liebe erzählt, dann ist es, dass deine Tage von Anfang an gezählt sind. Der ehemalige Cap’n Jazz-Schlagzeuger Mike Kinsella musste dies auf die harte Tour lernen, bevor er mit 17 die Highschool abschloss, was zu einem der verheerendsten Trennungsalben in der Geschichte der Trennungsalben führte. Kinsella greift Texte direkt aus seinem alten Tagebuch auf – darunter herzzerreißend einfache Zeilen wie „You can’t miss what you forget“ – und teilt seine Teenager-Geständnisse auf einer dichten Fusion aus Jazz und Math Rock.
Er und sein Gitarrist Steve Holmes bleiben durch kalkulierte Triller und nahtlose Wiederholungen in ständigem Dialog, deren Spannung durch gelegentliche Trompeten und eine Wurlitzer-Orgel unterbrochen wird, die die Größe besser einfängt als Kinsellas Worte. So wie die Aussicht auf das College die unglücklichen Liebenden auseinandergetrieben hatte, zwang auch dessen Abschluss die Band zur Trennung – bis zu ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2014. S.E.
5. Braid, „Frame and Canvas” (1998)
Braid machten keinen Hehl aus ihren Emo-Einflüssen aus Washington, D.C. – die ersten beiden Alben des Quintetts aus Illinois waren praktisch Hommagen an Rites of Spring und Jawbox. Die Neigung der Band, ihr Herz auf der Zunge zu tragen, ist jedoch das, was Frame & Canvas so fesselnd macht.
Das dritte Album von Braid, das während einer besonders angespannten Tournee geschrieben und aufgenommen wurde, ist eine bittersüße Klage über Heimweh, Fernbeziehungen und, in herausragenden Stücken wie „Breathe In“, die aufkommenden Spannungen zwischen den Sängern/Gitarristen Chris Broach und Bob Nanna. Der Mix von Produzent (und Jawbox/Burning Airlines-Alumnus) J. Robbins bringt die wilden, asymmetrischen Grooves von Schlagzeuger Damon Atkinson zur Geltung und hebt die Songs über den Standard-Melodic-Hardcore hinaus, während die D.C.-Verehrung unter einem neuen, einzigartigen Midwestern-Sound subsumiert wird, der Braids Einfluss auf die nachfolgende Generation prägen sollte. A.B.
4. Jawbreaker, „Dear You“ (1995)
Das vierte und letzte Album von Jawbreaker wurde von den Fans zunächst wegen der Unterstützung durch ein Major-Label und dem ausgefeilten Gesangsstil von Frontmann Blake Schwarzenbach verrissen. „Wir haben viel Kritik einstecken müssen und es wurde sehr politisch, aber für uns war das nie eine politische Sache“, sagte Schlagzeuger Adam Pfahler.
„Aber ich erinnere mich auch, dass es mir ehrlich gesagt völlig egal war. … Wir hatten niemanden, der uns im Nacken saß und uns zwang, etwas zu ändern, oder uns vorschrieb, wie der Sound zu klingen hatte, und als wir fertig waren, dachten wir, wir hätten ein großartiges Album gemacht, und wir sahen uns an und sagten: ‚Entweder sie verstehen es oder sie verstehen es nicht.‘“ Es dauerte eine Weile, aber in den folgenden Jahren wurde „Dear You“ unerwartet zu einem der definitiven Alben des Genres. Von der düsteren Stimmung in „Jet Black“ bis zum fröhlichen Pop-Punk von „Bad Scene, Everyone’s Fault“ klingt Dear You heute genauso poetisch wie vor 20 Jahren. „Es war eine große Bestätigung, dass es später so populär wurde“, sagte Pfahler. „Und es war ein bisschen so: ‚Wo zum Teufel wart ihr, als wir euch gebraucht haben?‘“ J.B.
3. The Promise Ring, „Nothing Feels Good“ (1997)
Einen Monat bevor The Promise Ring ihr Karrierealbum Nothing Feels Good veröffentlichten, fasste Sänger und Gitarrist Davey von Bohlen das zweite Album der Band für den Milwaukee Sentinel Journal zusammen: „Die Grundidee ist, dass man glaubt, Dinge zu wissen, aber in Wirklichkeit weiß man nie etwas.“ Mit Nothing Feels Good stürmten The Promise Ring mit ekstatischer Gelassenheit ins Unbekannte und führten dabei den Emo in seine poppige Zukunft. The Promise Ring spielten Pop wie eine Hardcore-Band mit einer Vorliebe für Doo-Wop – oder vielleicht spielten sie Punk wie eine Popgruppe unter der Führung eines Adrenalinjunkies. Von Bohlens Texte fingen die undefinierbaren Dilemmata der Twens besser ein als die meisten Mumblecore-Filme. L.G.
2. Rites of Spring, „Rites of Spring“ (1985)
Der Begriff „Emo” selbst entstand als Beleidigung für dieses Quartett aus Washington, D.C. – ein Sticheleien von Punks, die sich über den konventionsbrechenden Hardcore von Rites of Spring lustig machten. Das gleichnamige Debütalbum der Band evozierte Liebe, Traurigkeit, Sehnsucht, Verwirrung – nichts von dem Alpha-Männchen-Absolutismus, der den Hardcore der Achtzigerjahre zur Domäne von Sportlern und Schlägern gemacht hatte.
Moll-Akkorde, dramatische Pausen, Gesang, der klang, als stünde er kurz vor den Tränen (und live manchmal auch tatsächlich in Tränen ausbrach): Ja, das war emotional, keine Frage.
Und als 1985 die Musikbewegung „Revolution Summer“ Washington D.C. erfasste, sahen andere Punks in Rites of Spring eine Inspiration für ihre eigene emotionale Freiheit. Für die Bandmitglieder – von denen zwei, Sänger Guy Picciotto und Schlagzeuger Brendan Canty, später die ebenso revolutionäre Band Fugazi gründeten – war die Kodifizierung eines neuen Sounds jedoch reiner Zufall. „Ich habe ‚Emo‘ nie als Musikgenre anerkannt“, Picciotto sagte Mark Prindle im Jahr 2002. „Was, als ob Bad Brains nicht emotional waren? Was – waren sie etwa Roboter oder so? Das ergibt für mich einfach keinen Sinn.“ A.B.
1. Sunny Day Real Estate, „Diary“ (1994)
In den frühen Neunzigern war Seattle ein Synonym für Grunge, aber Sunny Day Real Estate kümmerte sich nicht um diese Entwicklung. Die 1992 von drei Hardcore-Veteranen gegründete Band fand ihre Geheimwaffe in Jeremy Enigk, einem 18-Jährigen mit einer übernatürlichen Falsettstimme. SDRE verband die melodische Wildheit des Dischord-Katalogs mit der Spiritualität von U2 und entwickelte „Diary“ in einer Reihe von langen Jam-Sessions.
Aufgenommen nach ihrer ersten nationalen Tournee 1993, fängt „Diary“ die vagen inneren Turbulenzen von Enigks Texten ein und katapultiert diese turbulenten Emotionen in den Himmel. In den folgenden Jahren versuchten Hunderte von Bands, die Magie von „In Circles“ und „Seven“ zu reproduzieren, doch nur wenige Alben hatten denselben bahnbrechenden Effekt. L.G.



![Pinkerton (Vinyl) [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/61Kqx4X+LbL._SL500_.jpg)