Exklusiver Auszug: „Dune“ aus dem Buch „A Lifetime Full of Fantasy“
Frank Herberts Science-Fiction-Klassiker „Dune“ hat schon viele Regisseure fasziniert. Nach David Lynch ist Denis Villeneuve nun der zweite, der es mit einer Verfilmung auch ins Kino geschafft hat
Dieser Text ist ein aktualisierter Auszug aus dem Buch „A Lifetime Full Of Fantasy: Das phantastische Kino – Aufstieg, Fall und Comeback“, das am 01. Oktober 2021 im Schüren Verlag erscheint. Darin erzählt ROLLING-STONE-Redakteur Sassan Niasseri vom Fantasy- und „Sword and Sorcery“-Kino der frühen 1980er-Jahre, mit Werken wie „Der Wüstenplanet“, „Conan“ und „Excalibur“, bis zur Genre-Renaissance zu Beginn des Jahrtausends, mit Filmen und Serien wie „Herr der Ringe“ und „Game of Thrones“. Im Buch kommen entscheidende Akteure des Fantasy-Genres zu Wort: John Carpenter („Big Trouble In Little China“), Ralph Bakshi („Der Herr der Ringe“), David Bennent („Legende“), Tami Stronach, Klaus Doldinger („Die unendliche Geschichte“) , Phil Tippett („Der Drachentöter“) und Sven-Ole Thorsen („Conan der Barbar“).
>>> Bestellen können Sie das Buch hier.
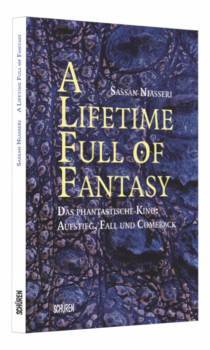
Gute Science-Fiction-Geschichten erzählen davon, was den Menschen droht, falls wir unsere Art zu leben nicht ändern: Wenn wir die Kriege nicht beenden, die Umwelt nicht bewahren. Vielleicht gilt Frank Herberts „Der Wüstenplanet“ deshalb als überragender Sci-Fi-Roman. Er berichtet von der Ausbeutung indigener Völker und ihrer Ressourcen, dem Ansturm imperialistischer Neuankömmlinge. Er erzählt von den Raubzügen durch die Dritte Welt. Der Wüstenplanet Arrakis wird von den eingeborenen Fremen bevölkert, die das Halluzinogen „Spice“ fördern, und die von militärisch hochgerüsteten Invasoren kolonialisiert werden.
„Dune“, wie „Der Wüstenplanet“ im Original heißt, inspiriert seit seinem Erscheinen 1966 die Fantasien vieler Regisseure. Das grundlegende Thema – Pflege des ökologischen Lebensraums – ist in unserem Jahrhundert des Klimawandels aktueller denn je. Aber die auf sechs Bände erweiterte Saga ist derart komplex, dass „Dune“ es bislang nur zweimal ins Kino schaffte. Version eins war von David Lynch, erschien 1984 und wurde von Kritikern als „schlechtester Film des Jahres“ bezeichnet. Die zweite erscheint jetzt: Denis Villeneuves „Dune“.
Zuletzt bewies Villeneuve mit „Arrival“, dass er aus Linguistik-Problemen zwischen Menschen und Außerirdischen eine Geschichte stricken kann, die nicht langweilig ist. Und sein Fortsetzungsfilm „Blade Runner 2049“ sah nicht nur atemberaubend retrofuturistisch aus, er war auch so klug wie sein Vorgänger. Mit „Dune“ muss der 53-jährige Frankokanadier nun zwei Lasten schultern. Er soll dem Herbert-Epos eine gebührende Leinwand-Adaption verschaffen. Und: Er soll das Kino retten – ein Satz, den noch vor zwei Jahren niemand verstanden hätte. Aber seit Corona ist das Kino nicht mehr dasselbe. Über Monate schloss es weltweit seine Pforten. Seit die Säle wieder öffnen, sind sie so leer wie nie zuvor, weil sie wegen Abstandsregeln nicht ausgelastet werden dürfen. Die globalen Einspielergebnisse sinken seit der Pandemie drastisch: Von 42 Milliarden im Jahr 2019 auf 12 Milliarden im Jahr 2020. Die Studios suchen nach Auswegen – potenzielle Blockbuster feiern ihre Premiere im Streaming („Wonder Woman 1984“), damit sie Geld einbringen.
„Dune“ sollte im Oktober 2020 anlaufen, wurde immer wieder verschoben, und wird jetzt, trotz öffentlichem Protest Villeneuves, in den USA für 31 Tage parallel zum Kinostart auch im Pay-TV gezeigt. Man kann es so sehen: Es ist Villeneuves Triumph, dass der 165 Millionen teure Film – neben dem James-Bond-Abenteuer „Keine Zeit zum Sterben“ der meisterwartete des Jahres – überhaupt ins Kino kommt. Angeblich hatten Netflix und Amazon allein für das neue 007-Spektakel mehrere hundert Millionen Dollar geboten, um ihn im Streamingdienst zu präsentieren. Aber die Bond-Produzenten blieben hart, auch, nachdem Amazon deren Mutterfirma MGM gekauft hat.
>>> „A Lifetime Full of Fantasy“ hier bestellen
Die Situation ist herausfordernd. Christopher Nolans Thriller „Tenet“ aus dem vergangenen, noch härteren Covid-Jahr galt als Flop – bei einem guten Box-Office-Ergebnis von 350 Millionen Dollar. „Dune“ soll nun, trotz Corona, schwarze Zahlen schreiben. Und der Branche Hoffnung schenken. Rettet Villeneuve das Event-Kino?
Dass ein Film aussieht „wie für die Leinwand gemacht“, gilt gemeinhin als Lob, ist aber ein Gemeinplatz, denn auf der Leinwand sieht jeder Film besser aus als im Fernsehen. Aber „Dune“ ist ein Werk, das im Kino deutlich besser aussehen dürfte. Für den Wüstenplaneten hält die jordanische Wadi-Rum-Wüste her, deren wild geschwungene Dünenlandschaften, wenn auch durch Effekte aufgehübscht, auf der Leinwand außerweltlich erscheinen. Gleichzeitig rieseln Sandkörner derart trennscharf durch Hände, dass selbst ein technokratischer Kolonialist, der Waffenmeister Gurney Halleck (Josh Brolin), die Schönheit Arrakis‘ nur mittels Poesie zu beschreiben vermag: „Meine Lungen kosten die Luft der Zeit, verweht im Sand.“
Halleck steht im Dienst des Herzogs Leto Atreides (Oscar Isaac), der vom Galaktischen Imperator den Auftrag erhält, den Wüstenplaneten zu besiedeln. Arrakis ist die Quelle des „Spice“: eine Droge, die das Leben verlängert, das Bewusstsein dauerhaft erweitert und außerdem als einziger Treibstoff für interstellare Reisen dient. Wer das Spice beherrscht, beherrscht das All. Deshalb versucht das verfeindete Haus Harkonnen den Planeten einzunehmen. Ein Komplott gegen Leto führt zum Untergang des Hauses Atreides; sein Sohn Paul (Timothée Chalamet) und dessen Mutter Jessica (Rebecca Ferguson) fliehen in die Wüste. Sie begegnen den indigenen Fremen, die im Jungen den Kwisatz Haderach ersehnen – den Anführer aus einer fremden Welt, der sie aus der Unterjochung befreit.
Mit seinem Roman beschrieb Frank Herbert den Imperialismus, aber sein Werk war nicht frei von Klischees, die dem abendländischen Blick entspringen. Der Fremen war für ihn der „edle Wilde“, und wie Lynch mit seiner 1984er-Verfilmung tappt auch Villeneuve in die Falle, Paul Atreides als „White Savior“ zu inszenieren: Ein vorgeblich klügerer und strategisch weitsichtigerer Soldat aus einer fremden Kultur rettet Eingeborene aus einer existenziellen Notlage, aus der sie sich nicht selbst befreien können. Der Messias wird dabei nicht nur zu einem der ihren, sondern zu einem, der sie übertrumpft. Er wird zu ihrem Oberhaupt. „Du bist die Stimme der Außenwelt, die uns ins Paradies führen wird“, sagt einer der Fremen.
Der Backlash ist unausweichlich
Wer in der Wüste aufwächst, hat eine dunklere Hautfarbe. Aber was spräche dagegen, Kino-Nomaden wie die Fremen mal nicht als Abergläubische mit orientalischem Akzent auszustatten, nur brüchig der Filmsprache mächtig? „Dune“ beschreibt eine fiktive Welt, die Eingeborenen könnten ganz normal reden. Und warum muss jede ihrer dramatischen Entscheidungen mit dem von Komponist Hans Zimmer seit Beginn des Jahrtausends perfektionierten „One Woman Wail“ versehen werden – dem Klagegesang einer betenden arabischen Frau?
David Lynch inszenierte die Fremen als ebenbürtig. Und natürlich schwebt Lynchs Geist, so ungeliebt sein auf charmante Art hysterischer, psychedelischer Film auch ist, über Villeneuves Neuversuch. In den Monaten nach Kinostart wird das Netz voll sein mit Vergleichen zwischen den Regisseuren, die als Visionäre ihrer Ära gelten, Lynch seit dem „Elefantenmenschen“ von 1980, Villeneuve seit „Arrival“ von 2016. Einen Backlash wird Villeneuves „Dune“, der bei der Premiere in Venedig eine siebenminütige Standing Ovation erhielt (auf dem Filmfestival gelten die Applausminuten als Gradmesser), sowieso erleben – da muss jeder frühzeitig gefeierte Film heutzutage durch. Die unzähligen Diskussionsforen im Web sowie die Tatsache, dass ein „Rewatch“ im Heimkino immer früher möglich wird, bedingen oftmals eine rasche Neubewertung.
Die schönsten Dialoge bestehen aus Zitaten, die sowohl Lynch als auch Villeneuve aus Herberts Roman übernahmen. Dies ist die Pointe, auch wenn sie Lynch, der den „Wüstenplaneten“ am liebsten aus seinem Œuvre streichen würde, nicht interessiert: Da es wahrscheinlich mehr jüngere Sci-Fi-Fans gibt, die seinen Film kennen als Herberts Buch gelesen haben, werden die Wörter womöglich ihm zugeschrieben, „The Slow Blade Penetrates The Shield“, „Fear Is The Little Death“, „I Hope You Will Live“. Dabei verspürte Lynch kein Verlangen, das Genre-Kino zu bedienen. Weiter entfernt von dem, was einen SF-Blockbuster auszeichnet und er nur am Rande inszenierte – Gefechte zwischen Flugkörpern, Aufmärsche von Infanteristen – könnte sein Film nicht sein. Ihn beschäftigte die vielleicht lehrreiche, aber nicht gerade spannende Abschöpfung eines Elixiers: Das „Wasser des Lebens“, eine Ausscheidung der auf Arrakis lebenden, gigantischen Sandwürmer, die jeden Menschen umbringt – aber aus Paul Atreides, der die Darreichung überlebt, den Anführer der freien Welt macht. Die Verarbeitung des Gifts zelebrierte Lynch als drogeninduzierten Rausch, in dem Paul sich eins mit dem Universum fühlt. Es ist Lynchs Lebensthema: Die verschwommene Grenze zwischen Wahn und Wirklichkeit. Dafür standen ihm 40 Millionen Dollar Budget zur Verfügung, für das Jahr 1984 ein gewaltiger Betrag. Die Einnahmen betrugen 30 Millionen.

Villeneuves Film beginnt mit einem Ausspruch wie von Lynch: „Träume sind Botschaften aus der Tiefe“. Nur wird er mit Traumsequenzen allein keine 165 Millionen Dollar Produktionskosten wieder reinholen. Herberts Roman ist, trotz seiner interplanetarischen Schauplätze, ein Kammerspiel. Die meisten Kapitel bestehen aus Gegenüberstellungen von Gesprächspartnern in geschlossenen Räumen. Deshalb wird es nicht allen Herbert-Apologeten gefallen, dass im Mittelpunkt von „Dune“ aufwendige Action-Szenen stehen. Der Harkonnen-Angriff auf das Haus Atreides präsentiert prächtige Laser-Artillerie im Abwehrkampf gegen eine Armada an Raumschiffen. Auch der Nahkampf ist eindrucksvoll. Martial Arts scheint ein Muss für heutige Kino-Prügeleien zu sein, und „Game of Thrones“-Schönling Jason Momoa hat, in der Rolle des Schwertmeisters Duncan Idaho, einen seiner typischen ich-treffe-blind-und-sehe-dabei-blendend-aus-Auftritte, die an einen Samurai-Tanz aus einem Kurosawa-Film erinnern.
„Dune“ trägt den Zusatztitel „Part One“. Mit dem Zusatz wird aber nicht allzu deutlich geworben – möglicherweise hat das Studio Angst, das Publikum könnte fernbleiben, müsste es sich auf den Auftakt einer Fortsetzungsgeschichte einlassen. Villeneuve hat nämlich noch einiges mehr zu erzählen, will er Herbert gerecht werden. Ihm wurde erlaubt, in 155 Minuten nur die erste Romanhälfte zu verfilmen. Hollywood hat aus Lynchs „Wüstenplanet“-Debakel gelernt. Dessen Verfilmung gilt als gescheitert, weil sie konfus erzählt ist. Er musste einen 700-Seiten-Roman in einer Filmlänge von 137 Minuten darstellen. Um möglichst viel Information unterzubringen, baute er Voice-Over ein, erklärende Stimmen aus dem Off – was noch mehr verwirrt.
Dabei ist keinesfalls gesichert, dass es einen zweiten Villeneuve-„Dune“ geben wird. Das hängt davon ab, ob „Dune“ ein Erfolg wird. Im Pandemie-Jahr 2021 eine harte Bedingung. Warum Villeneuve, der die Dreharbeiten lange vor Corona begann, nicht gleich zwei Filme am Stück drehen durfte, ist ein Rätsel. So genannte „Back to Back“-Filme sind heutzutage nicht selten. James Cameron dreht derzeit parallel vier Fortsetzungen seines Sci-Fi-Epos „Avatar“, und die berühmtesten „Back to Back“-Filme wurden 1998 gar in die Hände eines jungen Neuseeländers gelegt, der als Regisseur von Zombie-Trash-Streifen bekannt wurde: Peter Jacksons „Herr der Ringe“-Trilogie. Vielleicht hat es Villeneuve geschadet, dass sein „Blade Runner 2049“ hochgelobt, aber verkopft ist, kein Hit wurde. Die Verfilmung des „Wüstenplaneten“, sagte er, sei sein Kindheitstraum gewesen. Jessica-Darstellerin Rebecca Ferguson pflichtete bei: „‘Dune‘ ist seine Bibel. Er weiß so viel über Dünen, er könnte an einem Strand Sand verkaufen.“

Befürchtet das Studio, „Dune“ könnte an den Kassen scheitern wie einst David Lynch? Anfang des Jahres sagte Villeneuve, dass es seine Entscheidung gewesen sei, nicht gleich beide Teile zu drehen. Die Dreharbeiten in der Wüste seien anstrengend, das Team müsste erst wieder Kräfte sammeln. Aber dass er im Vorfeld des Kinostarts zunehmend auf die Pauke haut („Ich stehe bereit!“), könnte auch als Zeichen der Nervosität ausgelegt werden.
Falls „Dune“ unvollendet bleibt, würde sich das auf die Wahrnehmung von „Part One“ auswirken. Teil eins kann nicht für sich alleinstehen, hat ein offenes Ende. Viele prominent besetzte Rollen erhalten eine kurze Auftrittsdauer, die in „Part Two“ ausgebaut werden müsste. Der Harkonnen-Neffe Glossu Raban wird vom Marvel-Star Dave Bautista verkörpert, ist hier aber nur Stichwortgeber seines Onkels Vladimir (Stellan Skarsgård). In Lynchs Film ist der Atreides-Antagonist Vladimir ein adipöser, schnell in die Luft gehender Clown, brillant dargestellt von Kenneth McMillan, bei Villeneuve ein grübelnder, sich die Glatze reibender Colonel Kurtz. Skarsgård erhält in „Part One“ lediglich drei knappe Szenen; sein zweiter Neffe, Feyd-Rautha, bei Lynch mühelos widerwärtig gespielt von Sting, fehlt ganz. Die fremische Atreides-Magd Shadout Mapes taucht beim 155-Minuten-Villeneuve so kurz auf wie beim 137-Minuten-Lynch, hat keinen erzählerischen Nutzen. Und ausgerechnet der Atreides-Vertraute Dr. Yueh (Chang Chen) ist im überfrachteten Lynch-Film deutlich präsenter als bei Villeneuve – und seine Rolle könnte bedeutender nicht sein. Yueh ist der große Betrüger im Intrigenspiel, dem Herzog Leto zum Opfer fällt. Er glaubt, durch den Verrat seine von den Harkonnen gefangen genommene Ehefrau retten zu können. Wenn Yueh – drei Szenen, drei Sätze – jedoch permanent im Hintergrund verweilt, wird eben die Schwere des Verrats nicht spürbar, da wir Zuschauer bis zur großen Auflösung seiner Missetat keine Beziehung zum blass bleibenden Mediziner aufgebaut haben.
Der Harkonnen-Sohn Feyd-Rautha ist besonders wichtig: Er ist im selben jugendlichen Alter wie Paul Atreides, nur steht er auf der anderen Seite. Er ist machtbesessen und ein Sadist, und nicht zuletzt ist „Der Wüstenplanet“ auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Eher ungelenk versucht Villeneuve, wie zuvor Lynch, der Vielschichtigkeit von Herberts jahrtausendealter „Dune“-Historie (der Film spielt im Jahr 10191) mit einem verknappenden, aber nicht originellen Erzählmittel zu begegnen: Paul Atreides sieht sich ein Lehrvideo an, das die Konstellationen der verfeindeten Häuser erklärt, als auch die Kultur der Fremen – und wir lernen per Crashkurs mit.
Spätestens nach dem amerikanischen Kinostart am 22. Oktober könnte feststehen, ob Corona die Ära der Blockbuster zu beenden droht, weil die Leute den Lichtspielhäusern fernbleiben, lieber zu Hause den Stream abrufen. Villeneuves „Dune“ ist kein im „worldbuilding“ vollends überzeugender Film – Herberts Welt sieht bei ihm gelegentlich nach Dubai-Glanz aus, bei Lynch nach einem barocken italienischen Neureichen-Traum. Aber er bedient die Interessen unterschiedlichem Zielpublikums, das doch gemeinsam hat, gern ins Kino zu gehen: Die Comic-Helden-Stars Momoa und Bautista wüten zuverlässig, der 26-jährige Paul-Darsteller Chalamet wiederum gilt als meistgefeierter „Charakterdarsteller“ seiner Generation. Die Sandwürmer sind beeindruckende Monster, und Hans Zimmers lautes Orchester sorgt für Herzrasen. Bei Lynch war es die Verbindung zur Musik, die aus seinem „Wüstenplaneten“ einen Erfolg hätte machen müssen. Sting war 1983 dank seines Police-Hits „Every Breath You Take“ der größte Rockstar, und Toto, die den instrumentalen Soundtrack schrieben, erhielten vor Drehstart sechs Grammys für ihr Album „Toto IV“. Vor den Singles „Rosanna“ und „Africa“ gab es kein Entkommen, und „Africa“ zeigt im Refrain („I Bless The Rains Down In Africa“) eine unfreiwillige Verwandtschaft zu Arrakis, wo das Wasser ebenso innig ersehnt wird. Songs für den „Wüstenplaneten“ aber boten erstaunlicherweise weder Toto noch Sting an.
Frank Herberts Botschaft bleibt in Villeneuves „Dune“ erhalten. „Die Wüste“, sagt die Ökologin Liet Kynes (Sharon Duncan-Brewster), „interessiert sich nicht für Material, sie interessiert sich nicht für Menschen.“ Als Herbert 1965 seinen Roman veröffentlichte, konnte er nicht ahnen, dass die Desertifikation genannte Ausbreitung der Wüste im kommenden Jahrhundert stärker voranschreiten würde als von ihm prognostiziert. Er sprach sich für eine Methode der Energiegewinnung aus, die heute eine allgegenwärtige Forderung von Umweltaktivisten und immer mehr Politikern ist, aber damals schwarzmalerisch klang: „Uns muss der Wandel gelingen von nicht-erneuerbaren Energien hin zu erneuerbaren Energien. Und diese Schritte müssen wir jetzt erledigen. Wir müssen in den sauren Apfel beißen und sagen: ‚Das wird uns etwas kosten‘“.
Am Ende wird er emotional: „Ich weigere mich meinen Enkeln sagen zu müssen: ‚Es tut mir leid, aber für euch gibt es keine Welt mehr. Wir haben sie aufgebraucht‘“.
Dieser Text ist ein aktualisierter Auszug aus dem Buch „A Lifetime Full Of Fantasy: Das phantastische Kino – Aufstieg, Fall und Comeback“, das am 01. Oktober 2021 im Schüren Verlag erscheint. Darin erzählt Sassan Niasseri vom Fantasy- und „Sword and Sorcery“-Kino der frühen 1980er-Jahre, mit Werken wie „Der Wüstenplanet“, „Conan“ und „Excalibur“, bis zur Genre-Renaissance zu Beginn des Jahrtausends, mit Filmen und Serien wie „Herr der Ringe“ und „Game of Thrones“.






