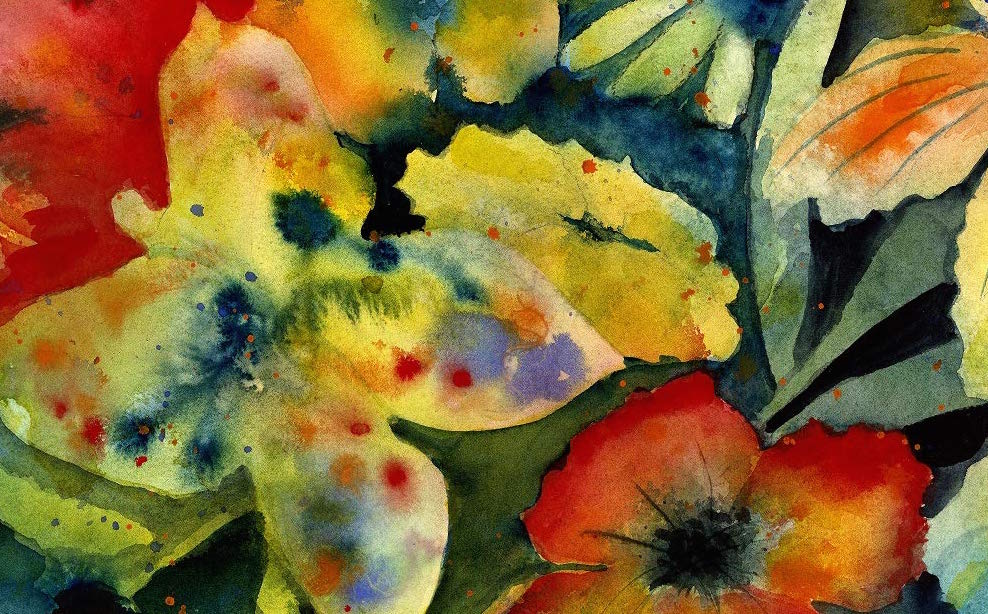Ganz alleine, ganz da oben
Ihr auftritt ist atemberaubend: Laura Marling steht regungslos mit ihrer Wandergitarre da, guckt in die Luft und strahlt eine Aura ernsthafter Stille aus, die eine Frau von 23 Jahren nur dann haben kann, wenn sie außerordentlich begabt ist. Da oben auf der Bühne ist Laura Marling die Andere, die Unantastbare, die Künstlerin. Ihre Unnahbarkeit hat eine hohe, ganz eigene Qualität – die Gabe von Laura Marling, so wirkt es an diesem Abend, ist schon jetzt größer als sie selbst. Sie ist zu Gast bei „Later with Jools Holland“, um England ihr neues Album, „Once I Was An Eagle“, zu präsentieren. Sie singt dort zum wiederholten Mal. In den Interviews zum letzten Album sagte sie, sie müsse sich nun nichts mehr beweisen (mit 21!), dafür habe sie jetzt aber Angst vor der Bürde, eine Künstlerin zu sein.
Da muss man wieder an Joni Mitchell denken, ihr großes Vorbild, mit der sie eigentlich nicht mehr verglichen werden wollte. Doch die Ernsthaftigkeit im Umgang mit der eigenen Kunst, die tiefe Reflexion über die eigene Rolle, dazu die enorme Geschwindigkeit der musikalischen Entwicklung, mit der sie zum Beispiel ihre Clique von Noah And The Whale und Mumford & Sons künstlerisch abhängte – das alles weist auf etwas Besonderes hin.
Mit dem neuen Werk geht Marling nun noch einen Schritt weiter als auf dem Vorgänger „A Creature I Don’t Know“. Schon dort hatte sie sich vollends von den zum Schema gewordenen Trends der Neo-Folk-Szene emanzipiert und erschreckend gute Lieder geschrieben, die Produzent Ethan Johns zu kraftvollen Klanggemälden erweiterte. Auf „Once I Was An Eagle“ beweist Marling weniger stilistische Virtuosität als musikalische Souveränität – die Strukturen verschwimmen. Zunächst scheinen die 16 Lieder schwer unterscheidbar; fast hat man den Eindruck, Marling wolle es dem Zuhörer extra schwer machen oder doch zumindest sagen: Ich werde nicht versuchen, eure Aufmerksamkeit zu behalten. Marling findet auf ihrer Gitarre orientalisch anmutende Folk-Blues-Harmonien, die an Mitchell und Nick Drake, aber auch an Led Zeppelin erinnern, taucht in tiefe Stillen, findet aber auch bedrohliche Töne. Gegen Ende wird das Album abwechslungsreicher, Marling demonstriert in Komposition und Performance einen enormen Zugewinn an Größe. Once I was an eagle? Nein, sie schwingt sich doch gerade erst dazu auf! Ethan Johns erweitert all das mit Djembe, Schlagzeug, Streichern, Orgel und zusätzlichen Saiteninstrumenten, unterlegt Geräusche, unterstreicht Intimitäten und rhythmisiert an geeigneter Stelle – meisterlich.
„Die Platte ist genauso seine wie meine -ich singe und spiele meine Lieder, er macht den Rest“, applaudiert Marling ihrem Produzenten am nächsten Morgen in einem kleinen Café im Londoner East End, wo sie eine Weile lebte. „Ich habe nicht diese Landschaften im Kopf.“ Marling trinkt Wasser und raucht und wickelt sich trotz des warmen Frühlingsmorgens in ein wollenes Ding, das gleichzeitig Schal und Jacke zu sein scheint. Sie ist vielleicht noch etwas übernächtigt von der am Abend zuvor produzierten TV-Show, aber auf ihre zurückhaltende Art voll konzentriert.
Bei „A Creature I Don’t Know“ haben Sie sich zurückgezogen, Bücher gelesen und abgewartet, bis die Lieder kamen. Wie war es diesmal?
Als ich das letzte Album gemacht habe, habe ich versucht, mich an meinen neuen Lebensstil zu gewöhnen. Ich hatte den Eindruck, mich für meinen Erfolg rechtfertigen zu müssen. Kann man das wirklich ernsthaft sein, eine Liedschreiberin? Das ist doch kein richtiges Leben. Ich wollte mich nicht beschweren -es war ja wunderbar, was da mit mir geschah, aber ich hatte immer den Eindruck, dass ich es nicht tun darf. Ich habe dann gedacht, vielleicht erfülle ich ja eine Art gesellschaftlicher Funktion. Vielleicht ist Musik etwas, das die Menschen brauchen. Die Leute haben ja einen Platz für Gott in sich, und wenn sie ihn nicht mit Gott füllen, dann vielleicht mit Musik oder Literatur Das hat mich beruhigt. Jedenfalls war ich beim Schreiben der neuen Songs wesentlich entspannter und habe nicht mehr andauernd meine Existenz diagnostiziert. Ich habe akzeptiert, dass ich eine Songschreiberin bin. Es ist ein Segen, dieses Medium zu haben, und ich habe großes Glück, dass mein Vater mir eine Gitarre geschenkt hat, als ich fünf war, und dass ich Joni Mitchell entdeckt habe, als ich 13 war, all diese glücklichen Umstände, die mich zu der gemacht haben, die ich bin. Doch das ist nicht das Einzige, was ich bin. Es gibt viele andere Dinge, die mich befriedigen und glücklich machen. Das hat in mir viel Platz gemacht, weil ich mich nicht mehr so wahnsinnig darauf konzentriert habe, eine Musikerin zu sein.
Klingt nach einem Reifeprozess.
Ob du nun ein Songwriter bist oder irgendetwas anderes – everybody’s trying to figure out shit at twentysomething. Ich denke, die größte Offenbarung in meinem Leben bis jetzt ist die, dass ich eine Einzelgängerin bin. Das hat mich immer sehr bedrückt; wenn man ein Teenager ist, ist es einfach bescheuert, eine Einzelgängerin zu sein. Je älter ich werde, desto wohler fühle ich mich in meiner Haut. Ich liebe die Menschen, ich liebe meine Freunde, und ich liebe meine Familie, und ich muss versuchen, für eine Zeit am Tag keine Einzelgängerin zu sein, aber dann muss ich auch wieder mein Alleinsein umarmen.
Im Pressetext zu Ihrem neuen Album schreiben Sie von alten Häusern und Plattenspielern, SMS und der Hochgeschwindigkeit der Moderne. Sie wirken da wie jemand, der das Alte bewahren will, ohne den Anschluss an das Neue zu verlieren.
Das ist die Spannung, in der ich ständig lebe. Ich gehöre zu der Generation, die mit einem Mobiltelefon geboren wurde. Aber je mehr diese neuen Technologien in unser Leben kriechen und es beschleunigen, desto komplizierter wird es für mich. Ich habe ein Buch von Robertson Davies gelesen, in dem er mit einer Roma über die Spiritualität ihres Volkes spricht, und sie sagt: Vor zehntausend Jahren konnten wir unser Ohr an den Boden legen und eine hundert Kilometer entfernte Armee marschieren hören, und dass wir dieses Wissen besser erhalten sollten, bevor es vom Antlitz der Erde verschwindet. Das ist es, was ich meine: Je tiefer meine Generation in diese technologische Welt eintaucht, desto weniger verstehe ich sie. Das ist eine riesige Angst von mir, dass ich den Anschluss für immer verliere, weil ich so an der Vergangenheit hänge. Dahinter steht die Frage, wie frei wir sind.
Ja, und es gibt zwei Stämme: Der eine denkt, dass wir sein können, wer wir sein wollen, der andere muss sich ständig der eigenen Existenz vergewissern. Ich habe Freunde aus beiden Stämmen, und ich liebe sie sehr. Ich glaube nur, dass der eine Stamm es im Leben wesentlich leichter hat.
Solche Überlegungen verdichtet Laura Marling auf ihrem Album zu einer Erzählung, deren Hauptfiguren eine junge Frau namens Rosie und ein Vogel sind. Rosie macht sich auf in die Wildnis der Menschheit, erlebt dunkle Tage und kommt zu dem Schluss, dass Liebe und Glücklichsein die wichtigsten Komponenten des Lebens sind. Am Ende überbringt der Vogel eine Botschaft, die Rosie selbst nicht überbringen kann; sie kann ja nicht fliegen. Marling ist die betont einfache Geschichte etwas unangenehm, und sie will sie auch nicht überbetonen. „Sie hat mir geholfen, eine Art Universum für das Album zu schaffen. Genauso kann man aber sagen, diese Songs sollen auf eine verständliche Weise die Gedanken zum Ausdruck bringen, die ich im Moment habe.“
Die Reihenfolge der Lieder auf „Once I Was An Eagle“ entspricht der, in der Marling sie geschrieben hat. Mit Ausnahme eines Liedes war das auch auf den beiden Vorgängern so. Eine sonderbar konsequente Entscheidung; andere Künstler kämpfen bis zum Schluss um den richtigen Spannungsbogen eines Albums. „Es ergibt Sinn für mich. Ich behaupte nicht von mir, ich wäre organisiert genug, das Konzept einer Platte zu kennen, bevor ich sie geschrieben habe“, erklärt sie. „Wenn ich mir ein fertiges Album anhöre, finde ich vor allem die Sachen gut, die sich in das Lied geschlichen haben, ohne dass ich es gemerkt habe. Dann muss es ja ein Gedankengang ganz hinten in meinem Gehirn gewesen sein, der mich so sehr beschäftigt hat, dass er es irgendwie nach außen geschafft hat. Das ist die lange Erklärung; die kurze ist, dass ich zu faul bin, mir eine Reihenfolge zu überlegen, weil ich den Eindruck habe, das nicht gut zu können.“
Ihrem Vater hat sie das Album noch nicht vorgespielt. Der hatte früher ein Tonstudio und hat Marling an die Musik herangeführt, die sie heute prägt. Marling zögert mit der Antwort auf die Frage, wie wichtig seine Meinung sei. Sie spiele ihm das Album erst vor, wenn er fragt, sagt sie schließlich -nicht, weil es sie treffen würde, wenn es ihm nicht gefiele, sondern weil „er vielleicht etwas sagt, das mich verwirrt oder das unsere Beziehung durcheinanderbringt. Meine Musik ist für mich eine sehr delikate Angelegenheit, und meine Beziehung zu meiner Familie ist mir sehr wichtig. Ich trenne die beiden Welten gern voneinander – Musik kann einen genauso zusammenbringen wie entfremden.“ Sie sei ihren Eltern sehr ähnlich, sagt Marling. Der stille Vater, die superfürsorgliche Mutter – beides stecke in ihr drin. „Es gibt ein Lied auf meinem ersten Album über meine Mutter und meinen Großvater, das ist sehr autobiografisch. Das war nicht leicht für meine Mutter, sie hatte ja nicht darum gebeten, plötzlich so öffentlich zu werden. Diese Dinge können schwierig sein.“ Zum Beispiel beim letzten Album, weil Marling erst mit Charlie Fink von Noah And The Whale und dann mit Marcus Mumford liiert war und alle Welt die Lyrics auf entsprechende Verweise durchsuchte. Vergangenheit.
Ob ihre Plattenfirma das Album mag, weiß Marling nicht. Keine Telefongespräche, kein Feedback, schon gar keine Sitzungen. Diese Verweigerung gegen alles Geschäftliche ist gut bekannt, darin schwingt ein künstlerischer Stolz mit, der der Künstlerin gut steht. Trotzdem ist sie ihre eigene Frau: Ihre sechswöchige US-Tournee im letzten Jahr (sie wohnt mittlerweile in Kalifornien) absolvierte sie ohne Roadmanager -und hatte im Ernstfall genügend Mut, zum Beispiel, als sie einem Booker in L. A. nach der Show das ihr zustehende Geld abtrotzen musste. „Du würdest dich wundern: Ich kann ziemlich streng sein“, lächelt Marling. „Aber in der Regel war meine Erfahrung die, dass die Leute nett sind und Musik lieben, anstatt einen über den Tisch zu ziehen – ich musste diese Vorstellung vom bösen Business aus meinem Kopf streichen. Mein eigener Roadmanager zu sein hilft mir, die wirtschaftliche Seite dessen, was ich tue, besser zu verstehen.“ Auch auf eine Band verzichtet die Künstlerin – meistens ist nur eine Cellistin dabei. Keine Band, keine Techniker, mehr Zeit fürs Alleinsein. „Mir ist das einfach zu stressig -ich hatte diverse Angestellte und war für ein ganzes Team verantwortlich. Zu kompliziert.“
Die Aura der Distanz und Abgesondertheit, mit der Laura Marling sich bei ihren Auftritten umgibt, ist freilich auch Selbstschutz. „Ich kann nicht die Art von Künstlerin sein, die für alle zu haben ist -ich bin dazu nicht in der Lage. Ich will das, was ich hier mache, noch für eine möglichst lange Zeit machen, und ich weiß, das ist ein Geben und Nehmen, aber es soll mein anderes, wirkliches Leben nicht zu sehr beeinflussen. Viele Leute, die ich treffe, haben eine Vorstellung davon, wer ich bin, aber sie kennen mich nicht Ich komme mit ihnen klar und mag sie, aber ich muss eine Grenze ziehen – es fühlt sich sonst an, als hätte ich zu viel von mir selbst weggegeben.“