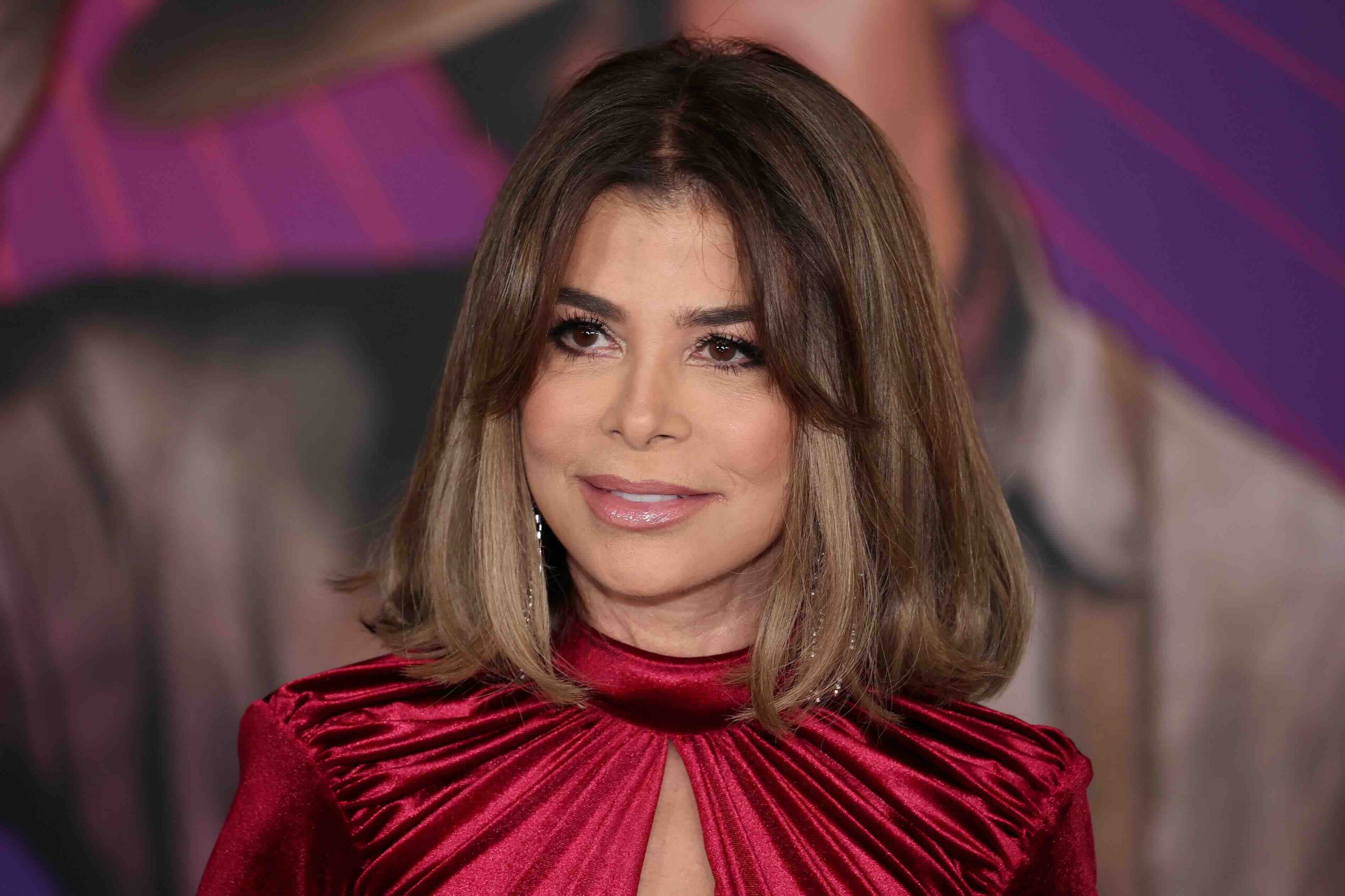Haldern Pop 2010 – Der Nachbericht.
Am vergangenen Wochenende fand in Rees-Haldern zum 27. Male das Haldern Pop statt. In niederrheinischer Landidylle sorgten Mumford & Sons und Villagers für große Momente, während die sonst so souveränen The National an Soundproblemen verzweifelten.
Auf der Terrasse des Restaurants Doppeladler im Ortskern von Rees trägt man heuer Ganzkörperbrille. Auf der Lohstraße pilgert eine einzige Bandshirtparade, bei der man besser nicht mit einem schnöden Sonic Youth-Shirt von der H&M-Stange kommt – dann schon lieber mit einem der Guided By Voices Deutschland-Tour 2002. Auf den Feldern rund um den Reitplatz zu Haldern sind zahllose Zeltcamps passgenau in das Kuhfladenminenfeld eingepasst, das die eigentlichen Hauptmieter dort hinterlassen haben. Zwischen dem für das Festival angereisten Publikum laufen kleine blonden Kinder, von denen ein jedes einen „Popblag“-Pass hat – ganz wie die Großen, auf denen ganz langweilig „Presse“ oder „AAA“ steht. Eines jener besagten Kinder trägt ein Shirt, auf dem steht: „Wie viele Lieder darf ich noch?“
Das Haldern Pop ist in seiner 27. Ausgabe, die wieder einmal bei feinstem Sommerwetter ablief, geradezu vorbildlich ins Landleben am Niederrhein eingepasst. Alle sind freundlich, entspannt, auf maximale Harmonie aus. Wer sein Musikfestival also lieber wild und laut und dreckig und ein wenig chaotisch mag, der wird auf dem Haldern das kalte Grausen kriegen. Was natürlich Quatsch wäre – beim Haldern wissen die meisten, worauf sie sich einlassen – dennoch kann man schon anmerken, dass man sich seitens der Veranstalter und vor allem der Booker Gedanken machen muss, damit die Veranstaltung nicht zu behäbig wird. Als am letzten Abend nach dem Headliner-Gig die Leute vom Hauptgelände strömten und dann in die zwar wunderbar hypnotischen aber laaangsamen Klagelieder der Whale Watching Tour liefen, die im Spiegelzelt spielten, da wünschte man sich dann doch etwas mit mehr Schmiss.
Der Donnerstag spielte sich traditionell komplett im Spiegelzelt ab, einer Bühne, vor die leider nur rund 300 Zuschauer passen. Zwar gibt es im Biergarten vor dem Zelt eine große Leinwand, aber die macht das Grunddilemma auch nicht wett. Natürlich: Die Haldern-Macher sind im besten Sinne stur, das macht den Reiz ihrer Veranstaltung aus, aber ein Festival mit über 5.000 Gästen auf diese Weise zu starten zu lassen, und den Leuten, die es nicht mehr hineinschaffen, gleich so spannende Acts wie die Sting-Tochter I Blame Coco, die schon vom Rolling Stone Weekender bekannten Cymbals Eat Guitars oder die britische Pop-Hoffnung Stornoway vorzusetzen, bleibt – mit Verlaub – eine bescheidene Idee. So früh kann man sich als Besucher gar nicht anstellen, dass man es da noch rein schafft. Schön, dass Stornoway die Problematik erkannten und spontan ein Konzert für die in der Schlange wartenden spielten.
Am folgenden Freitag erledigte sich dieses Problem größtenteils, entzerrte sich das Programm ja auf zwei Bühnen. Pünktliches Anstehen lohnte sich dennoch, denn mit dem Guillemots-Sänger Fyve Dangerfield, der sich am Piano lediglich von zwei Streichern begleiten ließ, hatte man die erste Gelegenheit des Tages, trotz 40 Grad Raumtemperatur so etwas wie Gänsehaut aufkommen zu lassen. Obwohl Dangerfield zuvor noch im Interview sagte, es sei befremdlich seine Solosongs zu spielen, wo er doch gerade mit seiner Band am dritten Album arbeite und diese in die Klanguniversen des Space-Rocks schießen wolle, fand er zu „She’s A Woman“ auch am Klavier vollends zu sich und zur puren Essenz dieses mutmachenden Lovesongs. Direkt im Anschluss lieferte dann das ehemalige Noah And The Whale-Mitglied Laura Marling ein weiteres Highlight des Tages. Blass stand sie da, konzentriert, nur vage lächelnd – aber die erstaunliche Reife ihres Songwritings, die mit ihrer eingespielten Band, in der sich auch ein Mumford fand, in klanglicher Perfektion dargebracht wurde, begeisterte wohl jeden Skeptiker, der sich einst gewundert haben dürfte, warum ihr zweites Album „I Speak Because I Can“ in ihrer Heimt von 0 auf 4 chartete. Dennoch war es ein alter Song namens „Ghosts“, der direkt ins Herz traf: „Lover, please do not fall to your knees“. Schwierig, das nicht zu tun.
Die bereits geforderten Maßnamen gegen zuviel Melancholie im Line-up ließen sich in den Auftritten von Rox und Delphic auf der Hauptbühne wiederfinden. Die junge Britin mit iranischen und jamaikanischen Wurzeln widerlegte die hie und da geäußerte Sorge, ein Indiepop-fixiertes Publikum könne ihrem Gebräu aus Soul, 2Tone-Klängen, Rocksteady-Beats und auch dem ein oder anderen R’n’B-Schunkler Berührungsänste zeigen und lächelte ihre Songs geradezu von der Bühne. Kein Wunder, dass man Rox eine große Karriere vorhersagt – sollte der Soultrain Richtung Mainstream nach all den Winehouses und Duffys oder auch Lenas nicht schon abgefahren sein. Delphic im Anschluss brachten auf der Bühne die Wärme in ihrer Songs, die ihrer doch ein wenig zu Manchester-kühlen Platten ein wenig abgeht. Leider zeigte sich das Haldern-Publikum nicht gerade als Tanzpublikum. Dann schon lieber singen. Und das funktioniert – wie man ja von den ausverkauften Tourneen weiß – beim Familienbetrieb Mumford & Sons (Foto) ganz formidabel. Jene zeigten sich bei einem Interview am früheren Nachmittag bereits in ausgelassener und evtl. leicht bekiffter Stimmung und schwärmten geradezu von diesem Festival, das ihnen schon im letzten Jahr, vor dem Karrierekickstart in Deutschland eine (Spiegelzelt-) Bühne bot. Diese Euphorie berauschte auch ihr leider nur einstündiges Set samt Zuschauer. Sei es bei den Momenten zum Innehalten wie „Awake My Soul“, das eben dieses vollmundige Versprechen einlöste, oder beim „Stadionfolk“ von „Little Lion Man“ – ein Song, der auch durch Heavy Rotation im Radio einfach nicht totzukriegen ist. Schon gar nicht, wenn sich 5.000 Menschen kollektiv eingestehen: „I really fucked it up this time…“. Taten sie nicht. Und auch Zach Condon alias Beirut tat es nicht. Die musikalischen Reisen, die er auf seinen drei Alben vollzog, mochten dort manchmal ein wenig überambitioniert und im Touristenblick gefangen wirken – im Livevortrag jedoch spielten sie ebendiese Skepsis einfach weg.
Den Samstagnachmittag verbrachte man dann, wie man mit Sonnenschein gesegnete Sonntagnachmittage auf dem Haldern ebenso verbringt. Man fläzt auf dem Reitplatz in die Sonne, lässt die Bands vor sich auflaufen und hofft auf Jemanden, der einen von der Picknickdecke reißt und in die ersten Reihen treibt. Im Idealfall – so geschehen bei Fanfarlo und Frightened Rabbit und Efterklang und The Tallest Man On Earth – sieht man dort dann den Gig eines aufgekratzten Acts, der es sichtlich genießt mal im schönsten Sonnenschein vor einem Paar-Tausender-Publikum zu stehen. Wenn dann sogar den lyrisch immer so herrlich mies gelaunten „Frightened Rabbit“ zwischen Songs wie „Swim (Until You Can’t See Land)“ und „Skip The Youth“ geradezu die Sonne aus dem Hintern zu scheinen scheint – dann weiß man, was eine Haldern-Erfahrung sein kann.
Dennoch war die (innerzeltliche) Konkurrenz eine große. Zumindest in Sache Kunst – nicht unbedingt in Sachen Körpergröße. Conor J. O’Brien und sein Villagers lieferten dabei die übergroßen Momente im schwitzigen Spiegelzelt. Sein „Becoming A Jackal“ – seine Verwandlung vom unbedarften und beschützten Kinde zum jaulenden „Schakal“ – war live eine einzige Freude, auch wenn man dort Zeuge wurde, wie er den Verlust der kindlichen Unschuld in überaus erwachsende Songs verarbeitete. Anscheinend wusste auch die musikalische Kollegenschar um O’Briens Können, denn in den ersten Reihen reckte sich nicht nur der Fanfarlo-Sänger den Hals, um einen Blick auf die Bühne zu werfen, auch National-Drummer Bryan Devendorf stand im Hintergrund und applaudierte anerkennend.
Bevor ebenjener Mr. Devendorf für den Headliner-Slot antrat, lieferten Yeasayer aus New York einen weiteren Versuch, der Versuchung der seeligen Behäbigkeit zu entkommen. Was musikalisch gelang – nicht zuletzt durch den „inoffiziell am meisten remixten Song“ (Eigenaussage der Band) „O.N.E.“ oder der Single „Ambling Alp“, in der gar Max Schmeling eine Rolle spielt – denn zündeten die Songs wieder nur in den vorderen Reihen. Anscheinend hatte die neongrün und lila von der Bühne leuchtende, sehr NYC-stylische Band einen schweren Stand bei vielen bodenständigen Indieshirt-Träger.
Es hätte dann mit The National einen grandiosen, spätnächtlichen Ausklang geben sollen, ja müssen – denn The National gelten nicht zu Unrecht als gute bzw. sehr gute bzw. brillante Liveband. Außerdem hatten sie ja schon im Jubiläumsjahr 2008 eine Marke gesetzt. Allein, es sollte nicht sein: Soundprobleme unbekannter Art zerfraßen die erste Hälfte des Sets, ließen die sonst so perfektionisch gespielten Gitarrenmelodien krächzen, verärgerten Gitarrist Aaron Dessner auf’s Unerträgliche und ließen gar die Routine des recht angetrunkenen Frontmanns Matt Berninger schwinden. Statt eines rauschenden Festivalabschlusses sah man also zunächst eine sich ständig entschuldigende Band, fast wütend wirkende Musiker, die mit hektischen Blicken einander suchten, und eine ganz Garnison an Roadies und Bühnentechniker, die im Hintergrund unergründliche Dinge an den Verstärkern taten – die alle nicht zu helfen schienen. Erst bei „Mr. November“, „Fake Empire“ oder dem die Nacht beschließenden „About Today“ konnte man zumindest noch kurz hören, wie diese Band eigentlich zu klingen hat. Das Fazit eines Freundes über das Konzert: „Das war Arbeitsverweigerung. Wie Frankreich bei der WM“. Nun, das ist natürlich eine Spur zu hart – man wusste ja nicht, woher die Probleme rührten und die Band mühte sich redlich – aber dennoch blieb das Gefühl, dass man sich einen anderen Abschluss dieses sonst wie immer pannenfreien, bewegenden Festivals gewünscht hätte.
Daniel Koch
Foto: Reiner Pfisterer