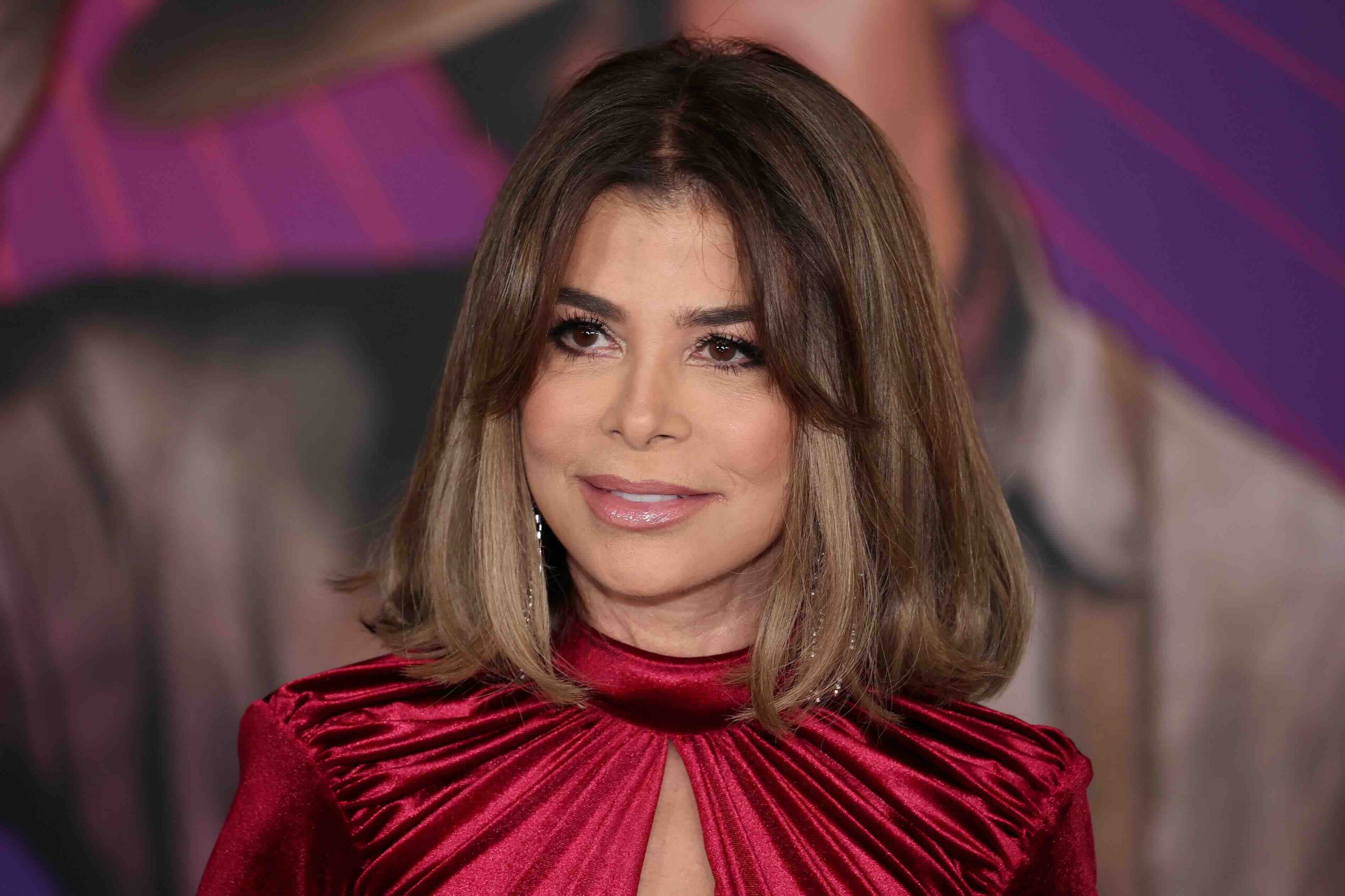Heimkehr des verdorbenen Sohnes
Die stolze ARD leistet sich ab Weihnachten zweimal wöchentlich Harald Schmidt - der bei seinem letzten Engaqeqement fröhlich "Verstehen Sie Spaß?" zerstört hatte
Als Ende Oktober durchsickerte, dass der Hl. Harald Schmidt das deutsche Fernsehen wieder mit einer Show beehren will, fiel ein ganz besonderes Licht auf das angekündigte Datum der Rückkehr. Es sollte der 23. Dezember sein, ein Termin, der gleich in doppelter Hinsicht symbolträchtig wirkte. Zum einen jährt sich erstmals die 1363. und letzte Show bei Sat.l, weshalb insbesondere Fans jenen Tag seither als eine Art Karfreitag der „Late Night Show“ handeln. Zum anderen machte es klar, welche Stellung inzwischen der televisionären Wiedergeburt Schmidts zuerkannt wird. Nach diesem religionsstiftenden Mann kann eben nur noch Einer kommen – und dessen Geburtstag wird ja bekanntlich beinahe allerorten jedes Jahr aufs Neue am 24. Dezember gefeiert.
So etwas fügt sich ganz wunderbar in die – lange vor der kreativen Pause bereits vollzogene -Gottwerdung des berühmten Fernsehschwaben, der seine Gemeinde nichtsdestotrotz für ein langes Jahr entließ ins Tal der Entbehrungen, wo nichts war außer ein paar dürren Dornbüschen, deren Früchte zunehmend weder bitter noch süß, sondern einfach nur – nach gar nichts schmeckten.
Schmidts Abwesenheit war es, die den Blick für den Rest des Fernsehgeschehens schärfte, die deutlich machte, dass da zu später Stunde nicht viel mehr ist ab der Gedanke an die werktäglichen Spät-Audienzen bei His Schmidtness. Anke Engelke versagte kläglich und voraussehbar, während gleichzeitig die schmierlappige Beckmann-Kerner-Kultur immer neue Sendeplätze verkleisterte. Mochte man sich im Januar noch über die Dschungel-Show erregen, so blieb schon im Herbst nur noch ein müdes Schulterzucken und allenfalls die Frage, wen man im australischen Busch nun mehr bemitleiden soll, die vermeintlichen Stars oder die Kakerlaken und Maden, deren Begegnung mit der unverwüsdichen Kodderschnauze und späterhin Dschungel-Königin Desiree Nick fatal endete?
Doch kaum hatte der noch mit Spuren von Resthirn gesegnete Zuschauer die „Late Night“ für abgeschafft erklärt, ist dank Schmidt late back. Nun kommt „er“ wieder – am Ende eines Fernsehjahres voller Flops, in einer Zeit, da man sich abgewöhnt hat, noch irgend etwas vom Medium zu erwarten, in der man sich höchstens die Zeit vertreibt mit Restlustigkeiten wie Olli Dittrichs „Dittsche“ oder Hugo Egon Balders „Genial daneben“.
Was Schmidt mit der ihm von den ARD-Granden abverhandelten halben Stunde am Mittwoch und Donnerstag anfangen wird, ist offen, wird es wohl auch bis zur Premiere bleiben. Es spielt allerdings auch überhaupt keine Rolle.
Konsequent betrachtet, müsste das Konzept zur Show aus einem einzigen Wort bestehen: Schmidt Der Mann ist das Programm, was man bereits bei seinen raren Kabarett-Auftritten in der Provinz erleben durfte, bei denen er locker den Stand-Up-Teil seiner Show auf zwei Stunden dehnte. Es gilt nach wie vor der Lehrsatz, dass dieser Mann auch aus dem Telefonbuch rezitieren könnte, es wäre ein Erfolg. Das haben sich sicherlich auch die Verantwortlichen in der ARD gedacht, die viel Geld auf den Tisch legen und statt einer Traumquote wohl in erster Linie mit einem Achtungserfolg rechnen dürfen. Schließlich hatten sie Schmidt schon mehrfach im Ersten – mit eher bescheidenem Erfolg. Als seine „Kult-Show“ „Schmidteinander“ nach ein paar sehr erfolgreichen Jahren im WDR-Dritten ins Erste wanderte, scheiterte sie dort, und an Schmidts Einsätze bei „Verstehen Sie Spaß?“ erinnern sich die für die Show zuständigen Redakteure auch noch mit Grausen. Selten sah man einen öffentlich-rechtlichen Moderator die ihm anvertraute Sendung derart perfide dekonstruieren.
Dementsprechend bleibt auch diesmal ein dumpfes Gefühl, eine Unsicherheit, die nicht nur in dem bejubelten Star begründet liegt, sondern auch im Publikum. Wird Schmidt wieder auf genau die Zustimmung stoßen, die alle ihm nachgesandten Trauergesänge vermuten lassen? Schon sind erste Stimmen von Skeptikern zu hören, und ein bisschen fühlt es sich an wie nach einer Trennung auf Zeit. Da mag man monatelang den Partner vermisst und beweint haben. Jede Stunde ohne ihn war eine Qual, aber wenn er dann plötzlich wieder mit dem hündischen „Lass es uns noch mal versuchen“-Ausdruck vor der Türe steht, merkt man ja doch ziemlich schnell, dass man sein Leben längst ein wenig anders arrangiert hat -und eigentlich auch allein ganz gut klar kommt
Musikbücher von Wolfgang Doebeling „Inside Out – A Personal History Of Pink Floyd“ (Weidenfeld, ca. 45 Euro) von Nick Mason ist nicht das befürchtete Cash-in und Waters-Bashing, sondern ein nüchternes, zuweilen selbstironisches Resümee eines Mannes, der sich mit passablem und oft genug banalem Trommeln eine goldene Nase verdient hat und sich immer noch darüber wundert. Mason schreibt in einem drolligen, hintergründigen Vexier-Stil und lässt keinerlei Zweifel daran aufkommen, wen er für den schlimmsten Schmarotzer der Floyd-Saga hält: sich selbst. Das erfordert Mut, Einsicht und die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. Besonders auf dem Weg zur Bank. Neue Erkenntnisse bietet das Buch freilich nicht. Syd Barrett kam von seinem letzten Acid-Trip nie wieder zurück, also ignorierte man ihn. Roger Waters war größenwahnsinnig und ist’s vermutlich noch. David Gilmour ist ein guter Junge und Rick Wright war halt auch dabei. Am besten ist Mason, wenn er die frühen Band-Jahre beschreibt und immer wieder auf die Absurdität zu sprechen kommt, dass ein paar Kunst- und Archtitekturstudenten aus gutbürgerlichem Haus Leitfiguren einer Szene wurden, indem sie absurde Hosen trugen und musikalische Seifenblasen produzierten. Das Ende von Floyd und die noch schwelenden Feindschaften erklärt Nick Mason mit Mangel an Kommunikation: „We never acquired the skill of talking to each other.“ Umma? Gumma! 3,5 „The Thrill Of It All – The Story Of Bryan Ferry And Roxy Music“ (Deutsch, ca. 32 Euro) von David ßuckley taugt als Biografie des singenden Pedanten und Parvenüs, nicht als Porträt einer bahnbrechenden Band. Zwar widmet Buckley dem spannungsgeladenen Verhältnis zwischen den Roxy-Polen Ferry und Eno etliche Seiten, doch schrumpft die Gruppe nach Enos abruptem Abgang zu wenig mehr als einer Backing-Band. Dabei wird die Wahrheit weiträumig umgangen, die da heißt: Roxy Music setzten Standards, Bryan Ferry croont Standards. Lesenswert immerhin sind die Ausführungen über Ferrys Jahre in Newcastle und sein frühes Faible für Blues. Ach ja, Ferry mag es nobel. Und hat es dennoch nicht verdient, dass sich sein missratener Sohn Otis als Landjunker aufspielt und für das barbarische Upper-Class-Ritual der Fuchsjagd demonstriert. In everydreamhome a heartache. 3,0 „Wheels Out Of Gear – 2Tone, The Specials And A World In Flames“ (HeiterSkelter, ca. 24 Euro) von Dave Thompson ist bereits das vierte Buch über das Ska-Revival in diesem Jahr, sei hiermit aber als Ergänzungslektüre zum unlängst in dieser Rubrik rezensierten Erinnerungs-Album „Sent From Coventry“ empfohlen. Während sich letzteres in den persönlichen Sichtweisen der damaligen Szene-Protagonisten ergeht, macht sich Thompson die Mühe, ein umfassenderes Bild von Maggie Thatchers England zu zeichnen. Weniger politisch oder gar analytisch, sondern indem er jugendkulturelle Phänomene beschreibt und den brodelnden Melting Pot der Tribes auf seine Ingredenzien untersucht. Rüde Boys, Punks, Rastas, Mods, Teds, Skins und Oi!-Stiernacken begegneten sich auf dem Tanzboden. Eine gefährliche Gemengelage, denn es gab nur zwei Dinge, die alle einte: der Hass auf Maggie. Und mehr davon. 4,0 „Taboo Tunes – A History Of Banned Bands & Censored Songs“ (Backbeat, ca.18 Euro) von Peter Blecha ist ein Rundschlag gegen jede Art von Zensur und staatliche Willkür im Musikbetrieb, mit zahllosen Beispielen, die leider nicht immer stichhaltig sind. Den „Parental Guidance“-Sticker, den Tipper Gores Sauberfrauenverein auf Tonträgern mit „jugendgefährdendem Inhalt“ sehen wollen, brandmarkt Blecha als „America’s biggest witch hunt yet“. Und hinter dem Arger, den sich Linda Ronstadt in Las Vegas einhandelte, weil sie ihrem Publikum Michael Moores „Fahrenheit 9/11“ ans Herz legte, vermutet er gleich eine von Plutokraten finanzierte, konzertierte Aktion konservativer Medien. Verschwörungstheorien. Sinnfälliger sind die Zitate, die der Autor fleißig zusammengetragen hat. Etwa das von Kid Rock, der kundtut, dass es ihm nicht zustehe, die Irak-Politik seines Präsidenten zu kritisieren – „because it isn’t like the president calls my albumshit“. Wer weiß?2,0 „Beautiful Chaos – The Psychedelic Fürs“
(Heiter Skelter, ca. 20 Euro) von Dave Thompson ruft eine Band ins Gedächtnis zurück, die von der Popgeschichte stiefmütterlich behandelt wurde, obschon sie doch ein paar stilund gehaltvolle Platten hinterließ und die ganzen 80er Jahre über medial präsent war. Sie rekrutierten ihre Fans im Vakuum zwischen den Only Ones und Simply Minds, borgten von letzteren das Pathos und von ersteren die Schärfe und garnierten das ganze verschwenderisch mit Bowie-Bezügen. Hier steht, wieso. Hier steht auch: „The Psychedelic Fürs were, of course, phenomenal.“ Manchmal waren sie das.3,0 „PJ Harvey – Siren Singing“ (Omnibus/Bosworth, ca. 25 Euro) von James R. Blandford ist die erste Biografie über die selbstquälerische, hyperempfindsame und bisweilen etwas überkandidelte Künstlerin. Für Fans also unverzichtbar, für den Rest von uns durchaus lesbar.2,5