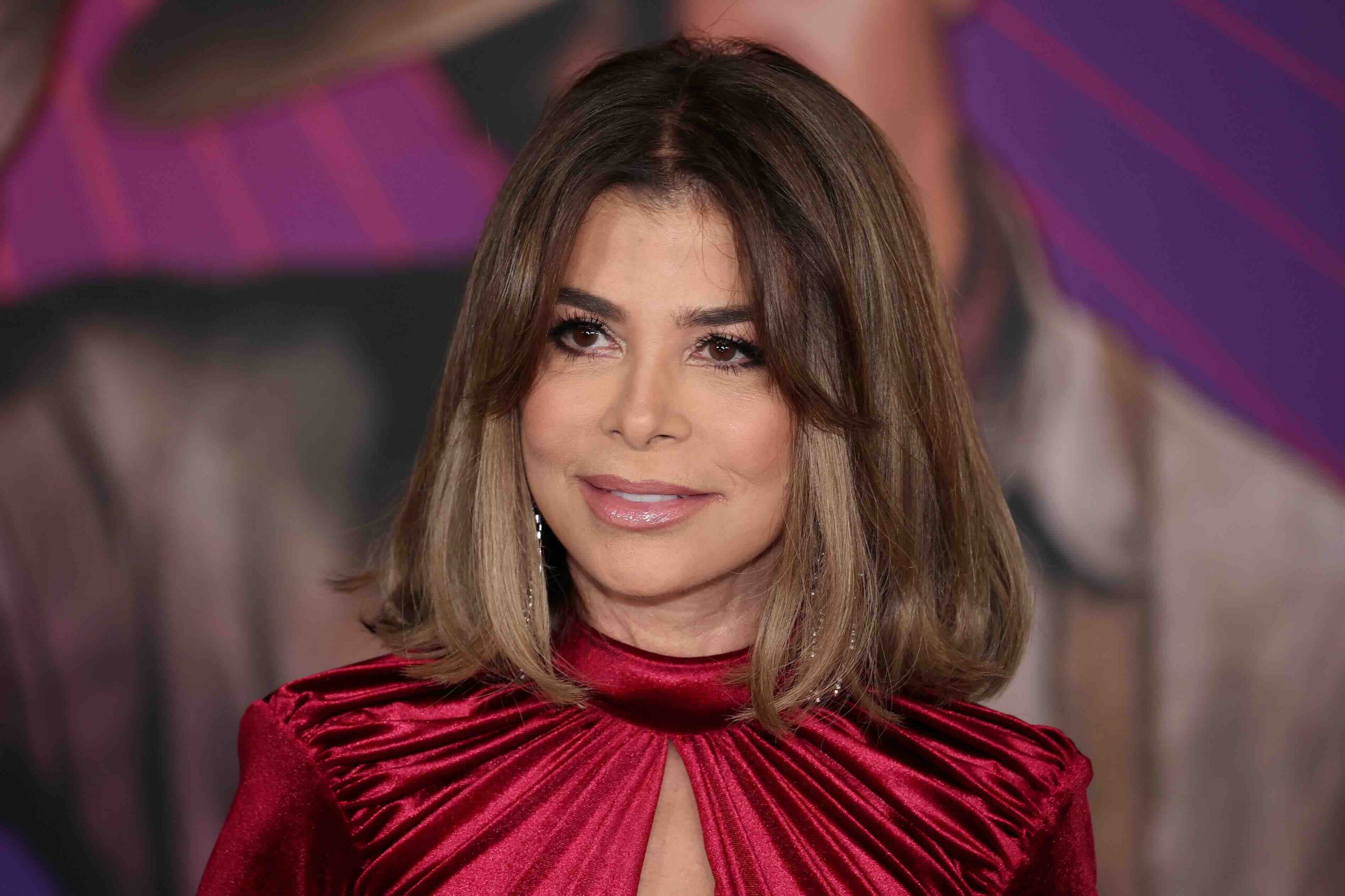Finley Quaye – Vanguard
Mit seinem Debüt-Album „Maverick A Strike“ erwischte Finley Quaye vor drei Jahren daheim im UK einen guten Start und gilt seither als großes Nachwuchstalent und Roots-Reggae-Connaisseur. Album Nr. 2 nun soll die große Nummer werden – Marley, Beck und gar Yorke sind die Bezugspunkte, darunter läuft gar nichts „Vanguard“ soll mit einem breiteren Stilspektrum zeigen, was geht.
Am Anfang des beladenen Albums steht das kuriose „Broadcast“, eine wirre Assoziationsflut über Männer und Bohnen, die den erstaunten Hörer an die Hand nimmt und in das Innere des Quaye-Anwesens geleitet. Von dort schlägt’s einem beim Näherkommen immer geräuschvoller entgegen. „I see you now like I’ve never seen you before/ Taking it further honey, opening all die doors“ singt Quaye zu dräuenden Gitarren – „Spiritualized“ rockt und pumpt, die Hörner hupen atonal und die Tierfelle beben gequält – ganz so, als hätte Quaye mit Reggae rein gar nichts am Hut. Jedes Gefühl“, sagt der Künstler dazu, „braucht seine eigene Umsetzung“, und für das präsente musste es wohl krachen. Ob wir begeistert sind? Ein bisschen vielleicht.
Danach nimmt die Architektur gewohnte Formen an: „The Emperor“ ist ein Reggae alter Schule, „Everybody Knows“ erweitert denselben mit gar nicht uncharmanter Pop- und Soul-Draperie und „Feeling Blue“ vermählt Rastafari-Standards mit Easy-Listening-Verweisen – Quayes Adaptionen der Genres sind freilich eher ein Sprungbrett für den eigenen künstlerischen Ausdruck als eine irgendwie originalgetreue Umsetzung der stilistischen Vorgaben.
Nach einer Weile der entspannten Off-Beats wünscht man sich dann doch zusehends mehr von der angekündigten Eklektik – und wird prompt bedient: „When I Burn Off Into The Distance“ ist ein kleines Lied übers Verschwinden voller hypnotischer Melodien und seltsam betörender Atmosphären, „Chad Valley“ ist wieder so ein Tal zwischen den Liedern, ein komisches Ding aus obskuren Reimen und elektronischem Schnickschnack und, nun ja, ein interessantes Fragment. Hernach klingt gar nichts mehr nach Jamaika; Quaye probiert dieses und jenes, skizziert in „Calender“ mit allerlei Ethno-Trommeln afrikanische Weiten und vermählt in „White Paper“ Hendrix-Gitarren mit Urbanjazz und Breakbeat-Attitüden. Eklektik, fürwahr. Manche halten das schon für die Morgendämmerung einer neuen Epoche.
Den Höhepunkt gibt’s am Schluss: „Hey now where have you been/ You know that I’ve been waiting for you“, singt Quaye in „Hey Now“ so dicht bei sich selbst wie sonst nirgendwo, und das klingt, als gelte die Frage ihm Selbst.