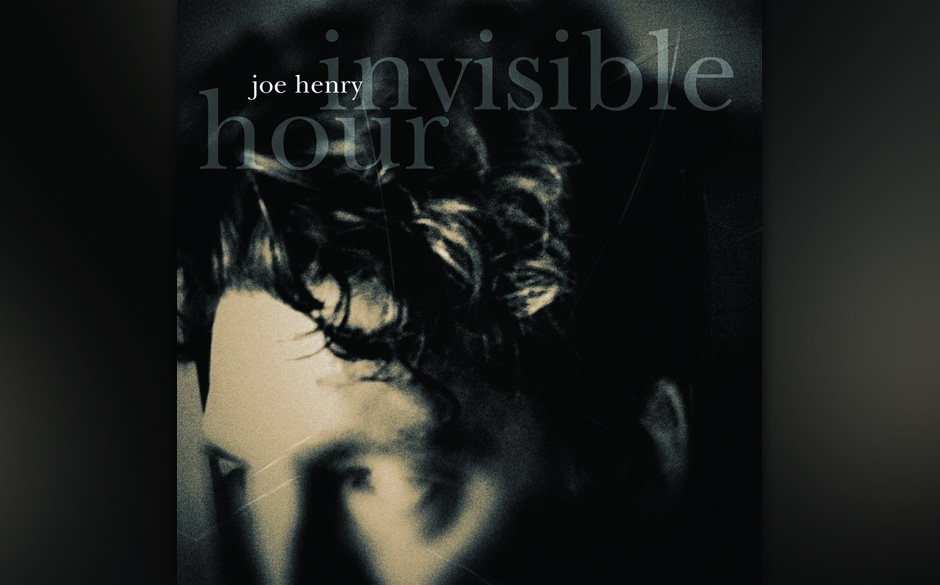Joe Henry :: Invisible Hour
Wenn es heißt, ein Künstler habe sein reifstes Werk vorgelegt, bedeutet das meist nichts Gutes. Denn Reife gleich Zufriedenheit gleich Langeweile, so der häufig geäußerte Kritikerkurzschluss. Nun könnte man auch Joe Henrys neuestes Werk, sein 13. Soloalbum, für langweilig halten. Auf „Blood From Stars“ und „Reverie“ war er noch als geniale Songwriter/Produzenten-Zwiegestalt aufgetreten, der seine Stücke geschmackvoll und mit dem richtigen Gespür für den jeweiligen Stil einzurichten verstand, wenn er nicht gerade Alben von Hugh Laurie, Bonnie Raitt oder zuletzt Billy Bragg in Szene setzte. Ob New-Orleans-Jazz, Depression-Blues, Bluegrass, majestätische Mörderballaden oder Graswurzel-Folk: Nichts war dem Mann fremd, weil er nie zitierte, sondern seine eigene Form der cosmic american music entwarf.
Und doch wirkt all das nun nur wie eine Vorstufe zu den ungleich spontaneren Songs von „Invisible Hour“, das in vier Tagen in Henrys Studio The Garfield House im kalifornischen South Pasadena eingespielt wurde. Der Ton, herabgedimmt und dennoch auf unprätentiöse Art weihevoll, erinnert wahlweise an den mittleren Elvis Costello von „King Of America“ oder den mittelspäten Van Morrison, circa „Hymns To The Silence“. Henrys exquisites Personal um Gitarrist Greg Leisz und Jay Bellerose am Schlagzeug tastet sich vorsichtig an die Songs heran. Bebildert seine ingeniösen Erzählungen. Weiß, dass es hier vor allem um eins geht: Kontemplation. „Sign“ etwa schwingt sich zu einem neunminütigen Trauermarsch auf, eine immer wieder an- und abschwellende Versenkung mit kunstvoll eingeflochtenen Holz- und Blechbläsern, zu dem Henry eine Vater-Sohn-Geschichte von Kindheit, Tod und dem verrückten Lauf der Dinge in glühende Verse gießt. „Plainspeak“ ist ein ergreifendes Liebeslied mit hymnischem Gospel-Refrain, wuselnder Mandoline und liebreizendem Saxofon.
Es dauert ein Weilchen, bis man dieses unfassliche Album verinnerlicht hat – und man begreift, dass es schon jetzt zu den besten des Jahres gehört. Man möchte danach „Days Of Heaven“ von Terrence Malick sehen. Man möchte Richard Fords „Wildlife“ lesen. Und immer wieder „Invisible Hour“ hören.
Max Gösche