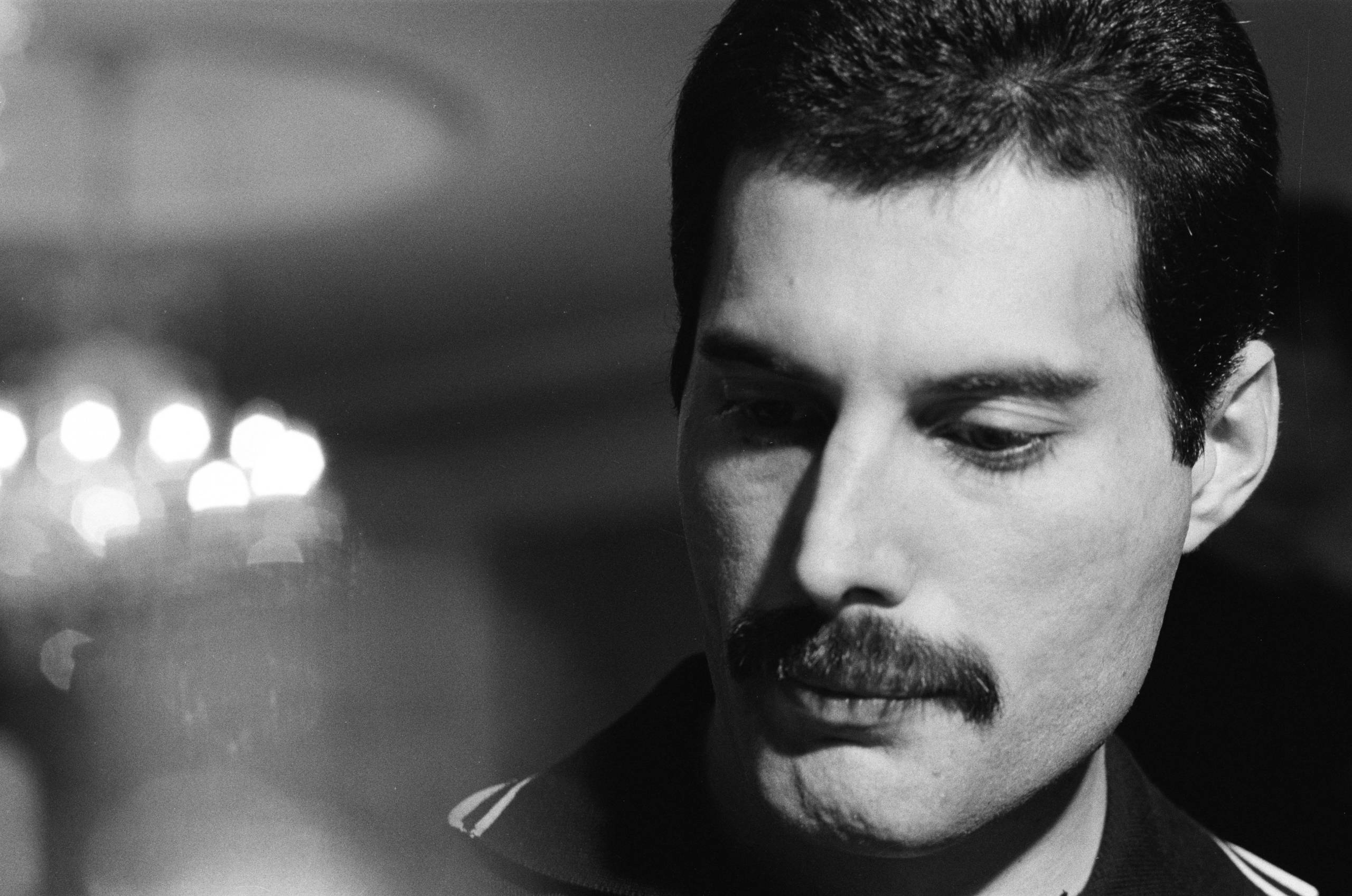Restless :: Regie: Gus van Zandt
Gus van Zant wendet sich in einem poetisch-morbiden Film seinen liebsten Themen zu: Liebe und Vergänglichkeit.
Henry Hopper, Mia Wasikowska
Teenager haben noch eine unverkrampfte Sicht auf den Tod. Nichts ist weiter weg und somit weniger interessant in dieser Phase, die vom reinen, pulsierenden Leben durchdrungen ist. In jener Unendlichkeit erscheint das Sterben wie ein Spiel, das manche voller Unschuld gar mit todessehnsüchtiger Symbolik, ja, ausleben. Im Geiste dieser schwermütigen Leichtigkeit zeigt der amerikanische Regisseur Gus Van Sant die fragile Liebe eines jugendlichen Paares, bei dem das Ende des einen die Erlösung des anderen bedeutet.
Enoch (Henry Hopper) lebt bei einer Tante, seit seine Eltern bei einem Autounfall starben. Er selbst überlebte, obwohl er kurzzeitig für klinisch tot erklärt worden war. Von da an ist jede Lebenslust aus ihm gewichen. Er führt Gespräche mit einem imaginären Freund, dem Geist des japanischen Kamikaze-Piloten Hiroshi (Ryo Kase), verweigert den Schulbesuch und treibt sich vorwiegend auf Beerdigungen herum. Dort fällt der schmale Blondschopf mit dem altmodischen Frack und der Leichenbittermiene der jungen Annabel (Mia Wasikowska) auf, die ihn keck darauf hinweist, dass man heutzutage auf Trauerfeiern fröhliche Klamotten trage. Er ist irritiert von dem Mädchen, das seinem sarkastischen Pseudoschmerz einen fröhlichen Zynismus entgegensetzt. Denn sie hat, wie sie ihm kurz darauf gesteht, einen Hirntumor und nur noch drei Monate zu leben. Es ist der Beginn einer wunderlichen Zuneigung.
Annabel zeichnet Insekten, deren lateinische Namen sie auswendig kennt, ist begeistert von Charles Darwin und bedauert, dass ihr nicht mehr die Zeit bleibt, seine Bücher komplett zu lesen. Stattdessen führt sie Enoch in die Leichenkühlhalle des Kinderkrankenhauses. Er gibt sich cool, doch seine ungerührte Fassade bröckelt langsam. Spätestens von der Probe eines Theaterstücks, in dem sie die Sterbende mimt, wird er völlig überfordert. Das Spiel ist vorbei, die Angst vor dem Tod in ihn gekrochen, unwiderruflich und real.
Die Jugend und der Tod waren immer Themen bei Van Sant, der sich recht sicher zwischen Independentfilmen und Hollywood-Produktionen zu bewegen weiß. In „Drugstore Cowboy“ (1989) machte er Matt Dillon zum Junkie, für „My Own Private Idaho“ (1991) schickte er River Phoenix, der wenig später tatsächlich an einer Überdosis starb, auf den Strich. Dessen Bruder Joaquin ließ sich als Halbstarker in der Satire „To Die For“ (1995) zum Mord am Ehemann von Nicole Kidman verführen.
Nach den eher tröstlichen, konventionelleren Dramen „Good Will Hunting“ und „Forrester – Gefunden“ setzte er seine intensiven Todesbetrachtungen mit „Gerry“, „Elephant“, „Last Days“ über Kurt Cobain und „Paranoid Park“ radikal fort. Selbst „Milk“, seine herausragende Biografie des ersten offen homosexuell lebenden US-Politikers, mündet schließlich im gewaltsamen Ende des Protagonisten.
„Restless“ liegt nun irgendwo dazwischen. Es ist eine etwas andere Romanze, verschroben wie „Harold und Maude“, verträumt wie „Benny & Joon“. Obwohl Van Sant durchaus den Regeln des Mainstreams folgt, gleitet seine exzentrische Außenseiterballade mit schwereloser Sentimentalität immer knapp am Kitsch vorbei.
Henry Hopper hat die teilweise beunruhigende Leinwandpräsenz seines vor anderthalb Jahren verstorbenen Vaters Dennis geerbt und wirkt wie eine Leinwandikone aus ferner Zeit, gemeinsam mit der mit ungewohntem Kurzhaarschnitt durchaus an Mia Farrow erinnernden Mia Wasikowska („Alice im Wunderland“) spielt er dieses seltsame Pärchen mit überzeugender Natürlichkeit. Annabel ersetzt allmählich Hiroshi, weckt in Enoch die Lebenslust, gerade weil er beide verlieren wird.
In drei Monaten, sagt er einmal ohne Ironie, kann man noch viel machen. Diese Leichtigkeit der Melancholie nimmt man nur einem Teenager ab. (Sony)
Entfallene Szenen, Making-of, weitere Features über Darsteller und Dreharbeiten. Interessant ist Gus Van Sants Experiment mit einer Stummfilmversion, die DVD und Blu-ray beiliegt.
Rowan Atkinson, Gillian Anderson
Regie: Oliver Parker
Mit der Figur des Mr. Bean hat Rowan Atkinson eine pantomimische Komik kultiviert, deren liebenswerte Peinlichkeit er 2004 nahtlos auf den Geheimagenten Johnny English übertrug. Der Erfolg der Bond-Persiflage im Kino war wie bei Otto Waalkes‘ jüngsten Triumphen eher mit Nostalgie denn Originalität zu erklären. Bei der Fortsetzung funktioniert dieser Bonus nicht mehr allzu gut. Manche Gags wurden den derben Späßen der aktuellen amerikanischen Komödien angepasst, andere setzen auf Situationskomik in Actionszenen, von denen es diesmal deutlich mehr gibt. Eine Verfolgungsjagd in einem Rollstuhl mit Raketenantrieb ist trotz der Anspielung auf die immer spektakulärer werdenden 007-Gadgets ein lahmer Einfall, der mehr Hektik als Witz verbreitet. An so etwas sind vor einigen Jahren schon die „Inspektor Clouseau“-Neuverfilmungen mit Steve Martin gescheitert. Dabei ist Atkinson noch immer brillant in den ruhigen, ja stummen Momenten – etwa wenn er unter Hypnose mit sich selbst oder an einem Konferenztisch unter den reglosen Blicken der Anwesenden mit der Höhenverstellung seines Stuhls kämpft. Extras: Audiokommentar von Regisseur Oliver Parker und Drehbuchautor Hamish McColl, weitere Szenen. (Universal)
Daniel Craig, Harrison Ford
Regie: Jon Favreau
Ein namenloser Fremder (Daniel Craig) taucht in einem staubigen Prärie-Kaff auf, das der despotische Viehbaron Colonel (Harrison Ford) beherrscht. Statt eines Maschinengewehrs wie einst Django trägt er eine Metallmanschette am Unterarm, die sich als einzige effektive Waffe entpuppt gegen außerirdische Kampfjets, die plötzlich am Himmel auftauchen. Das ist auch schon der ganze Plot dieser missratenen Comic-Verfilmung, an der sich gleich sechs Drehbuchautoren abgearbeitet haben. Favreaus erster Film nach seinen „Iron Man“-Erfolgen bleibt groteskes Stückwerk. Unfreiwillig komisch wirkt es, wenn die Cowboys Flugmaschinen mit dem Lasso einfangen wollen oder wie Bullen bei den Hörnern zu packen versuchen. Craig gibt mit verschwitzter Physis und grimmiger Mimik eine Art Karikatur des Westernhelden. Sam Rockwell, Keith Carradine und Paul Dano bleiben Stichwortgeber für knorrige Sprüche. Und Harrison Ford kann nun mal einfach keinen Bösewicht spielen: jeder noch so gemeine Satz wirkt bei ihm immer noch irgendwie sympathisch. Extras: Audiokommentar, diverse Features. (Paramount)
Orlando Bloom, Milla Jovovich
Regie: Paul W. S. Anderson
Viele Stars und erhebliche Schauwerte bietet Regisseur Anderson in seiner Neuinterpretation des unverwüstlichen Mantel- und-Degen-Romans von Alexandre Dumas auf, dessen Handlung im Kern unverändert ist. Jungspund D’Artagnan (Logan Lerman) wird auf seiner Reise nach Paris von Rochefort (Mads Mikkelsen einmal mehr als Schurke) gedemütigt. Gleich bei seiner Ankunft in der Hauptstadt zettelt er nacheinander ein Duell mit den dünkelhaften Musketieren Athos (Matthew Macfadyen), Porthos (Ray Stevenson) und Aramis (Luke Evans) an, das sich zu einem opulenten Gefecht mit der Garde von Kardinal Richelieu (Christoph Waltz einmal mehr als Über-Schurke) ausweitet. Er verliebt sich in Constance und durchkreuzt mit seinen drei Waffenbrüdern eine Intrige von Richelieu und M’Lady de Winter (Milla Jovovich). Vom Original weicht jedoch Orlando Bloom als eitler, kriegslüsterner Herzog von Buckingham ab, dessen Luftschiffe ein bisschen „Fluch der Karibik“-Flair erzeugen sollen. Und seine Ehefrau Jovovich setzt Anderson mit Martial-Arts-Tritten in barocken Rüschen-Dessous einmal mehr als „Resident Evil“-Amazone ein. So geht vieles durcheinander, reibt man sich verwundert die Augen angesichts unverfrorener Over-The-Top-Effekte, fühlt man sich trotz mangelnder Logik von diesem Fantasy-Abenteuer für die Playstation-Kids aber kurzweilig unterhalten. Den verschmitzten Humor in Richard Lesters Klassiker von 1973 überbietet es indes nicht. Extras: Audiokommentare, Making of, weitere Szenen. (Constantin)
Colin Farrell, Anton Yelchin
Regie: Craig Gillespie
Charlie (Anton Yelchin) ist genervt von seinem neurotischen Kumpel Ed (Christopher Mintz-Plasse), weil der überall Vampire vermutet. Doch eines Tages ist jener verschwunden – und Charlie beschleicht der Verdacht, der attraktive neue Nachbar Jerry (Colin Farrell), für den seine Mutter Jane (Toni Collette) schwärmt, könnte tatsächlich ein Blutsauger sein. „Buffy“-Autor Marti Noxon hat die gleichnamige skurrile Grusel-Komödie von 1985 zum typischen Teen-Horror-Thriller umgedeutet mit meist harmlosem Witz und den gewohnten Spannungs- und Schockmomenten. Regisseur Gillespie, der zuletzt die wundervolle Tragikomödie „Lars und die Frauen“ gedreht hat, ist vor allem am Anfang um Charaktertiefe bemüht. Die Figuren bleiben jedoch Stereotypen. Originell ist lediglich David Tennant als Exorzist in pompöser Heavy-Metal-Montur, der sich jenseits seiner Show in Las Vegas als sarkastischer Feigling erweist. Extras: diverse Features. (Dreamworks)