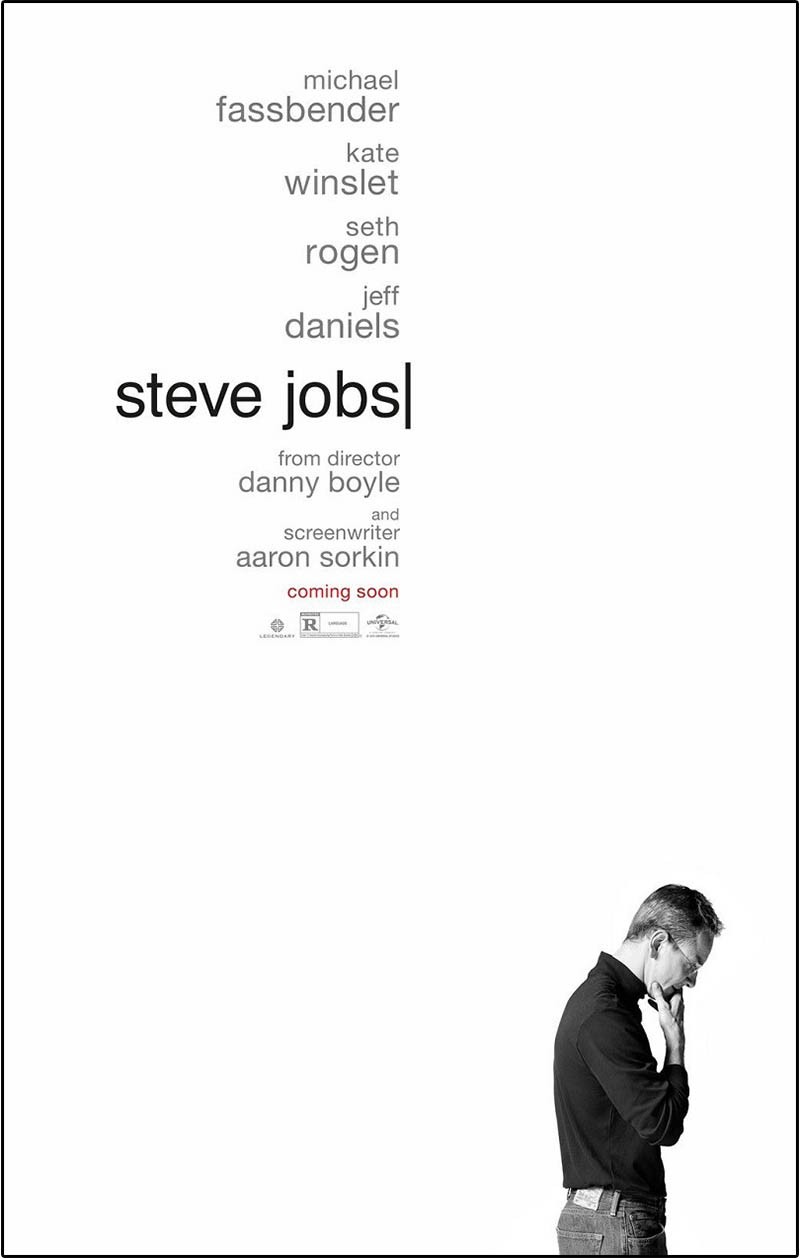Danny Boyle :: Steve Jobs
Ein Biopic als Kammerspiel shakespeareschen Ausmaßes über den visionären Apple-Gründer
Ein Begriff, den man immer mit etwas Vorsicht genießen sollte, wird er doch in inflationärer Weise verwendet: Plötzlich ist immer alles gleich „Kult“. Von der „Kultblondine“ (Katzenberger!) über den „Kult-Rocker“ (Heino!) bis hin zum „Kultgetränk (Hugo!): Alles, was auch nur ansatzweise ein Alleinstellungsmerkmal aufweist, wird gleich vom Kultkanon vereinnahmt.
Die Firma Apple fällt gemeinhin auch unter den Begriff „Kult“, wobei sich die Definition des Begriffs hier wieder in Richtung der ursprünglich religiösen Bedeutung verschiebt. Kaum ein anderer Konzern hat eine derart treue Anhängerschaft und löst mit seinen Produkten einen derart zelebrierten Warenfetischismus aus. Das liegt zum einen an den geschickten Marketingstrategien, aber auch am Mythos um den visionären Apple-Mitbegründer Steve Jobs.
Mit „Steve Jobs“ hat jetzt „Kultregisseur“ Danny Boyle („Trainspotting“) das Leben des „Kultgurus“ auf die Leinwand gebracht. Dabei verzichtet er auf ein braves Aneinanderreihen von Jobs’ Lebensstationen und arrangiert stattdessen seine Biografie um drei seiner Produkte.
1984 stellte Apple den Macintosh vor, der schon im Vorfeld dank eines Werbespots von Ridley Scott ( „Alien“, „Kultfilm“!) in George-Orwell-Optik für Furore sorgte. 1988 präsentierte Jobs, nachdem er ein paar Jahre zuvor von Apple gefeuert worden war, seinen NeXT Computer. Nach seiner Rückkehr ins Unternehmen kam dann 1998 der iMac auf den Markt. Und während das Publikum jedes Mal voller Vorfreude die Plätze einnimmt, kochen hinter der Bühne die Emotionen hoch.
So zumindest Boyles Version. In Echtzeit und mit jeweils zum Jahr passenden Filmmaterial gedreht erzählt diese jeweils die 40 Minuten vor Beginn der drei großen Produktpräsentationen, in denen Jobs – ein wenig wie in Thomas Manns „Lotte in Weimar“ – mit Personen aus seinem Leben konfrontiert wird. Und mit denen geht er nicht gerade zimperlich um. Ziemlich schnell wird klar, dass es Boyle nicht um heroische Beweihräucherung geht, auch wenn der Film auf der autorisierten Jobs-Biografie von Walter Isaacson basiert. Jobs ist hier sowohl smarter Geschäftsmann als auch egomanes Arschloch. In seiner Anspannung vor der Präsentation gerät er mit seinen Weggefährten aneinander, zu denen nicht nur der Mitbegründer Steve Wozniak oder der zeitweilige Apple-CEO John Sculley zählen, sondern auch seine Exgeliebte Chris-ann Brennan und ihre gemeinsame Tochter, Lisa, für die er keinen Unterhalt zahlen will. Jobs befindet sich immer in einem verbalen Duell.
TV-Autor Aaron Sorkin, der auch das Drehbuch für „The Social Network“ schrieb, hat Jobs’ Biografie komplex in diesen drei Situationen verdichtet und zu einem Drama fast shakespeareschen Ausmaßes ausgeweitet. Macht, Gier, Verrat, Feindschaft, Dolchstoß, Arglist, Heimtücke, Größenwahn: All das weht unverhohlen durch die Flure und Backstageräume. Komplett vertraut Boyle der Oral History im Streitgespräch aber dann doch nicht, hin und wieder durchbrechen kurze Flashback-Miniaturen das kammerspielartige Geschehen und liefern ein paar Zusatzinfos aus den Tiefen der mittlerweile ikonografischen Gründungsgarage oder aus Jobs’ ebenso legendärer unmöblierter Wohnung.
Dabei wäre diese Inkonsequenz gar nicht nötig gewesen, denn der Film ist vor allem wegen der fesseln-den Inszenierung der Dialoge sehenswert. Das liegt natürlich auch an Michael Fassbender, der Steve Jobs mit derselben faszinierenden Unbeirrbarkeit spielt wie seinen Macbeth in der aktuellen Neuverfilmung (siehe nächste Seite). Und wenn Fassbender als Jobs mit einem Strauß Callas im Arm auf einem Balkon zufrieden und mit feudaler Arroganz das Einlasstreiben beobachtet, wird mehr als deutlich, dass Ashton Kutcher als Steve Jobs im Film „Jobs“ nur Ashton Kutcher mit Brille und Rollkragenpulli war.
Fassbender zur Seite steht den ganzen Film über Kate Winslet, die hier als Thekla-Carola-Wied-Look-alike ebenfalls zur Höchstform aufläuft. Als Marketingleiterin Joanna Hoffman ist sie die einzige Person, die Jobs Paroli bieten kann. Es sind ihre Aufrichtigkeit und ihre Loyalität ihm gegenüber, die seine tragische Zerrissenheit vollends hervorheben. Und sie ist stets sein Korrektiv, das immer wieder für kurze Momente seine soziale Geschmei-digkeit aufleuchten lassen kann. Denn trotz aller schonungslosen Klarheit ist „Steve Jobs“ weder ein Denkmal für noch eine Demontage des Steve Jobs. Aber es ist ein präziser und kritischer Blick auf eine ehrgeizige Person voller Widersprüche. Passend also für eine Firma, die mit ihren hehren Zielen einerseits und ihren Produktionsbedingungen andererseits den Zwiespalt offen vor sich herträgt.