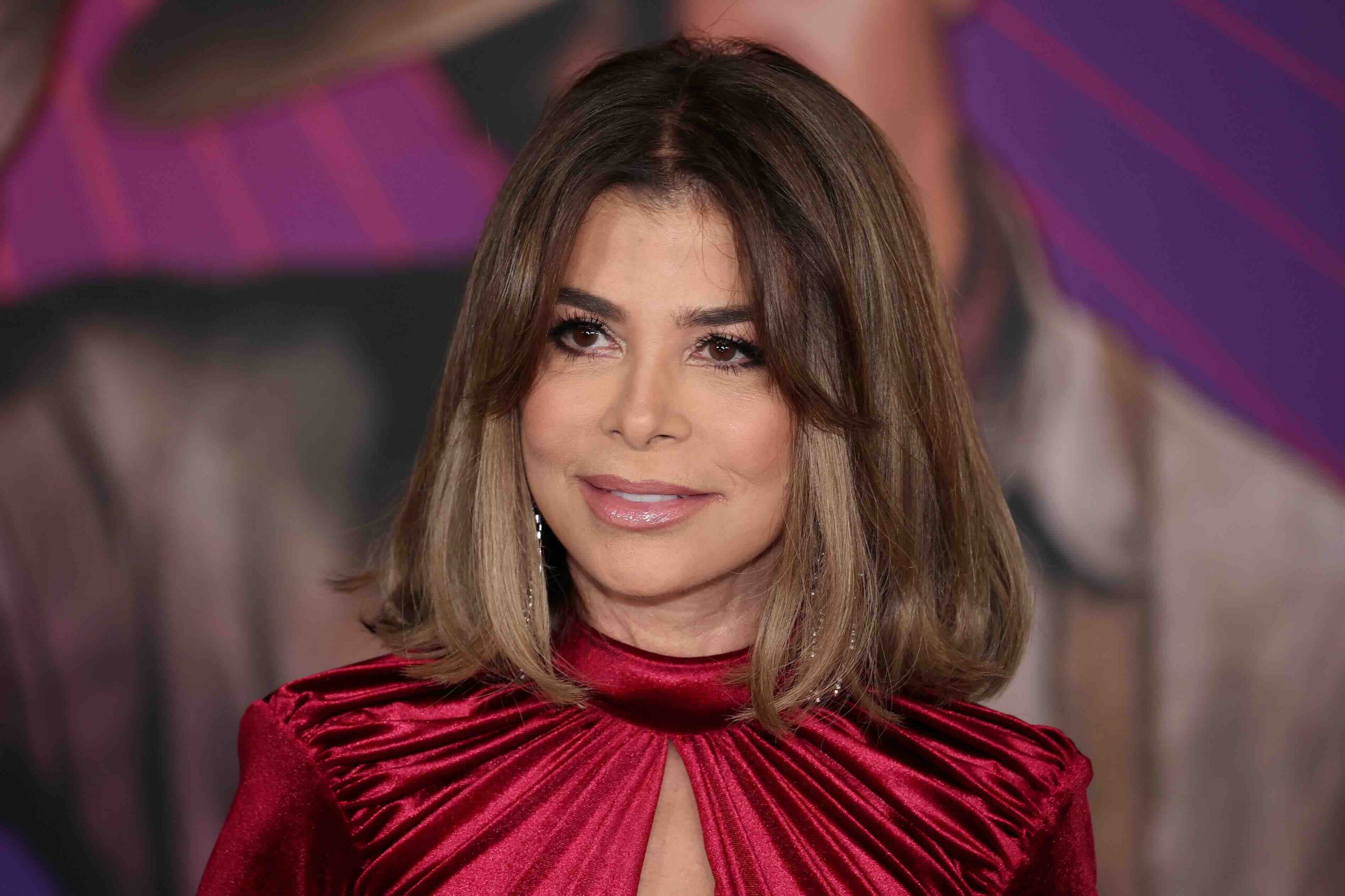The Raid
Ein Waliser verliebt sich in die Martial-Arts: Gareth Evans macht einen Jungsfilm voll brillanter Momente und Old-School-Action
Iko Uwais, Ananda George
Regie: Gareth Evans
„Unsere Mission ist simpel: Wir gehen rein und holen ihn raus.“ So wie der Chef dieser Spezialeinheit der Polizei kann man es natürlich auch sagen. Man stelle sich vor: Ein Haus, eigentlich ein ganzer Wohnblock, 15 Stockwerke purer Beton. In der obersten Etage sitzt ein Mafiaboss, und verbringt seine Zeit damit, verräterische Untergebene mit einem Vorschlaghammer abzuschlachten, und ansonsten auf 16 parallelen Bildschirmen nachzusehen, was im Haus gerade sonst so los ist. Unter dieser Kommandozentrale hat er seine Drogenküche, und darunter zwei Dutzend verschmuddelte Stockwerke voll harter Jungs und abhängiger Sozialfälle.
Ganz unten vor dem Haus stehen jetzt die Polizisten und müssen rein. Nicht mit dem Aufzug, den sollte man in diesem Fall besser nicht benutzen. Man kommt hier durchs Treppenhaus. Stockwerk für Stockwerk, immer wieder die Rufe „Sauber!“, „Rechte Seite sauber!“, „Gang B, klar“. Das SWAT-Team ist gut ausgerüstet mit Helmen, Zielfernrohren und schusssicheren Westen und arbeitet professionell. Alles läuft etwas zu glatt, Kino als Feier der Effizienz, kalte Eleganz der Staatsmacht wie einer ultramobilen Handkamera (Matt Flannery).
Dann, man befindet sich gerade im sechsten Stock, und ziemlich punktgenau in Minute 15 des Films, erwischen die Polizisten einen halbwüchsigen Bewohner zwei Zehntelsekunden zu spät und es erschallt sein langer greller Ruf: „Poliiiizeeeeiiii!!!“ In Minute 30 stellt die rechte Hand des Gangsterbosses fest: „Jetzt wissen wir, mit wem wir es zu tun haben.“ Die knappe Viertelstunde zwischen beiden Rufen gehört zum allerbesten, was das vergangene Kinojahr zu bieten hatte – in wenigen Minuten ändert sich die Lage komplett: Das Gebäude wird ein weiteres Mal umstellt, nun von Gangstern; Ausgänge und Fenster werden von Scharfschützen abgedeckt, und die Polizeieinheit bis auf ein gutes halbes Dutzend Leute dezimiert – mit Feuerwaffen, Buschmessern, bloßen Fäusten.
Nach Ende dieser schrecklichen, großartigen Viertelstunde schlägt der überlebende Rest dann erstmals zurück: Ein Kühlschrank wird mit einer Gasflasche gefüllt, mit einer scharfen Handgranate gespickt, und in einen Gang voller Angreifer geschoben … Man macht hier keine Gefangenen, auch der Film nicht. Und großartige Einzelmomente – mit einer Axt durch den Boden in die Etage darunter, die Selbstbefreiung eines gefesselten Gangsters, die Wohnungsdurchsuchung durch eine Gangstertruppe, die die Hohlräume in der Wand nicht etwa schnöde mit einer MP-Salve perforieren, sondern liebevoll mit Buschmessern spicken – bündeln sich immer wieder zu reinem geschmeidigen Bewegungskino, einem Ballett der Gewalt ohne Worte, so schön wie die Killer-Opern von John Woo, so roh brutal wie ein John-Carpenter-Film aus den 80er-Jahren. Wer hätte gedacht, wie viele Wege es geben kann, zu sterben?
Dieser aufgepumpte, manchmal grobe, manchmal halbstarke, oft überraschende und immer mal geniale Jungsfilm beginnt ganz ruhig. Eine Uhr tickt, ein Mann sammelt sich zum islamischen Morgengebet: „Gelobt sei Gott …“ Dann bearbeitet er einen Sandsack, und verabschiedet sich von seiner Frau. Der fromme Mann heißt Rama und wird einer der wenigen Überlebenden des Gebäudesturms sein. Gespielt wird er von Iko Uwais, einem der neuen Stars des südostasiatischen Action-Kinos und praktizierendem Profi des indonesisch-malayischen Pencak Silat genannten Kampfsports. Auch andere Hauptfiguren werden von Athleten gespielt.
In immer neuen Stationen führt der Weg Ramas und seiner schwindenden Kollegenschar durch die Mausefalle, in die sie geraten sind. Weil der Weg nach unten versperrt ist, geht es nach oben, hinein in die geheime Schaltzentrale dieses Höllenhauses. Ein Hauch von „Resident Evil“ und „Cube“ bestimmt diese nur gegen Ende etwas redundanten Passagen. Längst hat sich das Gebäude in einen klaustrophobischen Dschungel verwandelt und so konstruiert und märchenhaft das Grundszenario ist, so hardcore-realistisch sind die Details, von der Einrichtung der Appartementwohnung, die Polizei wie Gangster durchkämmen, über die Kämpfe bis hin zu den Identitäten beider Seiten. Denn schon früh ahnt man, dass hier viele korrupt sind, und nicht jeder ist, was er scheint.
Bizarrerweise stammt dieser Film, der so wirkt wie die Kreuzung der 80er-Jahre-Hongkong-New-Wave mit indonesischem Martial-Arts, von einem Waliser: Gareth Evans hat sich in indonesische Kultur und die Silat-Martial-Arts, nun ja: verliebt. Bereits sein Debütfilm, „Merantau“, war 2009 ein asiatischer Hit, „The Raid: Redemption“ begeisterte in Sundance und Toronto das westliche Publikum mit glamouröser Old-School-Action, voller Körperlichkeit und Gravität.
Rüdiger Suchsland