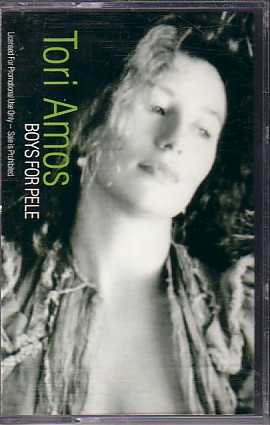Tori Amos – Boys For Pele :: Tori Arnos
tastwest Wundersame Tori. Was treibt sie, was hat Besitz ergriffen von ihr, warum leidet sie so? Denkt sie, mit dem großen Harald Schmidt: „Suffering is fun“? Ist das Patriarchat schuld an ihrer Pein? Hat ihr der Klavierunterricht im bildungsbürgerlichen Elternhaus irreparablen Schaden zugefügt? Oder wie sonst ensteht eine krumme Biographie, die cjua schmetterlingshafter Verwandlung vom Heavy-Metal-Ledermäuschen zur heikelsten Songschreiberin – gleich nach Frau PollyHarvey- fuhrt? Es mag eine Initiation gegeben haben, die Tori Arnos in dem hinreichend besprochenen Song „Me And A Gun“ beschrieben hat. Den spielte sie schon im Vorprogramm eines gewissen Marc Cohn, als sie erstmals in Deutschland auftrat und ihr Coming-out als Emotions-Extremistin, „Little Earthqtutkes“, präludierte. Cohn ist fast vergessen, die barfußige Tori am Klavier aber hat sich als Mirakel etabliert. Und wird schrulliger noch. Legende sind ihre Seancen mit empfindsamen Musikjournalisten, denen sie beherzt zu Leibe rückt und missionarisch immer auf der Schnittstelle zwiTOMTRÄGER Im Märzsehen Psychotherapeutin und verstörter Patientin – alles, alles erzählen möchte. Dabei interessieren sie nicht die Halbstunden-Rhythmen von Interview-Parcours und nicht die hektische Betriebsamkeit der Plattenfirmen-Betreuerinnen („Tori kauft noch Obst, ach“), und wenn sie sich gymnastisch auf dem Sofa lümmelt, brechen die Assoziationen aus ihr heraus. „Ich gebe dir eine Menge Stoff“, verkündet sie lüstern-verschmitzt, und tatsächlich: Fragen braucht es nicht, Tori ist jederzeit performing artist und erste Interpretin ihrer Kunst zugleich. Ist die Zeit um, bedauert sie: „So, nun willst du noch viel wissen. Komm zum Konzert!“ Dort ist ihr eigentlicher Ort: Unvergessen, wie sie – schon vor Cobains Tod – „Smells Like Teen Spirit“ zur schwarzen Piano-Elegie umarbeitete, wie ihre Füße arbeiten und all die Zerrissenheiten strukturieren. Tori Arnos gibt dem Publikum eine Menge Stoff, mehr, als ihm zuzumuten ist – und ist dennoch erfolgreich damit. Sogar in der amerikanischen Heimat thront Tori souverän zwischen dem letzten Blockbuster-Soundtrack und der ondulierten Sensible-Frauen-mit-dem-Herzauf-dem-richtigen-Fleck-Liga (Reba McEntire, Joan Osborne, Alanis Morissette): eine Berserkerin, eine Furie, eine Undurchschaubare. Im Zweifel sind alle gegen sie: die Feministinnen, weil sie unterstellen, daß die Arnos die Männer nicht nur wirklich mag, sondern auch als Projektionsfläche für alles mögliche taugt (was stimmt); die Männer, weil hier gar kein hübsches Frauenklischee greift (was schmerzt); die Rock-Fraktion, weil dieses Klaviergeklimper, dieser exaltierte Gesang so nerven (was manchmal stimmt und schmerzt). Aber man wird sie nicht mehr los. „Boys For Pete“ ist das dritte Album, und nein, der Titel hat nichts mit dem Fußballgott zu tun, sondern mit einer Vulkangöttin, und die Hermeneutiker bleiben gleich dabei und grübeln über verborgene Bedeutungen dieses Rätselspruches. Vorschläge bitte an die Redaktionsadresse. Auf dem Cover sitzt Tori, notdürftig bedeckt, im Schaukelstuhl auf der Veranda, und im Schoß ruht – eine Flinte! Obacht, diese Frau ist zum Schießen. Und auf der Rückseite, da hört es auf, drückt sie ein Ferkel an die Brust, und ihre Hand ruht – im Schritt! „I got me some horses/ To ride on/ To ride on/ They say diät your demons/ Can’t go there“, eröffnet sie den Reigen nach der Miniatur „Beauty Queen„, und mehr denn je erinnert sie an Kate Bush, die Übermutter des apart Überkandidelten. Und diesmal gibt es auch kein freundliches „Cornflake Girl“, das durch die Neurosen-Menagerie tänzelt. „Blood Roses“, „Father Lueifer“ (“ You never looked so sane“), „Professional Widow“ – und die furiosen Zeilen: „Starfucker, just like my daddy.“ Niemand weiß, wovon solche Lieder handeln, aber sie lassen sich schön zitieren. Das bringt Arnos den Vorwurf ein, sfe formuliere kalkuliert kryptisch, sie borge Emotionen und Erfahrungen, sie verrühre Poesie zu einem undurchdringlichen Gemisch aus Religion, Sexualität und Mystik. Das ist die Wahrheit, und wahr ist auch, daß 18 Songs zuviel sind. Kaum ein Kristallisationspunkt schält sich aus den mäandrierenden, vom letzten Pop-Rudiment bereinigten Kompositionen. Endgültig schreibt Tori Arnos keine Lieder mehr, wie sie im Radio zu hören, im Musik-Fernsehen zu betrachten sind: Tori singt nur für sich selbst, in einer wogenden, hochempfindlichen Suada, bei der man anklopfen möchte, um zu fragen: ,,’tschuldigung, darf ich mal kurz stören?“ Das Hermetische, die Selbsttherapie und Feier des Sibyllinischen ist Musik geworden, die Luft dünn, der Raum eng. Am Bösendorfer regiert die Einsamkeit Einige Lieder hat Arnos in einer Kirche aufgenommen, andere „in a wonderful Georgian house in Ireland“ – und beides, das Sakrale und das Rustikale, schafft eine Abgrenzung, die sich der Isolation nähert. Metaphernselig schwelgt die Artistin in imaginierten, solipsistischen Welten, ruft Jupiter an und den Voodoo-Priester. Natürlich sind es Akte des Exorzismus, aber autobiographisch ist diese erratische Lyrik kaum je. „Boys For Pele“ krankt an der Überinstrumentierung, der Überanstrengung der Mittel: So viele Worte, so wenig Konkretion; so viel Gefühl, so wenig Reflexion. Der Ökonomie der Komposition, die Polly Harveys Lieder ganz und gar unabweisbar macht, setzt Tori Arnos eine quälende Quantität entgegen. Einen Focus für Tori! Arne Willander