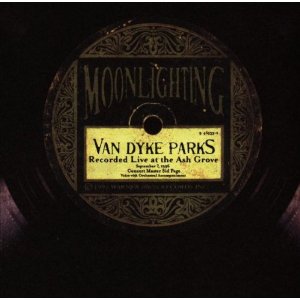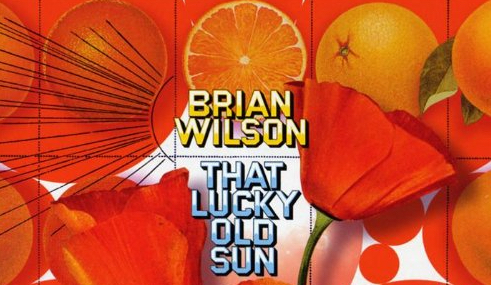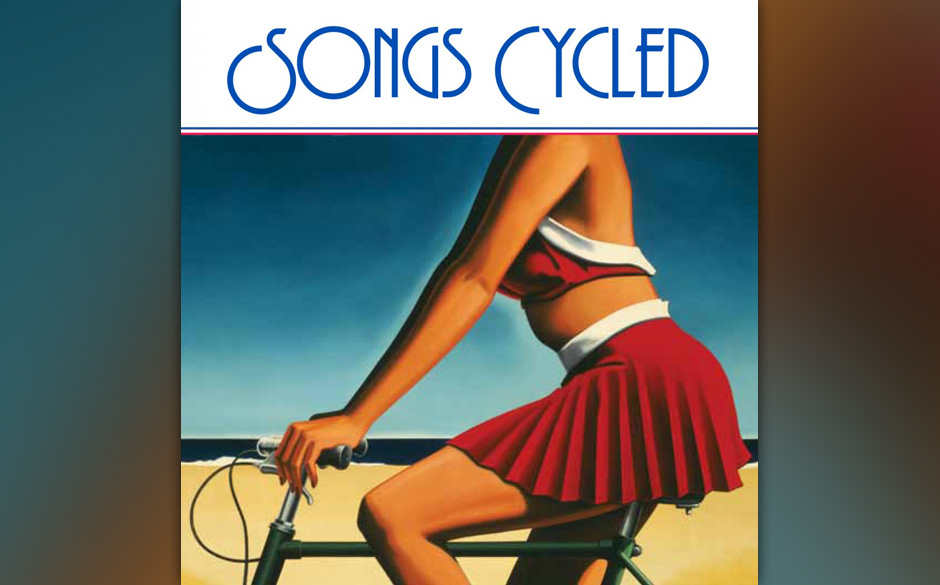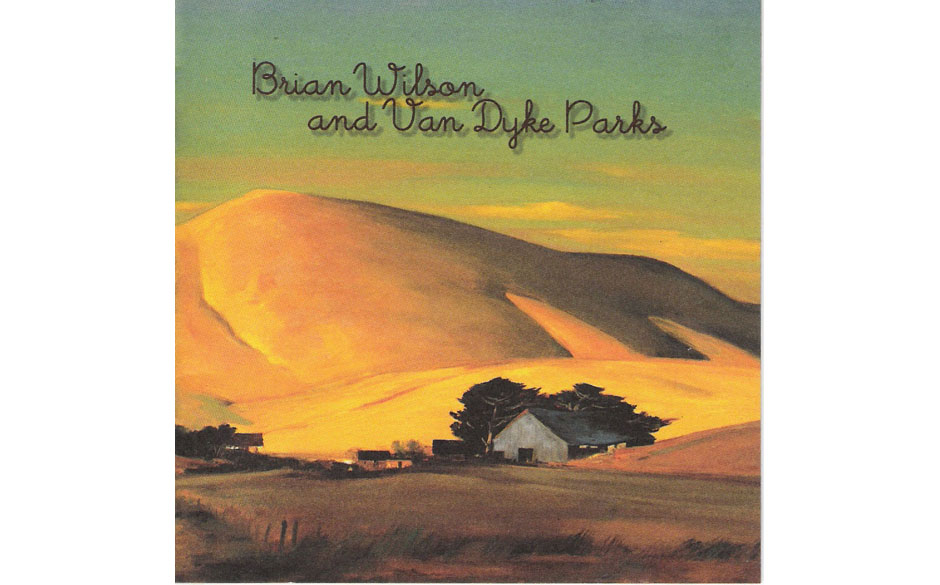Van Dyke Parks – Moonlighting
Van Dyke Parks sei ein schrulliger, alter Kauz. Hört man oft. Doch guck‘ mal, wer da spricht: Anwälte und Apparatschiks. Corporute scutn, würde Henry Rollins sagen, doch würde ihm Parks sofort widersprechen. Nein, würde Van Dyke sagen, diese Leute tun nur ihren Job, und daß sie nur einen Zugang zu Musik haben, den der Verwertung nämlich, muß sie menschlich nicht diskreditieren. Van Dyke Parks ist ein milder Charakter, ein nachdenklicher und nachsichtiger Mann. Und er besitzt mehr Realitätssinn und definitiv mehr gesunden Menschenverstand als die Anwälte und Apparatschiks, die bei Warner Brothers in Burbank, California, derzeit das Sagen haben und die ihren größten und großmütigsten Künstler vor nicht allzu langer Zeit noch als „the oldest thing on the label“ schmähten. Doch, gesteht Parks, das habe ihn schon tief getroffen, doch sei es halb so schlimm, wenn man wisse, woher diese Geringschätzung komme.
Parks kennt sich aus im Biz wie kaum ein anderer Kollege. Seit nunmehr dreißig Jahren studiert er die einschlägigen Copyright-Gesetze und Abrechnungspraktiken der Plattenfirmen und kommt, sagt er, aus dem Staunen noch immer nicht heraus. Höchst unbequem ist so einer natürlich, erst recht in einer Branche, die nicht schlecht davon lebt, den Leuten ein X für ein U vorzumachen. Da hat man den Ruf eines Quertreibers schnell weg. Halten wir fest: Van Dyke Parks ist weder schrullig, noch ein Kauz. Er ist ein genialischer, musikalischen wie zeitgeistigen Kompromissen abgeneigter Künstler; ein Original, eines der letzten.
Live aufgenommen im Ash Grove zu Los Angeles im September 1996, hätte JMoonlightmg“ bereits vor einem Jahr erscheinen sollen, doch ist es schon beinahe ein Wunder, daß es nach etlichem hin und her nun überhaupt erschienen ist. Freuen wir uns einfach darüber. Das dürfte nicht schwerfallen, sofern man schon zu den Eingeweihten gehört oder doch zu denen, die offene Ohren haben und an open mind. Oder doch wenigstens die nötige Neugier, die Parks’sche Galaxis zu bereisen. Es ist ein Kontinuum, wo nicht mit großen Gefühlen gegeizt wird, wo noch in denselben Harmonien geschwelgt wird wie zur Jahrhundertwende, wo eine Ode an die Schönheit noch selbstverständliches Bedürfnis ist und frei von falschem Pathos. Es ist ein paralleles Universum, wo Geigen zirpen, Celli schwirren und Harten heimeln, ein Ort, wo alles Laute, Läppische und Vulgäre verpönt ist.
Schade nur, daß von den zwei Konzerten, die der Charmeur damals im Herbst 1996 gab, dieses konserviert wurde. Das andere hatte einige Wochen später in Den Haag stattgefunden und war noch mehr Zelebration, noch mehr Streicher und Esprit. Auch die Sangeskunst des Meisters war nach Jahren der Abstinenz gefestigter, klarer, schmetternder gar. Er möge seine Gesangsstimme eigentlich nicht, verlautbarte Parks seinerzeit, und tatsächlich geht seine Stimme auf“Afocwlighting“ noch auf Nummer sicher, wo sie in Den Haag schon hier und da Überschwang verriet und kleine Kapriolen schlug. Dieser Unterschied zwischen Zaudern und Zutrauen mag marginal sein und vielleicht bilde ich
ihn mir nur ein, doch scheint der Druck der „Uraufführung“ in Verbindung mit den laufenden Tapes dem Künstler ein wenig zuviel Konzentration aufzufordern.
Hinzu kommt, daß das spätere Konzert mit jüngeren Musikern mehr auf den Faktor Swing setzte, und daß im Ash Grove einige Songs entweder nicht zur Aufführung kamen oder es nicht auf die Platte schafften, so etwa „Hard Times“ oder „Another Dream“. Sonst ist freilich alles da: John Hartfords „Delta Queen Waltz“, „Orange Crate Art“, „Cowboy“, Jump!“, dazu „Sailin‘ Shoes“ als Tribut an Lowell George und „The All Golden“, Parks‘ frühe Verneigung vor Steve bung, der im Ash Grove das Vorprogramm bestritt, der ebensolange wie Parks wunderbare Musik macht und dem ebenfalls das Etikett anhaftet, eigenbrötlerisch und unvermarktbar zu sein.
Dazwischen rezitiert Parks ein Gedicht von Robert Frost, frotzelt über den Zeitungeist, erinnert an die profanen Wonnen eines Wochenendes in unberührter Natur, alles mit linder Ironie und delikatem Sarkasmus, nie fatigant Und man solle doch die alte Maxime nicht vergessen: „think Yiddish, speak British“. Darüber müssen wir erst mal brüten.
Nothing comes easy. 4,0