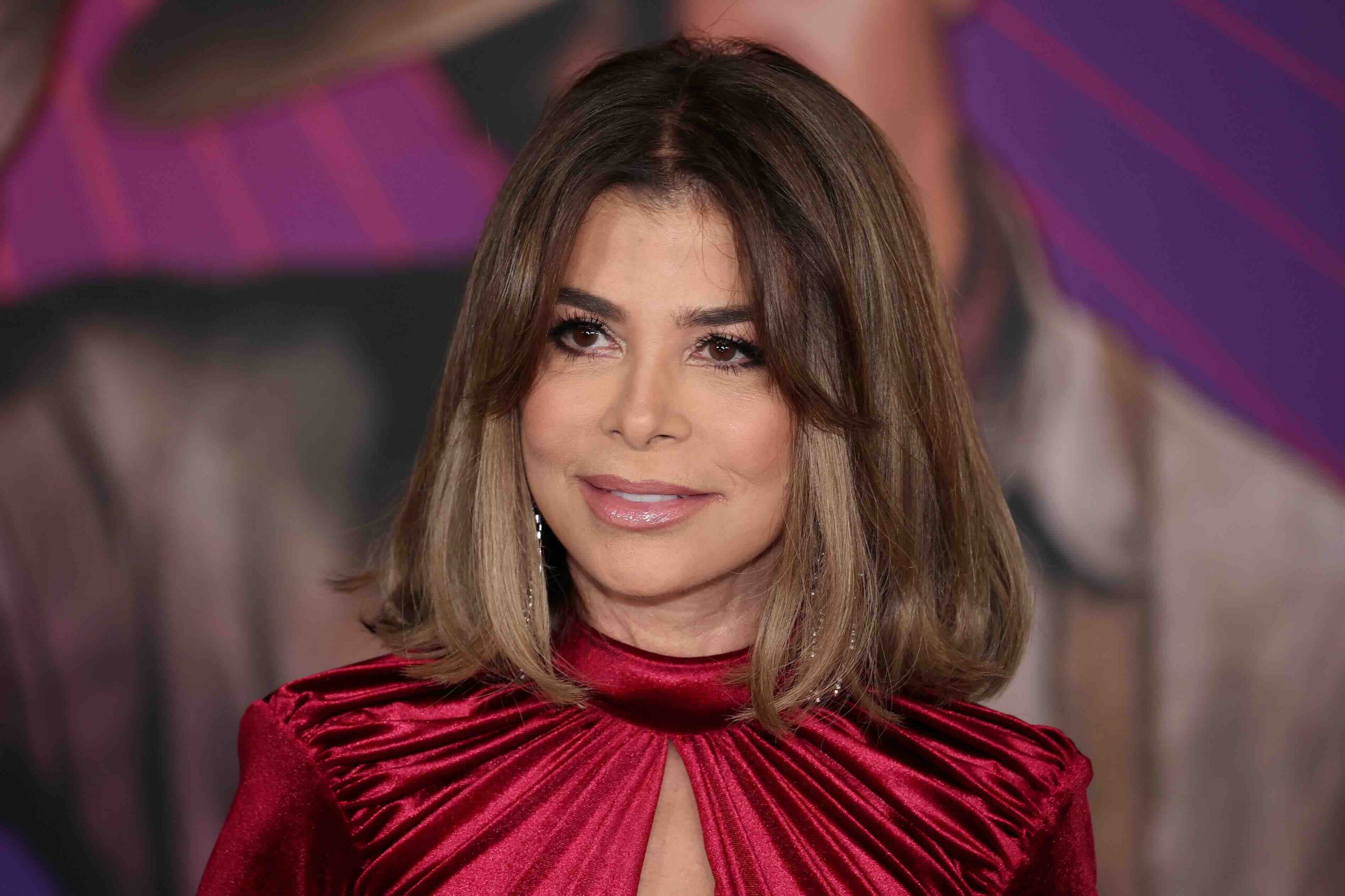„The Runaway General“ – General außer Kontrolle
Die Reportage von Michael Hastings über Stanley McChrystal in gekürzter Form. Übersetzung: Bernd Gockel.
Musikmagazin kickt Nato-Oberbefehlshaber aus dem Amt. So könnte man polemisch die Folgen der Rolling Stone-Reportage „The Runaway General“ von Michael Hastings zusammenfassen. Der Artikel, der den nun ehemaligen Nato-Oberbefehlshaber in Afghanistan, Stanley McChrystal, portraitiert, missfiel US-Präsident Obama dermaßen, dass dieser gestern zunächst McChrystal zum Rapport bestellte und ihn anschließend des Amtes enthob. Beziehungsweise: Obama „akzeptierte McChrystals Rücktritt“, wie es im offiziellen Sprech hieß. Wie bereits gestern berichtet, haben die amerikanischen Kollegen den Text, der erst am Freitag regulär in gedruckter Form erscheint, bereits komplett online gestellt. Mittlerweile hat sich auch der Autor Michael Hastings in einem Blogeintrag aus Kandahar gemeldet – den man hier nachlesen kann. Allerdings sollte man ergänzend hinzufügen, das Hastings da noch nicht wusste, dass McChrystal nicht mehr im Amt ist.
Wir haben aus aktuellem Anlass unseren Übersetzer Bernd Gockel um die Nacht gebracht, damit er den Artikel in gekürzter Form für uns ins Deutsche übersetzt. Den vollständigen Originaltext kann man nach wie vor hier lesen.
GENERAL AUSSER KONTROLLE von Michael Hastings
Stanley McChrystal, Obamas oberster Befehlshaber in Afghanistan, übernahm das Kommando, ohne dabei die wirklichen Feinde aus dem Auge zu verlieren: die Schlappschwänze im Weißen Haus.
„Wer hat mir dieses Dinner eingebrockt?“, fragt General Stanley McChrystal. Es ist Donnerstagabend Mitte April, und der Kommandeur der US- und NATO-Truppen in Afghanistan sitzt in der Vier-Sterne-Suite des Hotel Westminster in Paris. Er ist in Frankreich, um den NATO-Partnern die neue Strategie zu erläutern – anders gesagt: um den Schein aufrecht zu erhalten, dass die USA überhaupt noch Allierte haben. Seit McChrystal vor einem Jahr seinen Job übernahm, ist der Krieg in Afghanistan der private Spielplatz der Vereinigten Staaten geworden. Der Widerstand gegen den Krieg hat bereits der niederländischen Regierung den Kopf gekostet, hat indirekt den deutschen Präsidenten zum Rücktritt veranlasst und Kanada und die Niederlande dazu gebracht, ihre 4500 Soldaten zurückzuordern. McChrystal ist nach Paris gekommen, um zumindest die Franzosen, die bislang 40 gefallene Soldaten zu beklagen haben, bei der Stange zu halten.
„Das Dinner kommt nun mal mit der Position“, sagt sein Stabschef, Col. Charlie Flynn.
McChrystal dreht sich ruckartig in seinem Stuhl um. „Hey Charlie, kommt das auch mit der Position?“ McChrystal zeigt ihm den Stinkefinger.
Der General steht auf und und blickt sich in dem Raum um, den seine zehnköpfige Reisegruppe in ein funktionstüchtiges Kontrollcenter verwandelt haben. Überall auf den Tischen liegen silberne „Panasonic Toughbooks“, auf dem Teppichboden wuchern blaue Kabel, die mit Satellitenschüsseln verbunden sind, um verschlüsselte Telefonate und E-Mails zu empfangen. McChrystal, zivil gekleidet mit Hemd, blauer Krawatte und Anzughose, fühlt sich sichtlich unwohl in seiner Haut. Der General hasst feine Restaurants und lehnt Lokale mit Kerzenlicht grundsätzlich als „zu Gucci“ ab. Er trinkt lieber ein „Bud Light Lime“ als Bordeaux, sieht lieber „Ricky Bobby – König der Rennfahrer“ als jeden Film von Godard – und fühlt sich in der Öffentlichkeit ohnehin alles andere als wohl. Bevor ihn Obama nach Afghanistan beorderte, leitete er im Pentagon fünf Jahre lang die Abteilung für verdeckte Operationen.
„Was gibt es Neues zu den Bombenanschlägen in Kandahar?“, fragt er Flynn. Allein gestern wurde die Stadt von zwei verheerenden Autobomben aufgeschreckt, die die Prognose des Generals in Frage zu stellen scheinen, die Taliban aus der Stadt vertreiben zu können.
„Wir haben zwei KIAs (killed in action), aber noch keine offizielle Bestätigung“, sagt Flynn.
Der General lässt noch einmal seinen Blick über den Raum gleiten. Er ist 55, drahtig und hager – und könnte als eine reifere Version von Christian Bale in „Rescue Dawn“ durchgehen. Seine schieferblauen Augen haben die beunruhigende Eigenschaft, sich in jeden hineinzubohren, den er anschaut. Wer Scheiße baut oder ihn enttäuscht, muss damit rechnen, dass McChrystal seine Seele zur Hölle schickt, ohne auch nur ein lautes Wort zu sagen.
„Ich würde mir lieber von der versammelten Mannschaft in den Arsch treten lassen als zu diesem Dinner zu gehen“, sagt er. „Dummerweise hat keiner in diesem Raum das Talent dazu.“ Und verschwindet durch die Tür.
„Mit wem geht er denn eigentlich zum Dinner?“, frage ich einen seiner Assistenten.
„Mit irgendeinem französischen Minister“, sagt er mir. „Alles so verdammt etepetete.“
Am nächsten Morgen bereiten sich McChrystal und sein Team auf eine Rede vor, die er in der „École Militaire“ zu halten hat. Der General bildet sich viel darauf ein, mehr Mumm und Eier zu haben als alle anderen, doch seine Unverfrorenheit hat ihren Preis: Obwohl er erst ein Jahr im Amt ist, hat er so ziemlich jeden gegen sich aufgebracht, der mit dem Thema Afghanistan beschäftigt ist. Im vergangenen Herbst, bei einem Pressegespräch in London, bezeichnete er die „Counter-Terrorism“-Strategie von Vize-Präsident Biden als „kurzsichtig“ und erklärte, sie würde unweigerlich nach „Chaos-istan“ führen. Die Bemerkung brachte ihm eine Klatsche von Präsident Obama ein, der ihn zu einem knappen Gespräch auf Air Force One einbestellte. Die Botschaft schien klar: Halt gefälligst die Klappe – und vor allem: Halt ab sofort den Ball flach.
Als er die Seiten mit seiner ausgedruckten Rede überfliegt, fragt sich McChrystal laut, welche Joe Biden-Frage er wohl diesmal bekommen wird – und wie er darauf reagieren solle. „Ich weiß nie, was auf mich zukommt, bis ich da oben stehe, und das ist das Problem.“ Da dieses Problem offensichtlich nicht lösbar ist, stellen er und seine Leute sich vor, wie sie die Frage mit einem cleveren Wortspiel vom Tisch wischen könnten. „Fragen Sie mich nach Vizepräsident Biden?“, sagt McChystal lachend. „Wer ist das?“
„Biden?“, schlägt einer seiner Berater vor. „Haben Sie ‚Bite Me‘ („Du kannst mich mal“) gesagt?“
Am Abend nach seiner Rede haben sich McChrystal und seine Begleiter im „Kitty O’Shea“ verabredet, einem Irish Pub, das von Touristen frequentiert wird und gleich in der Nähe ihres Hotels liegt. Seine Frau Annie ist ausnahmsweise mit dabei: Seit Beginn des Irak-Kriegs 2003 hat sie ihren Mann maximal 30 Tage pro Jahr gesehen. Obwohl es eigentlich heute ihr 33. Hochzeitstag ist, hat McChrystal auch die engsten Berater zu dem „un-Gucci-sten“ Ort eingeladen, den sein Team auftreiben konnte. „Er hat mich auch schonmal zu einem Fastfood-Imbiss geschleppt“, sagt sie lachend, „obwohl ich piekfein angezogen war.“
Das Team ist eine handverlesene Truppe von Killern, Spionen, Genies, Patrioten, politischen Drahtziehern und kompletten Wahnsinnigen. Wie treffen hier den früheren Chef der „British Special Forces“, zwei „Navy Seals“, einen „Afghan Special Forces“-Kommandanten, einen Rechtsanwalt, zwei Kampfpiloten und noch gut zwei Dutzend Nahkampf-Veteranen und Partisanen-Experten. Scherzhaft nennen sie sich „Team America“ (in Anspielung auf den gleichnamigen Film der „South Park“-Macher, in dem das Militär nur aus Volltrotteln besteht) und sind stolz darauf, Entscheidungen im Zweifelsfall auch ohne Rücksprache mit den ungeliebten Vorgesetzten zu treffen. Nachdem man im letzten Sommer in Kabul Quartier bezogen hatte, machte sich Team America daran, das Selbstverständnis der ISAF-Truppen („International Security Assistance Force“) grundlegend zu ändern. (Amerikanische GIs, die über die NATO-Missionare nur die Nase rümpften, hatten ISAF schon als „I Suck At Fighting“ oder „In Sandals And FlipFlops“ interpretiert.) McChrystal erließ ein absolutes Alkoholverbot, warf „Burger King“ und andere Ikonen amerikanischer Exzesse aus dem Camp, lud zu dem morgendlichen Briefing Tausende von Offizieren ein und machte aus der Kommandozentrale den „Situational Awareness Room“ – in Anlehnung an das vergleichbare Modell, das Bürgermeister Bloomberg in New York etabliert hat, um jederzeit den ungehinderten Fluss aller nur erdenklichen Informationen zu gewährleisten. Er selbst legte obendrein ein ganz neues Tempo vor, schlief in der Nacht nur vier Stunden, joggte morgens sieben Meilen und nahm nur einmal am Tag eine Mahlzeit zu sich. (In dem Monat, den ich mit ihm verbrachte, sah ich ihn ein einziges Mal beim Essen.) Sein asketischer Lebensstil war der Stoff, aus dem Legenden sind, und die Legende wurde prompt in allen Medienberichten ausgewalzt – als ob man im Alleingang einen Krieg gewinnen könne, wenn man nur wenig schläft und isst.
Es ist Mitternacht im „Kitty O’Shea“, und der größere Teil von Team America ist hackevoll. Zwei Offiziere tanzen einen irischen Jig, angereichert mit Elementen eines afghanischen Hochzeitstanzes, während sich McChrystals Top-Berater in den Armen liegen und einen hausgemachten Gassenhauer grölen. „Afghanistan“, röhren sie. „Afghanistan“. Sie nennen es ihren Afghanistan-Song.
McChrystal tritt zur Seite und schaut auf sein Team. „Für all diese Leute hier“, sagt er zu mir, „würde ich sterben. Und sie auch für mich.“
Der trunkene Trupp mag auf Außenstehende wie ein Haufen von Frontkämpfern wirken, die auf Heimaturlaub ordentlich Dampf ablassen, doch tatsächlich sind es diese Männer, die die US-Politik in Afghanistan umsetzen sollen. Während McChrystal und seine Männer selbstredend für die militärischen Aspekte verantwortlich sind, gibt es auf der diplomatischen und politischen Seite kein Äquivalent. Stattdessen erleben wir ein munteres Tauziehen zwischen den verschiedensten Regierungsvertretern – als da wären: US-Botschafter Karl Eickenberry, Sonderbeauftragter Richard Holbrooke, National Security Adviser Jim Jones und Außenministerin Hillary Clinton, nicht zu vergessen die rund 40 Botschafter der „Koalition“ und diverse Schlaumeier von John Kerry bis John McCain, die alle ihren Senf dazugeben wollen. Die fehlende diplomatische Kohärenz hat dafür gesorgt, dass es letztlich McChrystal ist, der die Entscheidungen trifft, die den Aufbau eines funktionierenden afghanischen Staates gewährleisten sollen. Stephen Biddle, der am „Council on Foreign Relations“ einen Forschungsauftrag hat und eigentlich McChrystal schätzt, hat seine Zweifel: „Dieser Zustand stellt die Ziele der Mission in Frage“, sagt er. „Es kann nicht angehen, dass das Militär für die Schaffung demokratischer Strukturen verantwortlich ist.“
Ein Teil des Problems ist struktureller Natur: Während das Verteidungsministerium jährlich 600 Milliarden Dollar bekommt, reichen für das Außenministerium 50 Milliarden. Zu einem nicht unbeträchtlichen Teil aber ist das Problem auch hausgemacht: Hinter vorgehaltener Hand zieht Team McChrystal heftig über seine diplomatischen Vorgesetzten her: Einer der Berater nennt den Vier-Sterne-General Jim Jones „einen Clown, der noch immer im Jahr 1985 lebt“. Politiker wie McCain und Kerry, mosert ein anderer, „tauchen kurz auf, haben ein Meeting mit Karzai, kritisieren ihn bei der anschließenden Pressekonferenz – und fliegen dann wieder für die sonntäglichen Talkshows zurück. Das ist, ehrlich gesagt, alles andere als hilfreich.“ Nur Hillary Clinton kommt beim McChrystal-Team ungeschoren davon. „Bei der Strategie-Session stand Hillary hinter ihm wie eine Eins. Sie sagte: ,Wenn Stan etwas braucht, sollte er es auch bekommen.‘“
Besonders kritisch geht man mit dem Sonderbeauftragten Holbrooke ins Gericht, dem die Aufgabe obliegt, die Taliban in die Gesellschaft zu reintegrieren. „Der Boss sagt, er verhalte sich wie ein angeschossenes Tier“, sagt ein Mitglied aus McChrystals Team. „Holbrooke hört immer Gerüchte, dass er bald gefeuert werde, und das macht ihn gefährlich. Er ist ein brillanter Kopf, aber er neigt dazu, überall reinzukommen und auf den großen Knopf drücken zu wollen. Aber hier geht es um COIN (Counter-Insurgency), und da bringt es überhaupt nichts, wenn jemand überall rumfummeln will.“
Auf seinem Trip in Paris zieht McChrystal einmal sein Blackberry heraus: „Oh nein, schon wieder eine Mail von Holbrooke“, stöhnt er. „Ich möchte sie nicht mal lesen.“ Er öffnet sie trotzdem und liest die Begrüßung laut vor, um das Blackberry dann wieder in die Hose zu stecken. „Passen Sie auf“, sagt einer seiner Berater, „dass Sie keine Flecken auf die Hose bekommen.“
Bei weitem die wichtigste Beziehung aber ist die zwischen McChrystal und US-Botschafter Eickenberry – und sie ist auch die problematischste. Glaubt man den Quellen aus beider Umgebung kann Eickenberry – ein Drei-Sterne-General, der 2002 und 2005 in Afghanistan diente – mit der Tatsache nicht umgehen, dass sein ehemaliger Untergebener nun das Sagen hat. Er ist zudem verärgert, dass McChrystal, unterstützt von den Alliierten, zu verhindern wusste, dass er als „Statthalter“ eingesetzt wurde – was das diplomatische Äquivalent zu der militärischen Position von McChrystal ist. Der Job ging stattdessen an den britischen Botschafter Mark Sedwill – was automatisch McChrystals diplomatische Ambitionen stärkte, weil ein wichtiger Rivale ausgeschaltet wurde. Ein US-Regierungsmitglied, das mit den Verhandlungen vertraut war, sagt dazu: „Um dieser Position das notwendige Gewicht zu geben, muss sie eigentlich von einem Amerikaner besetzt werden.“
Im Januar wurden ihre Beziehungen weiter getrübt, als eine vertrauliche Depesche von Eickenberry bei der „New York Times“ landete. Seine Analyse war ebenso vernichtend wie weitsichtig: Der Botschafter ließ an McChrystals Strategie kein gutes Haar, bezeichnete Hamid Karzai als „nicht-adäquaten strategischen Partner“ und bezweifelte, ob die Counter-Insurgency-Strategie „ausreichend“ sei, um das Al-Kaida-Problem in den Griff zu bekommen. „Wir werden immer mehr involviert“, schrieb er, „und werden nicht mehr die Möglichkeit haben, uns aus dieser Situation zu lösen, ohne dass das Land in Chaos und Gesetzlosigkeit zurückfällt.“
McChrystal und sein Team wurden von der vertraulichen Nachricht aus heiterem Himmel getroffen. „Ich mag Karl“, sagte er mir. „Ich kenne ihn seit Jahren, aber sie haben sich nie zuvor in ähnlicher Weise geäußert.“ Er fühle sich „verraten“, fügte er hinzu und attestierte Eickenberry, dass er nur an die Geschichtsbücher denke. „Sollten wir versagen, kann er dann leichten Herzens sagen: ,Ich habe es ja schon immer gewusst.‘“
Das vielleicht bezeichnendste Beispiel für McChrystals diplomatische Übergriffe ist sein Verhältnis zu Hamid Karzai. Es ist McChrystal – und nicht ein Diplomat wie Eickenberry oder Holbrooke -, der die engsten Beziehungen zu dem Mann pflegt, auf den sich Amerika beim Aufbau Afghanistans stützt. Die Counter-Insurgence-Doktrin erfordert eine glaubhafte Regierung, und da Karzai bei seinem eigenen Volk nicht als glaubwürdig gilt, setzte McChrystal alle Hebel in Bewegung, um ihn als glaubwürdig erscheinen zu lassen. In den vergangenen Monaten begleitete er den Präsidenten auf mehr als zehn Trips durch das Land und stellte sich bei politischen Veranstaltungen neben ihn auf die Bühne. Im Februar fuhr er zum Präsidentenpalast, um sich den Segen für die bislang größte militärische Operation des Jahres zu holen. Karzais Tross wies ihn ab, weil der Präsident gerade eine Grippe auskuriere. Nach einigen Stunden vergeblicher Versuche aktivierte McChrystal den afghanischen Verteidigungsminister, der Karzais Personal überzeugte, dass der Präsident seinen Gesundheitsschlaf unterbrechen müsse.
Und genau das ist der große Haken in McChrystals Counter-Insurgence-Strategie: Die Notwendigkeit, eine glaubwürdige Regierung zu bilden, macht uns abhängig von den Wallungen des lokalen Führers, auf den wir uns als Partner festgelegt haben – eine Gefahr, auf die Eickenberry explizit hingewiesen hatte. Selbst Team McChrystal gibt privat zu, dass Karzai ein suboptimaler Partner sei. „Seit einem Jahr hat er sich in seinem Palast versteckt“, lamentiert einer von McChrystals Berater. Manchmal habe man den Eindruck, dass er McChrystals Versuch, ihm in den Sattel zu helfen, selbst zu unterlaufen versuche. Bei einem Besuch im amerikanischen „Walter Reed Army Medical Center“ traf Karzai drei US-Soldaten, die in der Uruzgan-Provinz verwundet worden waren. „General“, rief er zu McChrystal, „ich wusste gar nicht, dass wir auch in Uruzgan kämpfen.“
Foto: rollingstone.com