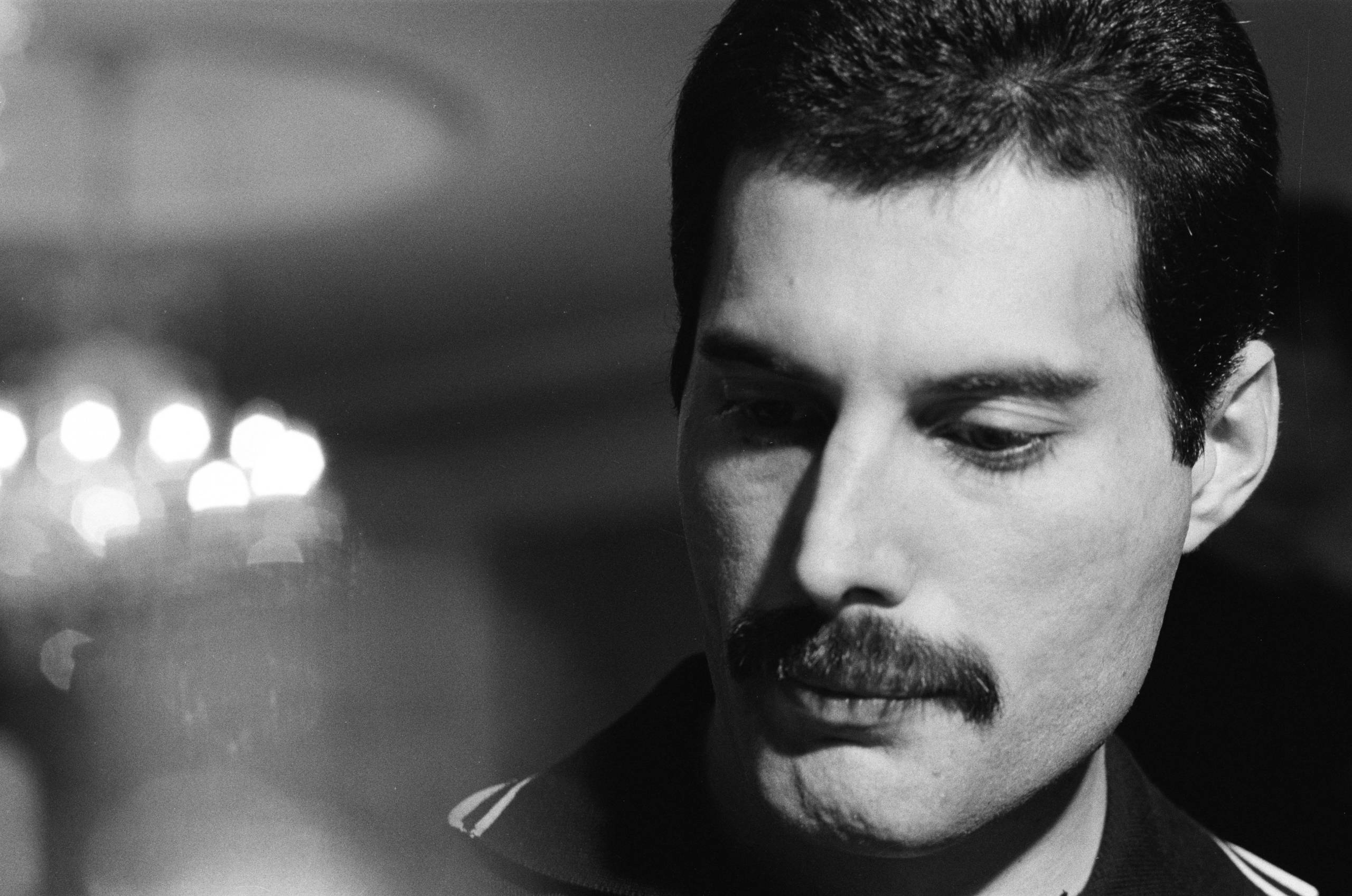TV Junkie zappt sich zurück ins Leben
Als totales Medien-Tier wurde Michael Mittermeier im Fernsehen populär. Nun philosophiert der Stand-up-Comedian wieder von der Bühne aus und auf CD über Fußball und Fußgängerzonen
„Zapped“ ist passé. Der TV-Junkie aus der Entziehungskur entlassen. Kein Fernsehen mehr, auch keine stand-up-philologischen Spitzen über Käptn Kirk, Lassie, die furzende Uschi Glass (oder war es ein Eichhörnchen?) und den humor vacui im unendlichen Raum zwischen Sendeanstalten, die auf ihren drei oder vier Buchstaben sitzen. Statt dessen philosophiert Michael Mittermeier nun von der Bühnenrampe beherzt über Arschlochkinder, über Fußgängerzonen, Fußball, Kirche und die Relativitätstheorie: die Themen des wirklichen Lebens also. Und Modephilosoph Umberto Eco mag ihm Recht geben. Sah er doch im Lachen den Ausdruck des freien Geistes. Das immerhin unterscheidet den Menschen vom Tier: Mensch ist, wer trotzdem lacht vifer aber bei einer Talkshow den Tön abdreht, damit das Gelächter einer von Belanglosigkeiten berauschten Runde visuell hervortritt, mag einen zweiten Grund für die philosophische Abkehr des Michael Mittermeier vom Bildschirm vermuten. Wenn der totale Medien-Mensch sich schon vom Tier unterscheidet, dann kaum noch vom Vibrator. Und würden wir unsere Freudenreaktion anders als lachend erledigen, zum Beispiel in der erregten Absonderung kleiner Häufchen – Eco müsste sich am Kopf kratzen, die Philosophie wäre erneut gefordert und würde uns den Spaß an der Freude wohl endgültig verderben.
Doch back to life: Mittermeier erkennt die Richtung. Zu weit geht er dann allerdings nicht. Seine Abkehr vom Medium TV im neuen Bühnenprogramm orientiert sich ebenso klug wie kalkuliert an den Möglichkeiten künstlerischer Selbstständigkeit, ohne die Voraussetzungen für Massenerfolg aus den Augen zu verlieren. Vbn der CD zu seinem Vorgängerprogramm „Zapped“ verkaufte er immerhin rund 250 000 Stück. Für das Video gab es Gold. „Back To Life“ geht mit Erwartungen in den Handel wie Produktionen aus dem erfolgsverwöhnten Kreis um Stefan Raab, Mundstuhl oder Badesalz. Mittermeier liebäugelt mit den Stilmitteln jenseits der Schmerzgrenze. Seine Bewunderung für die verkaufsschwache Hardcore-Fraktion um Max Goldt oder Wiglaf Droste deutet sich in seinen Programmen an – genau wie die Distanz (oder Nähe) zum Rattenfänger Raab, dessen Fans bei Schlägen auf den Kopf vermutlich die Eier schmerzen. Was bei Appelt „Ficken“ ist, wird bei Mittermeier zum virtuos gerappten „Fuuuck – you!“ Es ärgert ihn, dass der nächste Bundeskanzler vermutlich Zlatko heißen wird und der Medienzirkus mit „Big Brother“ ein Niveau erreicht hat, gegen das zu polemisieren sinnlos, vor allem aber „langweilig“ geworden ist.
„Comedy ist für mich eine Philosophie“ antwortet er auf die Frage, wie er es mit den Inhalten und den Beliebigkeiten der Branche hält. „Comedy oder Stand-up-Comedy hat in Deutschland einen Stellenwert erreicht, der das Genre mit Blödeln gleichsetzt. Aber das ist schlichtweg Unsinn.“ Lange vor ^apped“ha.t sich MM als unbekannte Größe auf Kleinkunstbühnen getummelt. Daneben wurde ernsthaft studiert: Amerikanistik – mit einer Abschlussarbeit über die amerikanische Stand-up-Comedy. „Du gehst nicht so einfach auf die Bühne und hängst ein paar Sketche hintereinander – nicht, wenn du dieses Thema ernst nimmst.“ Und so lässt die Frage nach den Reibungsflächen zwischen Kabarett und Comedy, wie sie – künstlich oder nicht – mitunter deutlich werden (wenn sich etwa die alte Garde um Husch und Hildebrandt über Appelt & Co. und deren fehlendes Interesse für die politische Relevanz ihres Tuns mockiert) immer auch die Antwort nach dem Verhältnis von Inhalt und Thema zu. „Letztlich kommt es nicht darauf an, was du machst, sondern wie. Wenn sich heute Comedians scheinbar apolitisch geben, bei ihren Auftritten aber immer wieder Grenzen überschreiten und gegen Vorschriften der Political Correctness verstoßen, dann ist das politisch relevant, ohne dass der Künstler bei seinem Auftritt raushängen lässt, dass er fünf neue Parteimitglieder für die SPD gewinnen will.“
Im Programm von „Back To Life“ testet der Mann, der das Käppi nun nicht mehr verkehrt herum aufsetzt und den Fernsehsüchtigen spielt, die Bissfestigkeit von Katholizismus und Multikulti. lästert über prügelnde Religionslehrer, peruanische Straßenmusiker in den Fußgängerzonen („Azteken-Kelly-Families“) und taxiert in Gedanken die sportiven Fertigkeiten von Zeugen Jehovas („Wachturm-Hochsprung“) oder Moslems („Völkerball“). Bei allem Bekenntnis zur unangepassten Qualität aber fehlt natürlich nicht das Kokettieren mit jener Form von Oralsex, die das Genre Comedy so erfolgreich gemacht hat: Michael Mittermeier ist immer auch ein geschicktes Lästermaul, dessen Witz sich beschleunigen lässt über Schlüpfrigkeiten. Motto: Pop-Kultur kommt von poppen.
„In Deutschland gibt es vermutlich weitaus mehr gute Kabarettisten als gute Comedians,“ sagt er mit Blick auf die fehlende Basis für das Wachstum
einer hiesigen Comedy-Betriebsamkeit. Kein Wunder also, dass er seine Vorbilder – mit Ausnahme vielleicht von Otto, dessen frühe Auftritte und Alben die semantische Ableitung von „albern“ noch nicht nahelegen – in den USA sieht. „In den 50er Jahren hat sich dort der Begriff ,Stand Up Comedy‘ eigentlich erst herausgebildet. Leute wie Bill Cosby und Steve Martin haben weit vor ihrer Bildschirmkarriere gelernt, sich vor Live-Publikum zu bewähren. Aber der größte überhaupt war Lenny Bruce. Nur frag mal die Leute, ob sie ihn kennen. Wenn du überhaupt einen findest, dann vermutlich jemanden, der den Film ,Lenny‘ mit Dustin Hoffman gesehen hat.“
Tatsächlich erlaubt der Hinweis auf sein Vorbild Lenny Bruce Aufschlüsse zu Widersprüchen, die Michael Mittermeier auch in programmatischer Selbstverteidigung nur unzureichend erklären kann – obwohl er sie nennt „Es gibt schon Leute, die mir vorwerfen, ich würde auf der Bühne im Grunde nur herumblödeln, ohne wirklich aggressiv zu sein. Aber ich denke, es geht hier wieder mal um das ständige Missverständnis, Qualität nur in dem Thema, nicht aber in der Performance selbst zu sehen.“
Lenny Bruce, dem Bob Dylan 1981 auf seinem Album „Shot Of Love“ eine Hymne gewidmet hat („Lenny Bruce is dead but bis ghost lives on and on~“) schaffte genau dies: anzuecken, Grenzen einzureißen, Schmerzgrenzen zu überschreiten und die Art der Performance zum Politikum werden zu lassen. Da sind es die „dirty words“, mit denen er in den 50er und 60er Jahren einen Status von Unbehaglichkeit etablierte, der ihn 1961 sogar ins Gefängnis brachte, Nachtclub-Besitzer gegen ihn aufbrachte und seine Karriere zerstörte. Als er 1966 an einer Überdosis Heroin starb, war Lenny Bruce längst isoliert und seiner Auftrittsmöglichkeiten beraubt.
Vor einem solchen Schicksal schützt im bundesrepublikanischen Späteomediantismus natürlich der allgegenwärtige Spaßfaktor. Bisweilen aber kann ja auch ein Schutz- und Umsatzgarant Seitenhiebe austeilen. Also: Wie war das gleich noch mit einem Schlag auf den Kopf und dem Schmerz? Auf verspätete Fragen dieser Art hat die Philosophie sofort eine Antwort parat: „Geh, Liesl. Des passt scho!“