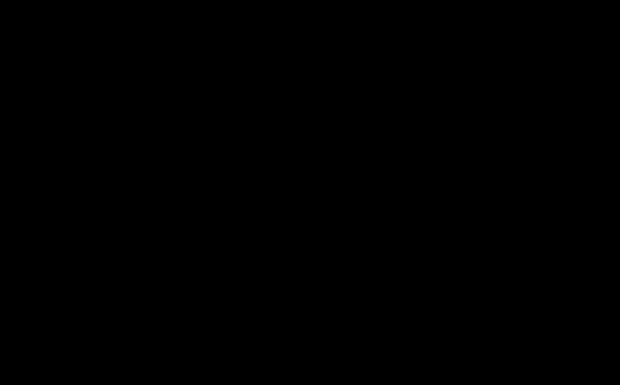Alive!
Ein ewiges Leben
Jim Morrison hat immer groß gedacht: Er wollte die Welt erobern, und seine Band hatte den richtigen Sound dafür. In weniger als fünf Jahren wurden The Doors zu einem Phänomen, das bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat. Auch wenn Erwachsene das ungern zugeben
Von BIRGIT FUSS
Spontan: was fällt einem zu jim morrison ein? Viele, viele Songs. Fotos mit nacktem Oberkörper. Das Grab. Die Lederhose. Die Lippen. Whisky A Go Go. Verhaftungen. Gedichte. Aggression. Suff. Sex. Tod. Und dann war da noch: der Hass auf den Offiziersvater, die Faszination für Indianer und Schamanen, der Spaß an der Manipulation, das Interesse an Filmen und Symbolismus, die Mischung aus Dionysos und Apoll, Ödipus und Sisyphos, der Hang zu Exzess, Exhibitionismus und Ekstase, aber auch die Verehrung für Jack Kerouac, Arthur Rimbaud und Friedrich Nietzsche
Vielleicht war manches davon oberflächlich, und natürlich war Morrison kein Baudelaire. Seine Poesiebände waren natürlich längst nicht so beeindruckend wie die Songs der Doors, weil sein hemmungsloses Pathos von den unwiderstehlichen Melodien und der dunklen Stimme aufgefangen wurde, auf Papier dagegen eher ein bisschen albern wirkte. Man muss Morrison auch nicht dafür lieben, dass er sich „The Lizard King“ nannte und „Mr. Mojo Risin'“.
Aber wie viele Rockstars kennen Sie, die sich überhaupt für Existenzialisten, Surrealisten und Okkultisten interessieren? Kann sein, dass Jim Morrison kein großer Dichter und Denker war, doch er versuchte -verdammt noch mal -wenigstens, einer zu sein! Er gab sich nicht zufrieden, nie. Er hasste die Leute, die nur seinen Körper sexy fanden und nicht seine Seele, seinen Geist. Er war wohl zu schön, um ernst genommen zu werden, also legte er sich einen Bart und einen Bauch zu. Es half nichts, die Paranoia wuchs. Er floh nach Paris, und dann starb er: die letzte Herausforderung, das definitive Abenteuer. 42 Jahre ist das am 3. Juli her, am 8. Dezember wäre der Sänger 70 geworden. Und die Doors haben in der Zwischenzeit nichts von ihrer Magie verloren. Wie ist das möglich?
Sie hatten -vom Erscheinen ihres Debüts im Januar 1967 an gerechnet -nicht mal fünf Jahre. Fünf Jahre! Sogar die Beatles hatten mehr Zeit. Vergleichbar ist die Wucht, mit der die Doors in der Welt aufschlugen und wieder verglühten, allenfalls mit Nirvana. Doch Kurt Cobain taugte zwar zur Projektionsfigur und Glorifizierung, aber nicht als hedonistischer Rebell. Von allen Unsterblichen ist Jim Morrison der Unsterblichste – und derjenige, bei dem sich Erwachsene immer etwas verschämt winden:“Die Doors? Habe ich als Teenager geliebt!“ Damals fuhr man zu Morrisons Grab in Père Lachaise, um cool zu trauern (mir ist es nicht gelungen), dann wurde man volljährig, und keiner wollte sich daran erinnern, was ihm die Band bedeutet hat. Mit einem anderen Mann, der stets das Große im kleinen Leben suchte, den Zauber und die Weisheit, irgendeine Utopie und irgendeinen Sinn, war das genauso: mit Hermann Hesse. Die Doors-Biografie „Keiner kommt hier lebend raus“ von Jerry Hopkins und Danny Sugerman stand in vielen Regalen gleich neben „Demian“ und „Der Steppenwolf“.
„No eternal reward will forgive us now for wasting the dawn“, sprach Morrison in „Stoned Immaculate“. Er hat keine Zeit verschwendet, nur sich selbst. Wenn er in „Take It As It Comes“ so lässig „specialise in having fun“ empfiehlt, klingt das schon fast wie Hohn -ein Hippie, der einfach mal alles auf sich zukommen lässt, war Morrison nicht. „We want the world, and we want it now!“ Innerhalb von sechs Alben wandelten sich die Doors von der psychedelischen Pop-zur Bluesband, blieben dabei aber immer unverwechselbar. Was nicht nur am Sänger lag. Er überschattete seine drei Kollegen bald, doch er brauchte sie; ohne sie wäre er vielleicht nur ein weiterer Hänger in Venice Beach geworden, der sich für etwas Besonderes hält. Diese Typen haben an ihn geglaubt und ihn hochgehalten, solange es ging: Ray Manzarek mit seiner sensationellen Orgel und der ungenierten Hybris, Robby Krieger mit seinem wunderbaren Songwriting und der angenehmen Zurückhaltung, John Densmore mit seinem vertrackten Schlagzeug und der dringend nötigen Vernunft.
Was sie nach Morrisons Tod alles veranstaltet haben (die peinlichen Comebacks, die Streitereien, die Veröffentlichungen jedes Schnipsels), soll hier kein Thema sein. Erinnern wir uns an die Doors, wie sie ewig bestehen: Von den ersten Takten von „Break On Through (To The Other Side)“ bis zu den letzten von „Riders On The Storm“ eröffneten sie uns in kaum mehr als vier Jahren eine Welt. Sie war wild und sinnlich, oft beängstigend, manchmal grotesk, aber eins war sie nie: klein.
Schrecken ohne Ende
Wenn Jim Morrison und die Doors die Bühne betraten, hielt die Welt den Atem an -oder begann hysterisch zu kreischen. Live waren sie größer als alles, was die Leute bis dahin gesehen hatten. Eine kurze Geschichte ihrer irrsten, euphorisierendsten, peinsamsten Momente
VON GREIL MARCUS
Als jim morrison sagte, dass ein Doors-Konzert eine Art öffentliche Zusammenkunft sei, schrieb man den 14. Dezember 1968, wenige Stunden bevor die Band vor 18.000 Fans im L.A. Forum auftreten sollte. „Das war für uns eine Riesensache“, sagte Robby Krieger Jahre später. „Eine Band aus L.A. spielt da, wo sonst die Lakers spielen!“
Ende 1968 waren die Doors eine Top-40-Band. Ihre letzten beiden Singles hatten es auf Platz eins beziehungsweise Platz drei der Charts geschafft -danach sollten sie allerdings nie wieder in die Top 10 vordringen. An diesem Abend wollten sie in erster Linie Songs von „The Soft Parade“ präsentieren, ihrem vierten Album, das erst in gut sechs Monaten auf den Markt kommen sollte. Sie hatten ein Streichsextett und eine Bläsersektion dabei, und auf der Bühne waren insgesamt zweiunddreißig Verstärker aufgebaut. Das Vorprogramm bestritten der japanische Koto-Spieler Tzon Yen Luie, die süßlich-seichte, aus Los Angeles stammende Band Sweetwater und Jerry Lee Lewis. Alle wurden sie ausgebuht, als wären sie irgendwelche Hochstapler. „Ich hoffe, ihr kriegt einen Herzanfall!“,
raunzte Jerry Lee das Publikum an. Als die Doors auf die Bühne kamen, wurden sie begeistert empfangen, doch binnen Kurzem übertönte das Publikum die Musik mit seinen Schreien nach „Light My Fire“ – das die Band diesmal auf gar keinen Fall zu spielen gedachte. Doch da sie mit ihrer neuen Musik beim Publikum nicht landen konnten, lenkten sie schließlich ein -und sobald sie den Song beendet hatten, schrie die Menge erneut nach „Light My Fire“.“Kommt, lasst den Scheiß“, sagte Jim Morrison. Er blickte in die Menge und stellte eine Frage, so als wollte er die Antwort tatsächlich wissen, als hätte er keinen Schimmer, wie sie lauten würde:“Was macht ihr alle hier?“ Er begann, das Publikum mit den gleichen Bemerkungen zu provozieren, die drei Monate später den Eklat bei dem Konzert im Dinner Key Auditorium in Miami einleiten sollten. „Ihr wollt Musik?“ Die Menge schrie und tobte. „Okay, Leute“, sagte er, „wir können die ganze Nacht Musik machen, doch das ist nicht das, was ihr wirklich wollt, oder? Ihr wollt mehr, ihr wollt etwas, das größer ist als alles, was ihr bisher gesehen habt, richtig?“ In Miami, in einem Zustand betrunkener Raserei, sollten diese Worte plötzlich darauf hinauslaufen, dass er dem Publikum seinen Penis zeigen würde – dass dieser, wenn auch nur symbolisch, weil es sich um seinen handelte, größer wäre als alles, was die Leute bis dahin gesehen hatten. In Los Angeles schwebten die Worte einfach in der Luft, und dann schrie jemand:“Wir wollen Mick Jagger!“
Nach einer kurzen Unterbrechung trat Morrison an den Bühnenrand und begann, „The Celebration of the Lizard“ zu deklamieren. Er hielt inne. Die Leute lachten. Er fuhr fort:“One morning he awoke in a green hotel. With a strange creature groaning beside him.““Is everybody in?“, fragte er, einmal, und dann noch zwei weitere Male, und die Leute brüllten daraufhin jedes Mal: „NOOOOOO!“. „The ceremony is about to begin“, sagte er theatralisch – versuchen Sie mal, diesen Satz auf eine andere Weise zu sagen -, und die Leute lachten lauthals angesichts der Schwülstigkeit des Ganzen, oder sie kicherten peinlich berührt. Dann verstummte Morrison. Es wurde weiter gelacht und gekichert. „Blödmann“, murmelt jemand. „Arschloch!“
„WAKE UP!“, schrie Morrison aus voller Lunge. Die Band entfesselte dazu ein lärmendes Getöse. Nach vielen endlos scheinenden Minuten war die Performance beendet. „Zum Schluss starrt er mit funkelnden Augen ins Publikum“, hieß es seinerzeit in einem Zeitungsbericht, „ein Blick, der mehr sagt als tausend Worte, und als er die Bühne verlässt, hält sich der Beifall in Grenzen.““Wenn du den Leuten gibst, was sie haben wollen, oder das, von dem sie glauben, dass sie es haben wollen, dann bist du für sie der Größte“, sollte er im darauffolgenden Jahr rückblickend und voller Klarsicht sagen. „Aber wenn du für sie zu schnell bist und etwas Unerwartetes machst, dann verwirrst du sie. Wenn sie zu einer Musikveranstaltung gehen, zu einem Konzert, zu einer Theateraufführung oder zu was auch immer, dann wollen sie angetörnt werden, dann wollen sie sich so fühlen, als seien sie auf einem Trip, als erlebten sie etwas Außergewöhnliches. Doch wenn du ihnen nicht das Gefühl gibst, dass sie auf einem Trip sind und dass sie alle zusammengehören, und wenn du ihnen stattdessen einen Spiegel vorhältst und ihnen zeigst, wie sie tatsächlich sind, was sie wirklich wollen, wenn du ihnen zeigst, dass sie in Wahrheit allein sind und dass sie nicht alle zusammengehören, dann sind sie empört und verwirrt. Und entsprechend werden sie sich verhalten.“
Es war eine mitunter unerträgliche, zuweilen verwirrende und streckenweise lebendige Performance, bei der die Band atonal auf ihre Instrumente eindrosch und jeglichen Rhythmus verweigerte, während Morrison sang, rezitierte, schrie und flüsterte -auf „Boot Yer Butt!“, einem eigenartigen 4-CD-Set, den die übrig gebliebenen Doors 2003 veröffentlichten, ist es nur ein weiterer gespenstischer, fast schon illusionärer Moment in einer tagtraumartigen Übersicht über die Karriere der Band; von ihren ersten Liveaufnahmen, von einer Show im Avalon Ballroom in San Francisco im März 1967 bis zu ihrem vorletzten Konzert, das sie am 11. Dezember 1970 in Dallas gaben. „Unser Album ist bloß eine Landkarte unserer Musik“, sagte Jim Morrison 1967 über „The Doors“, und damit hatte er recht, denn auf Schallplatte kamen sie nie über die Landkarte hinaus; die auf „Boot Yer Butt!“ versammelten Live-Performances sind das Territorium.
Der Set beginnt mit „Moonlight Drive“ und der von der Band einstudierten Coverversion von Howlin‘ Wolfs „Back Door Man“, und er endet fast vier Jahre später, und dieser sich einen endlosen Strand hinunterwindende Fußmarsch -man kann Leute mit unhandlichen Tonbandgeräten und an angelförmigen Stangen befestigten Mikrofonen sehen, wie sie den vier durch den Sand stapfenden Mitgliedern der Doors folgen und deren Bootleg-Mission darin besteht, sich nicht einen Seufzer oder Fluch der Band entgehen zu lassen -wird nicht von Soundboard-Aufnahmen oder passablen Mitschnitten aus dem Publikum dokumentiert. Nein, das Ganze ist eine Zusammenstellung von wirklich schauderhaften Aufnahmen, die mit defektem Equipment gemacht und ursprünglich auf minderwertiges Vinyl gepresst wurden, das zersprang oder sich wellte, sobald man die Platte abzuspielen versuchte.
Auf diesen Aufnahmen kann Morrison sich so anhören, als sei er kilometerweit von den kleinen Handmikrofonen entfernt, die seine Botschaften auffangen, Botschaften, die mitunter den Einddruck erwecken, als kämen sie aus einem tiefen Brunnenschacht. Es kann vorkommen, dass man keines der Instrumente hinter seiner Stimme zu erkennen vermag oder, noch irritierender, dass man bloß ein einziges Instrument hört. Die Band kann auftauchen und verschwinden, als sei das Ganze kein Konzert, sondern eine Séance. Man kann sich den kompletten Set von A bis Z anhören, die gut vierzig Performances, die dort zusammengestellt oder, genauer gesagt, aneinandergeklatscht worden sind und anschließend gleich wieder von vorn anfangen, gebannt von seinem unwirklichen, körperlosen Zauber, und ein Teil dieses Zaubers besteht in dem Drama, das sich nach und nach herauskristallisiert: das Drama einer Band, die sich mit ihrem Publikum im Krieg befindet.
Zu Anfang hört man Entdeckung und Umarmung: ein Publikum, das eine Band umarmt, und eine Band, die ihr Publikum umarmt, aber vor allem eine Band, die ihre eigene Musik entdeckt und umarmt, eine Band, die Anspruch auf eine Musik erhebt, die ihr, rein rechtlich gesehen, gehören mochte, aber womöglich noch außerhalb ihrer Reichweite lag, etwas, was der Band offenbar klar war. Die Art und Weise, wie die Doors am 9. Juli 1967 im Continental Ballroom in Santa Clara, Kalifornien, ihren Weg in „Break On Through“ finden -wie sie durch den Song hindurchbrechen -, ist ein Sturmangriff. Hunderte von Soldaten erklimmen die Stufen zu einer einstmals uneinnehmbaren Festung und brennen diese von innen bis auf die Grundmauern nieder – aber erst nachdem sie kurz pausiert und die Wunder dieses Bauwerks bestaunt haben: die gewaltigen, scheinbar frei in der Luft schwebenden Deckengewölbe, die meterdicken Mauern, die Marmorfußböden, die Wasserspeier an den Traufen. Sie tanzen im Kreis herum, und dann, als die Flammen hoch aufzulodern beginnen, tanzen sie noch schneller. „Keiner kommt hier lebend raus“, sollte Morrison ein Jahr später in dem platten „Waiting For The Sun“-Track „Five To One“ verkünden, doch diese Performance sieht das als selbstverständlich an und sagt: Na und? Wer würde das schon wollen?
Einige Monate später, am 16. Dezember, im Swing Auditorium in San Bernardino, taumelt Morrison durch den „Alabama Song“, er hat Schwierigkeiten mit dem Text, und der Song schlängelt sich angewidert von ihm fort. Die Konzerte werden unberechenbar. Den von „Light My Fire“ angelockten Fans sind die anderen Songs im Repertoire der Band mehr oder weniger schnuppe, und häufig sind diese Leute so betrunken oder so stoned, dass sie andere Darbietungen als eine Beleidigung empfinden, als einen Affront oder bestenfalls als etwas, das sie notgedrungen in Kauf nehmen, um irgendwann den Song hören zu können, um dessentwillen sie gekommen sind, und so ist es nicht verwunderlich, dass sich in den Hallen eine gewisse Verachtung breitmacht, wobei nicht eindeutig zu bestimmen ist, wo diese herkommt.
Morrison griff nach den Sternen. Eine am 26. Dezember im Winterland in San Francisco präsentierte Version von Bo Diddleys „I’m A Man“ ist ausladend, offen, überschäumend. Morrison und die Band steigen in lange, langsame Improvisationen ein, ausgehend von einer im Singsang vorgetragenen Rede, in der es darum geht, sich die Welt zu eigen zu machen – etwas, was der Song, während Morrison in die Musik eintaucht, selber vorzuschlagen scheint. Ist dies nicht, was ein Mann tun sollte? Sagt der Song, dass dem, was ein Mensch tun kann, irgendwelche Grenzen gesetzt sind? Nein, ganz im Gegenteil. Im Chaos der ihn umgebenden Geräuschkulisse geht Morrison voll aus sich heraus, so als sei er der Erste, der entdeckt hat, was diese Nummer schon immer sagen wollte, und der sich traut, es laut auszusprechen.
In Miami fliegt schließlich alles in die Luft, doch der Ärger begann schon früher. Am 15. September 1968 verlor Morrison in Amsterdam das Bewusstsein, nachdem er, um unbehelligt durch den Zoll zu kommen, seinen Drogenvorrat vorsichtshalber hinuntergeschluckt hatte. Er konnte nicht auftreten, und so musste Ray Manzarek jeden Song ihres Sets singen, was die zum Trio geschrumpften Doors in eine Kneipenband verwandelte, die Doors-Songs coverte. Überall wird die Distanz zwischen der Band und ihrem Publikum offenkundig, auch, auf eine eher symbolische als reale Weise, in der Distanz, die in der Musik selber zutage tritt, Abend für Abend, bei fast jedem ihrer Auftritte: in der Art und Weise, wie die Musik gedämpft wird, so als spiele die Band hinter einem Vorhang, während der Sänger davorsteht, sich aber hin und wieder den Vorhang schnappt, um sein Gesicht damit zu bedecken.
„Boot Yer Butt!“ ist chronologisch geordnet, mit Ausnahme des allerletzten Songs:“The End“, vom 2. August 1968 in der Singer Bowl in Queens, New York. Weil jede Version der Karriere der Doors mit „The End“ ausklingen muss? Weil diesen bizarren, hässlichen 17 Minuten nichts anderes mehr folgen konnte?
Robby Kriegers einschmeichelnde Gitarrenlinie ist klar und deutlich; der filigrane Schnörkel, den er spielt, ist das Startzeichen für den Song. Das Publikum ist laut, betrunken. Die Leute krakeelen. „Come on, Jimmy!“, schreit ein Mann. „Jimmmmyyyyayyyyyy, light my fire!“, kreischt eine Frau. Sie klingt wie eine Patientin, die durch den Korridor einer Nervenheilanstalt flitzt und von Pflegern verfolgt wird, die ihr eine Beruhigungsspritze verpassen wollen. „Das haben wir doch gerade erst gespielt“, sagt Morrison vernünftig. Dann ertönt ein organisierter Sprechchor, fünf oder sechs Leute, die unisono „Come on light my fire!“ schreien. „Hey“, sagt Morrison, wobei er ein bisschen überrascht klingt. „Jetzt reißt euch mal zusammen!“ Das Geschrei ebbt jedoch nicht ab. „SSS-SHHHHHHHH“, flüstert Morrison ins Mikrofon.
„Fuck you!“, schreit jemand. Der Sound ist jetzt gedämpft, Morrisons Worte sind nicht zu verstehen. Er versucht, sich in dem anschwellenden Lärm Gehör zu verschaffen. „Hey, damit macht ihr alles kaputt“, sagt er. „SS-SSHHHHHHH“, flüstert er ein weiteres Mal. Die Band hält hinter ihm den Takt. Inzwischen sind mehr als zwei Minuten verstrichen, und sie haben noch immer nicht mit dem Song anfangen können.
„This is the end“, singt Morrison, klar und deutlich – der Sound kommt laut und satt rüber. Die Menge ist ruhig, doch Morrison klingt abwesend, so als habe er den Glauben an den Song verloren, den Glauben daran, dass es sich lohnt, den Song zu singen. „You‘ ll never follow me“, singt er. „Du kannst uns mal!“, schreit jemand. Morrison versucht zu singen, doch er kann den Song nicht finden. Seine Stimme klingt eher wie die eines Redners. Die Frau aus der Klapsmühle rennt kreischend durch die Halle, und man kann nicht sagen, ob sie glaubt, dass sie auf der Bühne sei oder dass die Leute auf der Bühne sie umzubringen versuchen. Morrison improvisiert einen Text, der sich in wirren Knittelversen auflöst. Die Leuten scheinen es ihm mit gleicher Münze heimzuzahlen: „MORRISON IST IN SEINER HÖHLE!“ Und, falls ich mich nicht verhöre: „HOCH DIE MARSIANER! NIEDER MIT -„
Morrison – die Band ist inzwischen kaum noch zu hören – versucht, sich über den Lärm zu erheben, doch das schneidende Kratzen der Frauenstimme, ein Geräusch, das sich so anfühlt, als würde einem jemand mit den Fingernägeln übers Gesicht fahren, lässt das nicht zu. Allmählich lernt man diese Leute kennen, diese kleine, repräsentative Gruppe, die sich aus dem Hexenkessel der Aufnahme herausschält. Das Ganze ist ein wilder Moshpit, nur dass hier Geräusche mit voller Wucht aufeinanderprallen. Die Leute brüllen Parodien auf die Textzeilen, die Morrison nicht singt. In dieser dunklen Stunde ist seine Präsenz ausgeprägter als jemals zuvor -doch seine gewaltige, göttergleiche Stimme ist nichts im Vergleich zu der noch stärkeren, ihn mit Hohn und Spott überschüttenden Menge.
Morrison improvisiert erneut Textzeilen, um die Menge zum Schweigen zu bringen, um den Song von den Toten auferstehen zu lassen: „A creature is nursing its child, soft arms around the head and the neck, a mouth to connect, leave this child alone, this one is mine, I’m taking her home, back to the rain“ – er klingt wie ein Cowboy, der zu viele Bücher gelesen hat. Es folgen lange, unverständliche Passagen von Morrison, und dann dringt das Bild des Regens durch die Störgeräusche des Publikums, und wie aus dem Nichts beginnt eine Geschichte Gestalt anzunehmen.
„Stop the car“, sagt Morrison schlicht. Es ist eine Standardszene aus einem Film Noir. „Rain. Night“ – Morrison gibt einen gedämpften Schrei von sich. Es könnte eine Szene aus Edgar G. Ulmers „Detour“ sein: der Killer, wie er geradewegs aus dem Straßengraben mit der Leiche darin herausfährt, einem Straßengraben, der sich nun in Queens befindet, was noch schlimmer ist. „I’m getting out. I can’t take it anymore. I think there’s somebody coming.“ Und dann, halb gesungen, halb gesprochen:“There’s nothing you can do about it.“
In der Halle ist es ruhig; die Band gibt keinen Mucks von sich, und eine Sekunde lang spricht niemand, keiner schreit. Dieser Moment ist so ungewöhnlich, dass einem die Stille absolut vorkommt. Dann schreit jemand etwas über Kuchen. Die Irre beginnt wieder zu kreischen -ihre Schreie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Wäre sie lediglich ein Gesicht, so könnte man wegschauen. In Morrisons Hinterkopf befindet sich bereits eine Geschichte über „The End“, die er einem Freund im darauffolgenden Jahr erzählen sollte. „Eines Abends war ich in Westwood im Kino“, sollte er sagen, „und ich ging dort in einen Buchladen oder in so ein Geschäft, wo sie Töpferwaren und Kalender und allen möglichen Krimskrams verkaufen, du weißt schon, was ich meine und ein sehr attraktives und intelligentes Mädchen -intelligent im Sinne von aufgeweckt und offen – glaubte, mich erkannt zu haben, und sie kam zu mir rüber, um Hallo zu sagen. Und sie fragte mich nach genau diesem Song.
Sie machte gerade einen kleinen Ausflug, in Begleitung einer Pflegerin. Die Ärzte vom neuropsychiatrischen Institut der UCLA hatten ihr eine Stunde Ausgang gewährt. Offensichtlich hatte sie an der UCLA studiert und war wegen schwerer Drogen oder so was ausgeflippt, und deshalb hatte sie sich entweder selbst eingewiesen, oder jemand anders hatte sich um sie gekümmert und sie dort einweisen lassen. Aber wie dem auch sei, sie sagte, ,The End‘ sei einer der Lieblingssongs vieler junger Patienten in ihrer Abteilung. Zuerst dachte ich: Oh, Mann und das war, nachdem ich mich schon eine Weile mit ihr unterhalten und ihr gesagt hatte, dass der Song alles Mögliche bedeuten könne, dass er eine Art Labyrinth oder Puzzle sei und dass jeder ihn auf seine persönliche Situation beziehen müsse. Mir war nicht klar gewesen, dass die Leute Songs dermaßen ernst nehmen, und ich fragte mich, ob ich beim Songschreiben vielleicht die möglichen Folgen bedenken sollte „
„The killer awoke before dawn“, sagt Morrison hölzern. Er scheint den Song voranzutreiben, so als wolle er diesen Teil möglichst schnell hinter sich bringen. Die Band macht weiterhin keinen Mucks. „He took a face from the ancient gallery“, verkündet Morrison. „And he walked on down the hall“, antworten ihm daraufhin gleich mehrere Männerstimmen. „And he walked on down the hall“, sagt Morrison, als hätten ihn die Zwischenrufer an das erinnert, was er sagen muss. „WALKED ON DOWN THE HALL!“, kreischt die Frau. Man kann nicht sagen, ob Morrison das Publikum verhöhnt oder sich selbst, denn er weiß, dass jedes Wort retourniert wird, begleitet von einem dümmlichen Grinsen auf den Gesichtern der Leute im Publikum. „And he walked on down the hall“ ist nun die Pointe von etwas, was ursprünglich kein Witz gewesen ist. Die Band improvisiert hinter ihm eine Art Begleitung. „Father“, sagt Morrison. „Yes, son“, antwortet ein Typ im Publikum. „YES SON!“, antwortet die Frau. „I want to kill you“, hört man einen Mann im Publikum sagen. „I want to kill you“, wiederholt Morrison mit ausdrucksloser Stimme. Er versucht, den Song zurückzuerobern: „Mooootherrrr -„
Schreie steigen empor, als kämen sie aus dem Erdboden, ohne jedes menschliche Zutun. „I want tuh -“ Die Band steigert das Tempo, dann hält sie abrupt inne. Aus Morrisons Kehle dringen Würgelaute, er versucht zu schreien. Die Menge ist still, und Morrison gibt Wörter von sich, die keine Wörter sind, so als versuche er, sich den Song zu erklären. Sein Gesang ist eine Selbstparodie, und dann stürzt er sich auf Klänge im Innern der Wörter, Klänge, die genauso wahnsinnig sind wie die Geräusche, die manche Leute im Publikum von sich geben. Seine Stimme ist hier, und sein Körper ist da drüben. Die Menge beginnt, ihn laut anzuschreien, auf eine Weise, wie es sie bis dahin noch nicht gegeben hat: Angesichts dieses Kreischens kann man sich vorstellen, dass Krähen aus den Mündern der Leute flattern, und man kann Morrison so sehen, wie ihn die Leute im Publikum sehen, als eine Monstrosität, als den Elefantenmenschen, die Menge ergötzt sich daran, wie grotesk er ist, wie verrückt, und alle zeigen sie mit dem Finger auf ihn, und obwohl die Band wieder spielt, kommt die eigentliche Musik nun vom Publikum, ein wildes, hirnlos durch den Saal waberndes Gemisch von Geräuschen.
Es gibt laut tosende Geräusche von der Band, dann vom Publikum: Geräusche à la „Wir werden alle sterben, und ich kann es kaum erwarten“. Es ist beängstigend. Alles könnte passieren, das heißt, alles, außer etwas Gutes.
Morrison versucht, die letzten Zeilen des Songs zu singen; er tut das auch, doch sein Vertrauen in den Song hat sich in Luft aufgelöst. Jemand im Publikum steckt sich zwei Finger in den Mund und pfeift gellend. Einmal und gleich noch ein weiteres Mal.
Dann ist Schluss. Man hat sich alle vier CDs angehört, wie gebannt, mehr als fünf Stunden lang. Man kann wieder von vorn anfangen. Man kann sich kaum vorstellen, dass die Band dazu in der Lage war. Man erinnert sich daran, dass dies ein falscher Schluss ist, dass der chronologisch letzte Song des Sets, „L. A. Woman“, vom 11. Dezember 1970, in der State Fair Music Hall in Dallas, voller Schatten war, Gestalten, die im Nebel verschwanden, ein Sänger, der das Gesicht zu finden versuchte, das alles erklären würde, und der dieses Gesicht möglicherweise fand. Man kann nicht glauben, dass die Doors tatsächlich so lange bei der Stange blieben. Vielleicht waren sie tougher oder, wie Charlie Poole 1927 in „If I Lose, I Don’t Care“ sang, vier Jahre bevor er sich zu Tode soff: „The blood was a-runnin‘, I was running too/To give my feet some exercise, I had nothing else to do.“
Rest In Peace
Morrisons Grab auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise ist längst Pilgerort. Aber wo liegen andere Rockstars, die mit 27 starben?
Robert Johnson
GREENWOOD 1938 vergiftet oder an Syphilis gest.
schon der stets mythenumrankte blues-Musiker Robert Johnson starb im Alter von 27 Jahren. An drei möglichen Grabstätten wurden Gedenktafeln aufgestellt -eine davon unter einem großen Pekannuss-Baum.
Jimi Hendrix
RENTON 1970 an seinem Erbrochenen erstickt
zum greenwood memorial park im us-Bundesstaat Washington pilgern Fans von Jimi Hendrix. 15.000 besuchen das wuchtige Grabmal aus Granit pro Jahr. Auf der Insel Fehmarn erinnert außerdem ein Gedenkstein an Hendrix‘ letztes Konzert.
Janis Joplin
PAZIFIK gest. 1970 an einer Überdosis Heroin
janis joplins asche wurde vor der kalifornischen Küste ins Meer gestreut. Ihrem Idol Bessie Smith hatte sie kurz zuvor einen Grabstein anfertigen lassen: „The Greatest Blues Singer In The World Will Never Stop Singing.“
Kurt Cobain
UNBEKANNT erschoss sich 1994 in seiner Garage
seattle will kein wallfahrtsort werden und verweigert dem Sänger bis heute eine offizielle Grabstätte. So bewahrte Courtney Love die Asche im Kleiderschrank auf, bis sie angeblich gestohlen wurde.
Amy Winehouse
LONDON gest. 2011 an einer Alkoholvergiftung
vor dem konzerthaus, wo amy winehouse drei Tage vor ihrem Tod zum letzten Mal auftrat, soll bald ein Denkmal stehen. Auf dem Edgeware-Friedhof erinnert ein schwarzer Grabstein mit pinkfarbener Schrift und einem eingravierten Singvogel an die Sängerin.
LIGHT MY FIRE
Greil Marcus über den epochalen Song und einen legendären Auftritt
Hört mal, leute, ich möchte dass ihr ein nettes Lächeln zeigt, wenn ihr da rausgeht“, sagte Ed Sullivan backstage, am 17. September 1967, kurz bevor die Doors vor die Fernsehkameras treten sollten, um „Light My Fire“ zu spielen. „Es macht keinen Sinn, fins-ter zu sein. Wisst ihr, was ich meine?“. „Aber wir sind ’ne finstere Gruppe, Ed“, sagte Ray Manzarek.
Das sagte er zumindest 1991 in Oliver Stones Film „The Doors“. Die Ed Sullivan Show war der Schauplatz des ersten landesweiten Skandals, den die Doors provozierten, eines Skandals, der ihnen jedoch nicht schadete, sondern eher zu ihrem Nimbus beitrug: Die für die live ausgestrahlte Sendung Verantwortlichen verlangten von den Doors, wie vorher schon von Bob Dylan und den Rolling Stones, dass sie etwas anderes spielten als das, was sie spielen wollten. Bob Dylan sollte 1963 auf den Protestsong „Talkin‘ John Birch Society Blues“ verzichten, woraufhin er seine Sachen zusammenpackte und ging. Und die Rolling Stones sollten Anfang 1967 „Let’s Spend The Night Together“ entschärfen. Mick Jagger und Keith Richards sangen, so wie man es von ihnen verlangt hatte, „Let’s spend some time together“, wobei Mick die Augen verdrehte, um aller Welt zu demonstrieren, wie albern er diese Zensurmaßnahme fand. Im November 1955 wurde Bo Diddley für die Sendung gebucht, und Sullivan forderte ihn auf, Tennessee Ernie Fords „Sixteen Tons“ zu singen, den damals populärsten Song in den USA. Er spielte stattdessen „Bo Diddley“ und trat nie wieder in der Sullivan-Show auf. Von den Doors verlangten die Leute von CBS, dass sie die Zeile „Girl, we couldn’t get much higher“ veränderten – angeblich zu „Girl, we couldn’t get much better“. Eine unmusikalischere Lösung hätte sich der Sender kaum ausdenken können, selbst dann nicht, wenn er Jim Morrison dazu aufgefordert hätte, die chemische Formel für Lithium zu singen. Angeblich war der Rest der Band dazu bereit, in dieser Frage einzulenken -den Stones hatte es ja auch nicht geschadet Die Sullivan-Show war eine große Sache, und ihnen wurden weitere Auftritte in Aussicht gestellt. Angeblich willigte Morrison ein.
Es ist schwer zu glauben, dass sich Manzarek, Densmore und Krieger nicht hätten ausmalen können, was passieren würde. Densmore beginnt die Performance mit einem krachenden Schlag auf die Snare Drum -es war kaum vorstellbar, wie jemand damals sagte, dass irgendwer härter auf etwas einschlug. Doch anschließend drischt Densmore weiterhin zu hart auf sein Schlagzeug ein. Man hört keinen Beat. Was man hört, ist Nervosität – oder Angst. Morrison steigt lässig in den Song ein, ohne jede Anspannung, ohne irgendetwas anzudeuten – ganz anders als Elvis Presley 1957 bei seinem dritten und letzten Auftritt in der Sullivan-Show, dem einzigen Mal, wo man Elvis nur von der Taille aufwärts filmte und wo dieser demonstrativ an seinem Körper herunterschaute, als sei das, was die Kamera nun verbarg, eine Sache, die er nie gezeigt hätte, als die Kamera weiter hinten platziert war und ihn vom Scheitel bis zur Sohle einfing, als sie filmte, wie er und seine Combo die Fetzen fliegen ließen, voller Freude, Ausgelassenheit und Tempo. Nein, Morrison ließ sich nichts anmerken. Er benutzte den Song mehr oder weniger als Trampolin. „Girl, we couldn’t get much hiiiii“, sang er und ließ die zweite Silbe von higher verschwinden, vorüberhuschen, als habe es sie überhaupt nicht gegeben, und obwohl eine Andeutung des anstößigen Wortes aufgeblitzt und landesweit live ausgestrahlt worden war, konnte man zu der Auffassung gelangen, dass das okay war: okay für CBS und für die Doors ein ehrenhafter Kompromiss. Nach etwa einer Minute, kurz bevor Manzarek ein sieben Sekunden dauerndes Solo begann und den Song somit auf seine Single-Version reduzierte, schrie Morrison „FIGH-YARRRRGH! YEAH!“ – als wollte er einen Ausgleich für das liefern, was er dem Publikum vorenthalten hatte. Sein Schrei war aufregend und bis zu diesem Zeitpunkt das einzig Aufregende an der Performance.
Nach Manzareks Solo stieg Morrison wieder genauso lässig in den Song ein wie zu Anfang. Er sang die erste Strophe. Er ignorierte die Melodie und ließ sich das Wort „fire“ auf der Zunge zergehen, so wie Elvis es möglicherweise getan hätte, wenn er „Elvis Is Back!“, sein 1960, nach Abschluss seines Militärdienstes veröffentlichtes Comeback-Album, mit „Light My Fire“ statt mit „Reconsider Baby“ hätte ausklingen lassen -vergegenwärtigt man sich, wie Elvis an Lowell Fulsons bekanntesten Song heranging, wie er jedes Wort mit einer Glut erfüllte, die bis heute nicht abgekühlt ist, so ist die Ähnlichkeit zwischen ihm und Morrison hier geradezu frappierend.
Beim Refrain schrie Morrison wieder „FIRE!“. Und dann warf er alle Hemmungen über Bord. Hört man sich die Aufnahme an, dann klingt es so, als reiße er sich die Kleider vom Leib. Seine Stimme ist plötzlich roh, scharf, aggressiv, eine regelrechte Druckexplosion. Densmores Schlagzeug legt nun das Fundament, auf dem Morrison sich austoben kann. Mit einem Mal ist es ein völlig anderer Song, ein anderer Abend, ein anderer Ort; ein anderes Publikum wird erschaffen. Jetzt ist jeder Atemzug tief, ein Luftholen, das die Lungen bis zum Bersten füllt, die Art, auf die man einatmet, bevor man springt; jeder Atemzug ist so stark, so unvermittelt, so gewaltig und lustvoll wie der Moment, in dem Densmores Trommelstock zum ers-ten Mal auf die Snare Drum kracht.
Morrisons Aussprache wird gröber, die Wörter verlieren ihren Anfang und ihr Ende, der Sänger stürmt an dem Song vorbei, und der Song jagt hinter ihm her wie eine Welle, und beide treffen sich bei Morrisons wildem, glühendem „higher“, das hier, wo der Song seine wahre Gestalt findet, nicht mehr musikalische oder moralische Bedeutung trägt als jedes andere Wort, jeder andere Ton, jede andere Formulierung, jeder andere Klang -und der Klang ist nun der Sound der Freiheit. Es ist schockierend, wie viel Vergnügen Freiheit bereiten kann: „Come on!“, schreit Manzarek, völlig außer sich, beim letzten Refrain dazwischen. Jetzt sind sie auf der anderen Seite angelangt. Musste der Song nach dieser Performance jemals wieder gespielt werden?
Die beiden Texte sind ein exklusiver Vorabdruck aus dem Buch „The Doors“ von Greil Marcus, das am 16. Mai in der Übersetzung von Fritz Schneider bei Kiepenheuer &Witsch erscheint.
Die zehn besten Songs
Partykeller, Bumsbuden und ein Festival auf der Isle of Wight: An den Doors hängen Erinnerungen. Zehn Autoren des ROLLING STONE über ihre Lieblingsstücke
Break On Through (To The Other Side)
THE DOORS 1967
1die doors waren von beginn an eine große Inszenierung all der Klischees und Pathosformeln, die sich bis Mitte der Sechziger in der Popkultur angesammelt hatten -Sex, Drogen, Geniekult, Sonnenbrillen Insofern sind sie das dunkle Gegenstück zu den Monkees, der anderen Band aus Hollywood. Die subversivste aller Boybands legte ihre Philosophie im Herbst 1966 auf „(Theme From) The Monkees“, dem ersten Song ihres Debüts, offen, und die Doors taten es ihnen drei Monate später gleich. „Break On Through (To The Other Side)“ war ihre erste Single und eröffnete „The Doors“. In diesen popfreundlichen zweieinhalb Minuten ist schon alles angelegt: die dionysische Dichterpose, der Blues, die Metaphysik des Rausches, der Jazz, die Orgel, die Zerrissenheit. Besser – und das unterscheidet die Doors von den Monkees – wurde es nicht mehr. MAIK BRÜGGEMEYER
Love Me Two Times
STRANGE DAYS 1967
2in einer kleinen bumsbude, matratze und Weinflasche auf dem Boden, flatternde Gardinen, draußen Kalifornien im Auto, bettelt ein Mann eine Frau an: Noch mal! Zwar hat den Text eigentlich Robby Krieger geschrieben, und der befeuert vielleicht nicht ganz so viele feuchte Träume wie Morrison, doch hier wird Elementares der Rockmusik formuliert: Liebe mich, sofort. Ob man die Interpretationen bis „ich muss nämlich in den Vietnam-Krieg“ ausdehnen sollte, ist Ansichtssache. Auf „Strange Days“ schwingt der Song sich, angestoßen vom Cembalo, gen genüsslichen Nachmittagssex, als Live-Version auf „Alive She Cried“ spielt Manzarek Moogbass und Orgel, und es treibt sich wie von selbst.
JENNI ZYLKA
Back Door Man
THE DOORS 1967
3der bruder eines freundes besass die erste Doors-LP bereits Anfang 1967, also wurde sie examiniert, „Light My Fire“ für zu lang und „The End“ für zu langatmig befunden. „Alabama Song“ roch verdächtig nach Gemeinschaftskundeunterricht, aber „Back Door Man“ verströmte Gefahr. Es war nicht der animalische Schrei, nicht Riff, nicht Beat, nicht einmal Jim Morrisons hohntriefender Ton, der mich anzog und zugleich abstieß. Okay, das alles auch, aber vor allem waren es die buchstäblich hinterrücks ins Bewußtsein dringenden Worte. „I am the back door man“ , deklamierte dieser Lüstling. Hier ging es um etwas Verbotenes, so viel war auch einem 16-Jährigen klar, dem sich das sexuelle Innuendo von „Little Red Rooster“ mählich offenbart hatte. Solange das Mysterium „Back Door Man“ eines war, verfolgte mich der Song, erst recht, als ich Howlin‘ Wolfs ungleich potenteres Original kennenlernte. Wolf war Voodoo, daneben verblasste das dionysische Rollenspiel eines frivolen Exhibitionisten nach und nach.
Im Sommer 1970 erlebte ich die Doors auf der Isle of Wight, unmittelbar nach Emerson, Lake & Palmer, deren hohler Pomp mit der torpiden Vorstellung einer Band mit Bart merkwürdig kontrastierte. Doch sie eröffneten mit „Back Door Man“, und für Momente war da wieder der Kitzel des Geheimnisvollen, des Entfleuchens durch die Hintertür. Endgültig ihren Reiz verlor die Doors-Version von Willie Dixons ungeniertem Versteckspiel erst Jahrzehnte später, durch die Enthüllung überlebender Doors-Mitglieder, für Jimbo habe „Back Door Man“ nur eine Bedeutung gehabt: Analsex.
WOLFGANG DOEBELING
Blue Sunday
MORRISON HOTEL 1970
4es ist ein gemeinplatz, dass jim Morrison als Dichter nichts taugt. Vor 25 Jahren erschien seine Lyrik ohne Musik, und seitdem gilt (Frauen und Pubertierende ausgeschlossen): Morrison war ein Hochstapler, er konnte nicht dichten wie William Blake und Arthur Rimbaud. Kann Dylan auch nicht. Lange dachte ich, all die schönen kurzen Songs der Doors hätte Robby Krieger geschrieben. Diese Bierdeckelpoesie. Die tollen Melodien. Aber „Blue Sunday“, unscheinbar auf „Morrison Hotel“, stammt von Jim Morrison. „My girl awaits for me in tender time/My girl is mine/ She is the world/She is my girl.“ Mehr braucht es doch nicht.
ARNE WILLANDER
You’re Lost Little Girl
STRANGE DAYS 1967
5auf einem album voll unfassbarer Songs („Moonlight Drive“! „People Are Strange“!) versteckt sich zwischen „Strange Days“ und „Love Me Two Times“ dieses seltsame kleine Lied, das ohne viel Lyrik auskommt -und doch so suggestiv, so sinnlich und beängstigend ist. Es liegt an der Art, wie Jim Morrison diese Zeilen singt: „I think that you know what to do/ Impossible? Yes, but it’s true “ Über der Diskussion, ob er als großer Poet durchgehen darf oder nicht, wird oft vergessen, was für ein fantastischer Sänger er war. Natürlich erinnert „You’re Lost Little Girl“ auch an den Satz aus Willie Dixons „Back Door Man“, der zu Morrison passt wie zu keinem anderen:“The men don’t know, but the little girls understand.“
BIRGIT FUSS
People Are Strange
STRANGE DAYS 1967
6alles so schön fremd hier! „people Are Strange“ von der zweiten Doors-Platte „Strange Days“ zeigt die Band von ihrer musikalisch verwaschensten und zugleich ihrer lyrisch scharfsinnigsten Seite. Durch blickdichten, leicht milchig besonnten Bodenklangnebel hindurch barmt Jim Morrison sein Mantra von der Fremdheit der ihn umgebenden Welt. Diese liegt gleichermaßen im Blick des Betrachters wie in den Physiognomien der betrachteten Menschen: „People are strange/When you’re a stranger/Faces look ugly/When you are alone.“ Der Fremdheitsbegriff ist dialogisch gefasst, das „Ich“ und das „Du“ sind ohne einander nicht zu verstehen. Das gilt auch für die libidinöse Struktur dieses Lieds. Einerseits leidet Morrison an der Fremdheit der ihn umgebenden Welt, andererseits erfreut er sich an der eigenen Fremdartigkeit. So erleben wir die Dialektik des Hippietums, seine unauflösbare Verschränkung von Larmoyanz und Arroganz. Hier in einer ihrer frühesten und elementarsten Gestalten!
Unter den zahlreichen Coverversionen des Stücks möchte ich besonders jene von Das Racist hervorheben, einem hypernervösen und -talentierten Brooklyner Rap-Kollektiv. Bei ihm wird das Vexierspiel zwischen dem verfremdenden Blick und der Fremdheit des Angeblickten schlau ins unendliche Werden gedehnt: „I know I look a little bit strange/But probably your little opinion will change/And change and change and change again/The only consistence is change my friend“. JENS BALZER
Riders On The Storm
L.A. WOMAN 1971
7natürlich, the doors waren im engeren Sinne nie eine amtliche Discotruppe wie, sagen wir, KC and the Sunshine Band. Dennoch muss man ganz klar festhalten, dass auf den Dancefloors der allerersten Diskotheken in den späten 60ern und frühen 70ern auch eine ganze Menge Musik von den dark groovenden Doors lief, den Urahnen düsterer Discomusik. „Riders On The Storm“, das letzte jemals aufgenommene Doors-Stück, erfreute sich dabei besonderer Beliebtheit -übrigens bis heute. Neben Trance-Remixen und Chillout-Versionen sei vor allem die sehr gelungene Interpretation von Snoop Dogg empfohlen, der einfach über das Orignal rappt. Zu finden auf dem Soundtrack des Films „Need For Speed 2“, wo man nie im Leben danach gesucht hätte.
HANS NIESWANDT
Alabama Song (Whiskey Bar)
THE DOORS 1967
8der wohlfeile kunstgewerbe-hit aus der Feder von Bertolt Brecht (Text) und Kurt Weill (Musik) für die kapitalismuskritische Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ von 1930. Die Band stieß im Hause Ray Manzareks auf die Platte und fand die Stimmung der kaputten Weimarer Republik durchaus vergleichbar mit der eigenen Sicht auf die USA der Sixties. Morrison änderte die zweite Strophe: „Show us the way to the next pretty boy“ zu „Show me the way to the next little girl“, und Manzarek durfte den Tingeltangel-Tastenmann geben. Eine unverwüstliche Schunkelnummer für nachts um halb drei.
RALF NIEMCZYK
Love Her Madly
L.A. WOMAN 1971
9aus dem trockenen bluesrock-acker sprossen manchmal die lieblichsten Pop-Blümchen. Auf fast jedem Doors-Album finden sich nämlich zwei, drei Songs – meist aus der Feder von Robby Krieger -, die den sumpfigdüsteren Grundton der Band um ein paar luftige Facetten bereicherten. „Love Her Madly“ zieht die schweren Vorhänge auf, und der Drogennebel, der unheilschwanger über Morrisons Geist waberte, lichtet sich kurz. „Don’t ya love her as she’s walkin‘ out the door?“, dröhnt er zu Kriegers treibender Gitarre und Ray Manzareks herrlichem Jangle-Piano. Am Ende ist es aber doch wieder ein halluzinogenes Auflodern, eine verführerische Schimäre, ein liebeskranker Fiebertraum. MAX GÖSCHE
Love Street
WAITING FOR THE SUN 1968
10 in den achtzigern wollten meine Freunde und ich unbedingt Hippies sein. Wir rauchten -in Ermangelung besseren Stoffs -Bananenschalen und Muskatnuss und hörten die Doors. Irgendwann behauptete jemand, Muskatnussrauchen könne zu Blindheit führen. Auch mit den Doors hörten wir bald auf. Eine Zeitlang aber waren sie die Größten. Schon damals gefielen mir ihre weniger gespreizten, weniger inszenierten Songs deutlich besser. Mein Favorit ist „Love Street“: Morrison drückt hier mal nicht so sehr auf die Schamanen-Tube, und auch das Georgel von Ray Manzarek bleibt aus -stattdessen gibt es ein Piano. ERIC PFEIL