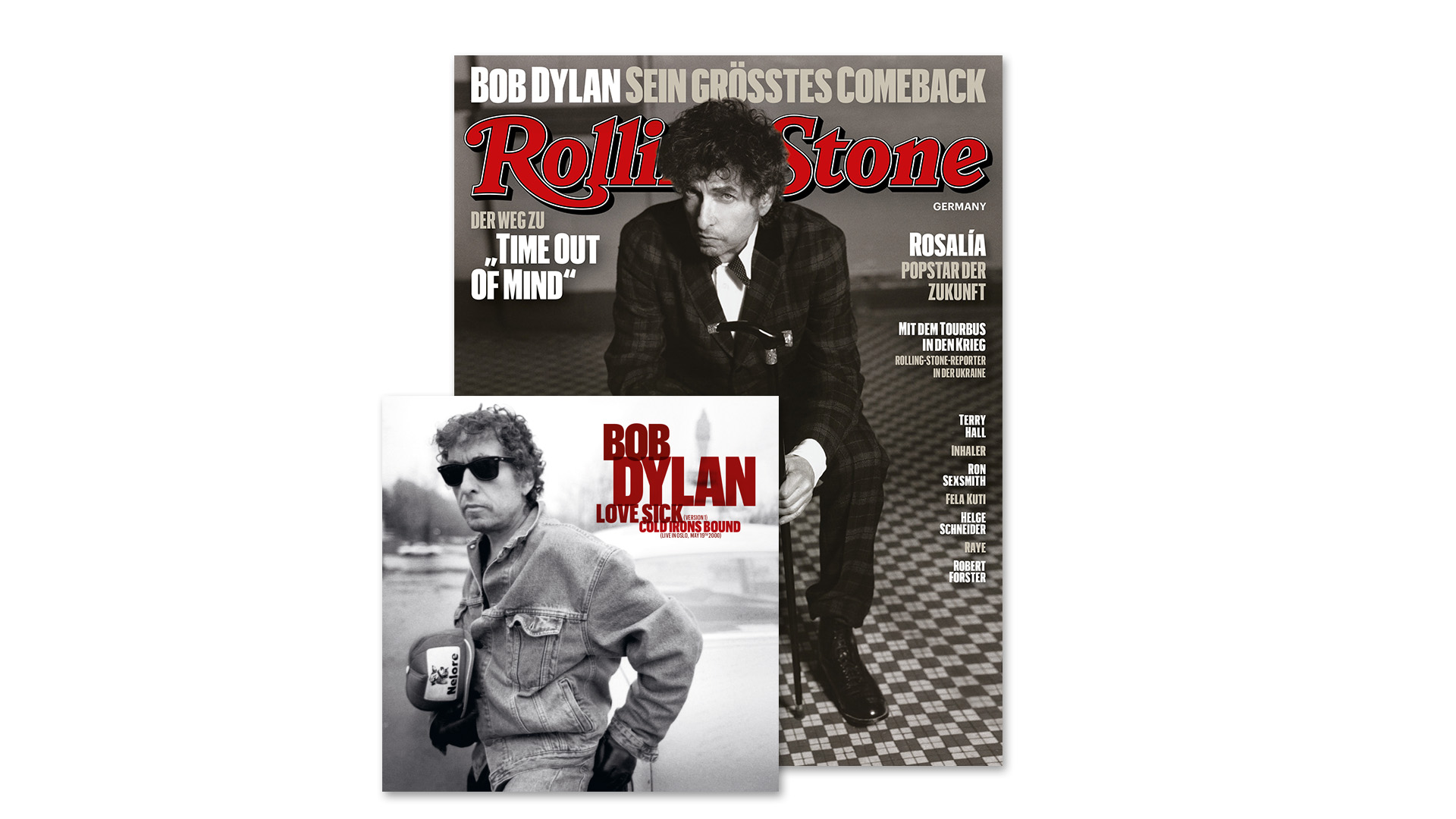Der Heil-Pädagoge
Humor sei Tragödie plus Zeit, behauptet der eitle, von Alan Alda gespielte Fernsehproduzent Lester in Woody Aliens „Verbrechen und andere Kleinigkeiten“. Und niemand zieht aus dieser Einsicht so viel Nutzen wie Allen selbst, der in seinen Filmen mehr Pointen über das Schicksal des jüdischen Volkes im Dritten Reich gesetzt hat als jeder andere Regisseur. Und wir haben jedes Mal laut gelacht, weil sie zeitlich und räumlich weit entfernt vom Ort des Verbrechens aus einer Opferperspektive formuliert wurden.
Aber kann man in historischen Kulissen eine Komödie über Hitler drehen? In Deutschland? Der Schweizer Regisseur Dani Levy, der mit dem erfolgreichen „Alles auf Zucker“ den jüdischen Alltag in den deutschen Film zurück brachte, hat nun den Film „Mein Führer. Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler“ gedreht. Eine Komödie, in der Hitler von Dada-Komödiant Helge Schneider als manisch depressiver Bettnässer gespielt wird. Dani Levy ist Jude. Aber. Trotzdem. Darf der das?
„Ich entnehme der Tatsache, dass ich jüdisch bin, keine verstärkte Legitimierung, einen solchen Film zu drehen“, meint Levy, der sich als erster deutschsprachiger Regisseur überhaupt wagt, Hitler ins Zentrum einer großen Komödienproduktion zu stellen. Selbst Lubitsch und Chaplin, die—als sie „Sein oder Nichtsein“ und „Der große Diktator“ drehten – das volle Ausmaß der NS-Verbrechen noch nicht überblicken konnten, arbeiteten mit Rollenspielen und Annäherungen. Von Chaplin sind gar die Worte überliefert, er hätte „Der große Diktator“ nicht gedreht, wenn er die Wahrheit über Hitler gewusst hätte. „Ich glaube, man kann Hitler nicht ernst spielten“, meint Helge Schneider. „Das liegt an der Ernsthaftigkeit, mit der man es versucht—das Kribbeln des Gleich-loslachen-Wollens ist immer da.“ Jede Annäherung an diesen Charakter ende gerade deshalb im comic relief, weil man eigentlich nicht lachen dürfe. Sicher auch, weil alles, was wir über den Menschen Adolf Hitler wissen, auf tragikomische Weise zum Lachen ist, wenn wir für einen Moment ausblenden, was er zwischen 1933 und 1945 angerichtet hat. Über die Hälfte seines Lebens war er ein vollkommener Versager, zeitlebens ein „geborener Selbstmörder“ (Sebastian Haffner), impotenter Antialkoholiker, Vegetarier und Nichtraucher. Selbst in den Inszenierungen der Nationalsozialisten gab er mit seinem hysterischen Pathos und Größenwahn eine lächerliche Figur ab. „Ich war der einzige, der gelacht hat, als Bruno Ganz in ‚Der Untergang‘ zum ersten Mal gesprochen hat“, so Schneider über Oliver Hirschbiegeis umstrittenes Historiendrama. „Ich habe gelacht, weil da einer wirklich mit vollem Ernst den Hitler spielt. Genauso habe ich das auch gemacht. Wie ein Kind, das sich ausdenkt: Ich bin jetzt Räuber Hotzenplotz.“
Man muss unwillkürlich an Charlie Chaplin denken, wenn Schneider das sagt, wie er als Adonoid Hynkel mit der aufgeblasenen Weltkugel spielt, bis sie zerplatzt. Ist es am Ende das Kindliche, das übrig bleibt, wenn man der Bestie die Maske vom Gesicht zieht? Hitler als infantiles Wesen darzustellen scheint zumindest die einzige Möglichkeit zu sein, ihn von der moralischen Verantwortung für seine Grausamkeiten zu befreien. Und nur dann kann er als komische Figur funktionieren. Auch Levy verwendet diesen Trick, baut sein Psychogramm des Führers aus den recht banalen Thesen der Schweizer Psychoanalytikerin Alice Miller, nach denen der Urspung von Hitlers Hass und psychischer Deformation die autoritären, jede Emotion unterdrückenden Erziehungsmethoden seiner Kindheit gewesen seien. „Mein Führer“ beginnt im Dezember 1944. Der Krieg ist längst verloren. Doch am Neujahrstag soll der Führer das Volk mit einer kämpferischen Rede noch einmal mobilisieren. Hitler, krank und schon seit dem Stauffenberg-Attentat schwer depressiv, denkt jedoch nicht daran. Da erinnert Goebbels sich an Hitlers früheren jüdischen Schauspiellehrer Adolf Grünbaum und lässt ihn samt Familie aus dem KZ Sachsenhausen in die Reichskanzlei bringen, damit er den Führer wieder in Form bringt. Hitler, zunächst unwillig, sich auf den Juden Grünbaum einzulassen, respektiert ihn erst, nachdem der ihn versehentlich bei einem von ihm provozierten Boxkampf umhaut. Grünbaum, überzeugt, Hitler zum Wohle der Menschheit töten zu müssen, lässt von seinen Mordplänen ab, als der Führer ihm in Hypnose weinend von seinem gewalttätigen Vater berichtet.
Beide erkennen die Menschlichkeit des jeweils Anderen erst an, nachdem sie einen Teil von sich selbst in ihm erkannt haben, der Massenmörder die potenzielle Gewalt im Grünbaum, der Jude die Neurose im Hitler. Aus dem Schauspielunterricht wird unversehens eine analytische Sitzung.
Man denkt selten daran, dass man sich hier im Genre der Komödie befindet. Weil Levy über die Maßen psychologisiert und nicht zuletzt, weil der große befreiende Lacher eher mangels wirklich gelungener Pointen ausbleibt. Es sind die inneren Konflikte der Figuren, die diesen Film tragen. „Natürlich sind das auch Obsessionen und Liebhabereien eines jüdischen Regisseurs, die ich hier betreibe“, gesteht Levy. „Die Analyse, das Psychische und Widersprüchliche als Witzpotenzial zu nehmen, Mitleid mit den Bösen und Kritik an den Guten. Das Verdrehen, dieses Dibbuk-mäßige, was das Jüdische oft hat. Sich nicht in einer sicheren Ausgewogenheit wiegen. Gleichzeitig sehe ich im Film auch ein für mich wichtiges Element, sich von einer bestimmten Art der Lähmung und des Stigmas zu befreien.“
Diese Lähmung ist in „Mein Führer“ spürbar. Es gibt Momente, in denen liegt die ganze Last der Geschichte auf dem Film, genauer gesagt, auf den schmalen Schultern von Ulrich Mühe, der den Adolf Grünbaum verkörpert. In einer Szene gleich zu Beginn steht Grünbaum im KZ Sachsenhausen unter der Dusche, und es dauert einige quälende Sekunden, bis das Wasser aus der Brause fließt. Sofort schwirrt einem das Wort „Gaskammer“ durch den Kopf. „Es war zwischen Dani Levy und mir eine klar formulierte Aufgabe, dass da immer die wahrste Wahrheit der Geschichte mit dasteht und nicht nur die wahrste Wahrheit über Adolf Hitler“, sagt Mühe, der den Film mit einer verschmitzten Ernsthaftigkeit trägt. Oft reicht eine Geste oder ein viel sagender Blick, um einen wieder zu vergewissern, in welcher Zeit man sich befindet.
Schneider spielt das psychische Wrack Hitler unter einer dicken Maske mit kindlichen Zügen, aber auch einer großen Zurückhaltung, ja sogar einer gewissen Würde, die er auch behält, als der Führer mit urindurchnässtem Nachthemd aus wilden Träumen erwacht. „Ich habe mich in die Situation hinein versetzt, um zu bewahren, was ich zeigen wollte. Dieses Mosaik an Gefühlen und dem, woraus der Mensch zusammengesetzt ist. Eben nicht Karikatur, sondern Ambivalenz.“
Als Hitler in der Silvesternacht einsam Zuflucht im Lager der Grünbaums sucht, mit ihnen sogar das Bett teilt-wie ein Kind darf er in der Mitte schlafen -, versucht Grünbaums Frau, ihn mit einem Kissen zu ersticken, doch ihr Mann hindert sie mit den Worten: „Du machst dasselbe wie er: Du tötest einen wehrlosen Menschen.“
„Ich würde nicht sagen, dass ich ein Humanist bin wie Grünbaum“, meint Levy. „Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man weiß, dass Hitler ein Mensch war und man ihn auch so empfindet. Damit wir von der Vorstellung wegkommen, ersei nur diese Guido-Knopp-Erfindung.“
Erst wenn man aufhöre, Hitler zu mythologisieren, ihn endlich als Menschen
unter Menschen anerkenne, sei eine moralische Diskussion über das Dritte Reich möglich, so Levy. Die momentane Flut an Filmen zum Thema stehle sich stattdessen mit Authentizität und knallharten Fakten aus der Verantwortung. „Wenn man Adolf Hitler nahe kommt und tatsächlich, wie das deutsche Volk damals, verführt wird, für ihn Mitgefühl zu entwickeln, Mitleid, Verständnis, wenn man ihn erkennt, weil man ihm nahe kommt, dann hat man eine Chance, sein eigenes Adolf-Hitler-Bild zu überprüfen.“
Man greift natürlich zwangsläufig auf ein Arsenal von bereits existierenden Darstellungen zurück, wenn man sich ein Bild von Adolf Hitler macht. Auf alte Filme, Gegen-Propaganda, nicht zuletzt die Inszenierungen der Nationalsozialisten. Und Levy spielt damit, montiert historisches Material parallel zu fiktiven Sequenzen, erweist Chaplin und Lubitsch seine Referenz und lässt den von Sylvester Groth gespielten Joseph Goebbels bei jeder Gelgenheit seine Meinung zur „inszenierten Realität“ aufsagen. Im Gegensatz zu Frank Schirrmacher, der über „Der Untergang“ schrieb, Produzent Bernd Eichinger habe Hitler hier „ein zweites mal erfunden“, weiß Levy, dass jedes Bild des Führers entweder ein Negativ oder eine Dopplung eines bereits existierenden Bildes ist. Und so setzt er Adolf Grünbaum in „Mein Führer“ zugleich als Negation und Doppelgänger Adolf Hitlers -der seinen Schauspiellehrer an einer Stelle gar „mein Führer“ nennt – in Szene.
„Mein Führer“ folgt über weite Strecken seiner eigenen Realität, anstatt sich-wie „Der Untergang“ — an die Inszenierungen der Nationalsozialisten zu halten. Levy hat Goebbels das Drehbuch geklaut und ihm ein neues untergeschoben, leider ist das am Ende auch nicht viel lustiger. Der Frage, ob man in Deutschland eine Komödie über Adolf Hitler machen kann, weicht der als „kleiner Störsender“ (Levy) geplante Film aus, da er mit seinen durch und durch ambivalent angelegten Protagonisten der Komik die Grundlage entzieht.
„Wenn ich die Hitler-Masken aus dem Film bei mir zu Hause auf der Orgel liegen sehe“, so Helge Schneider, „oder wenn ich sehe, wie mein Sohn Henry damit spielt, denke ich, ich müsste noch mal einen Film in der Maske drehen. Nicht als Hitler, sondern als jemand, der das Pech hat, genauso auszusehen, aber eigentlich als Heilpädagoge im Kindergarten arbeitet und immer verkannt wird.“ Das könnte komisch werden.