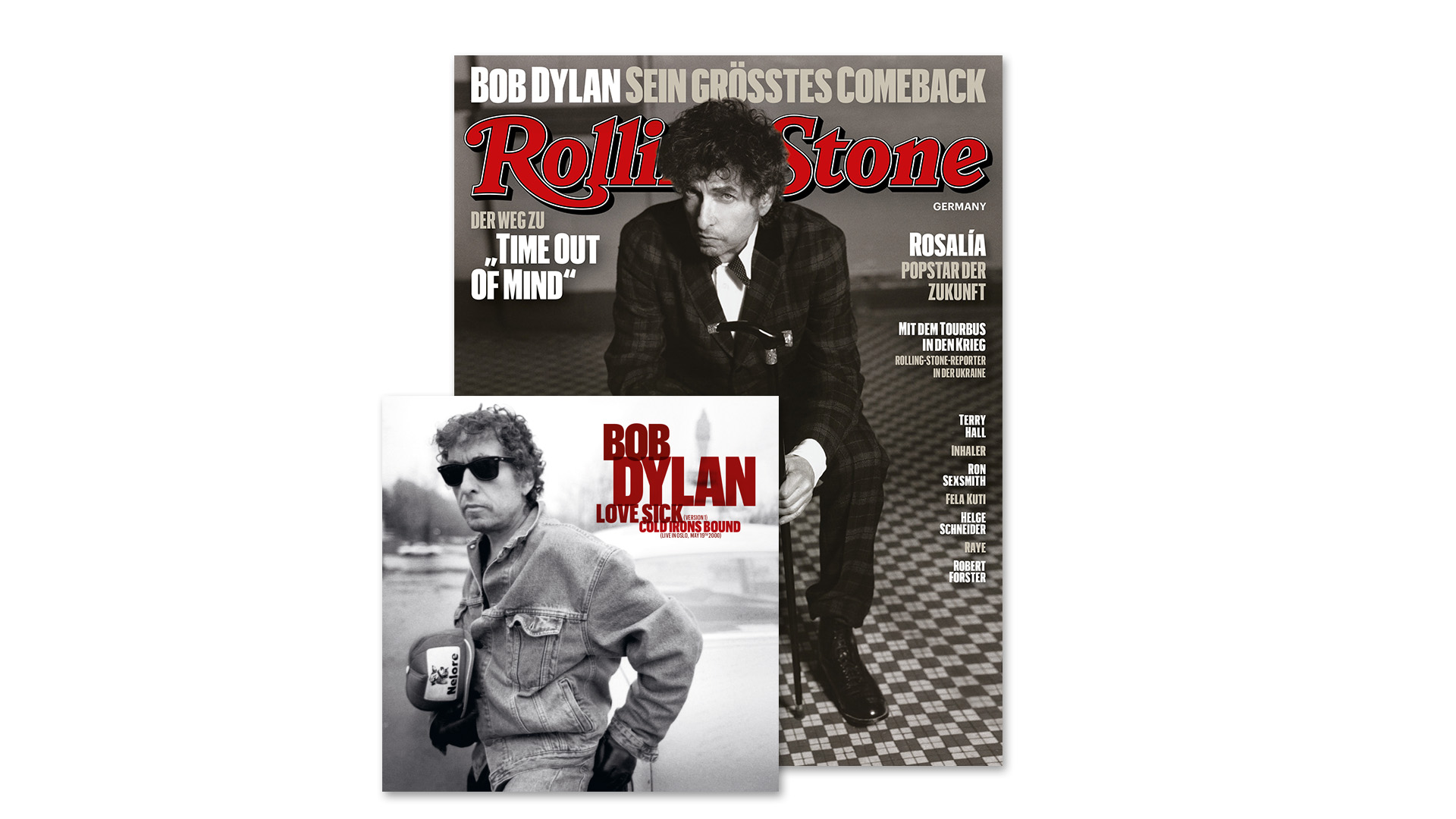Im Kampf gegen die Buchstabensuppe
Als Alleinunterhalter, Pianist, Jazz-Saxofonist, Regisseur und Autor krauser Kriminalromane ist Helge Schneider berühmt geworden. Zum 1. April stellt Allround- Künstler Schneider nun seinen neuen Film "Jazzclub - Der frühe Vogel fängt den Wurm" vor als auch einen neuen Krimi - Anlass für einige grundsätzliche Anmerkungen zu Absurdität, Spießbürgertum, Schreiben und Filmen
Schneewehen am Kölner Hauptbahnhof. Etwas ungeschickt versuchen Räumungsfahrzeuge dem meterologischen Ungemach Herr zu werden. Anscheinend müssen die das hier nicht ganz so oft machen. Ich eile zum nächsten Taxi.“Können Sie mich bitte ins Hotel Sofitel bringen, Kurt-Hackenberg-Platz 1?“ Der schon etwas zerknitterte Fahrer schaut mich an wie einen Irren. Ich wiederhole das Zauberwort „Bitte!“
Er zeigt nach vorn. „Das ist doch gleich da drüben.“ Und schüttelt verständnislos der Kopf. Touristen!
Ich danke also und verschwinde schleunigst, hin zum Hotel da drüben. Ein schwarzer Concierge drängt sich auf und beschreibt den Weg zum Konferenzraum „Wagner“, wo Helge Schneider zwei Tage lang seinen neuen „Film Jazz Club – Der frühe Vogel fängt den Wurm“ der Presse vorstellt Der Ort jedenfalls ist gut gewählt: Der Großkomiker aus Bayreuth trifft auf den jungen Mühlheimer Herausfrderer! Jung ist relativ, denn Schneider ist ja auch schon seit drei Jahrzehnten im Geschäft. In den späten Siebzigern tourte er mit den Jazz- und Jazz-Rock-Formationen Bröselmaschine und Tyree Glenn jr., den eigenen Bands Art Of Swing und El Snyder & Charlie McWhite, um schließlich ein Jahrzehnt später erste Erfolge ab Solokünstler zu feiern mit der bis heute allabendlich angerührten Melange aus angejazzter Schlagermusik und komischen Inpromptus. Seit Ende der Achtziger erscheint fast jährlich ein Album. Etwa seit „Guten Tach“ von 1992 kennt ihn auch das Mainstream-Publikum, spätestens aber seit der Doppel-CD „Es gibt Reis, Baby“ ein Jahr später. Er veröffentlicht Hörspiele, den ersten Teil seiner spannenden, witzigen und recht zu Herzen gehenden Autobiografie „Guten Tach, Auf Wiedersehn“ und dreht einen ersten Film, den psychedelischen Trash-Western „Texas – Doc Snyder hält die Welt in Atem“, der wie auch seine späteren Streifen („00 Schneider -Jagd auf Nihil Baxter“ und „Praxis Dr. Hasenbein“) den fröhlich-anarchistischen Infantilismus und die bisweilen genialische Komik seiner Auftritte durchaus einfängt, dessen allzu aufgesetzter Dilettantismus aber auch ganz schön an den Nerven zehrt 1994 erscheint sein Bestseller „Zieh dich aus, du alte Hippe“, der erste Band einer Reihe von Krimi-Persiflagen, die das Genre auf durchaus komische Weise mit surrealistischer Drogenprosa und Kasperletheater kreuzt. Im gerade erschienenen Band „Aprikose, Banane, Erdbeer – Die Satanskralle von Singapur“ ermittelt der schlecht gelaunte, sinnlos gewalttätige und alles in allem sehr eigene Kommissar Schneider nun schon zum fünften Mal. Einmal mehr liegen Licht und Schatten unter der Leselampe dicht beieinander, aber gelacht hat man am Ende doch wieder. Im letzten Jahr tat sich Helge Schneider zudem noch als Theaterautor hervor. „Mendy – das Wusical“ wurde im Mai am Bochumer Schauspielhaus uraufgeführt und ist dort immer noch regelmäßig ausverkauft. Die daraus hervorgegangene, von ihm ganz allein eingelesene und am Klavier vertonte Hörbuchfassung gehört zum Brillantesten, was er in den langen Jahren seiner Karriere abgeliefert hat. Der Text selbst ist albern, pointenreich, fast schon typisch Schneider, aber wie er hier die über 20 auftretenden Personen und Tiere nur mit seiner wandlungsfähigen Stimme und einem offenbar schier unerschöpflichen Repertoire an Dialekt-Imitationen zu unverwechselbaren, stets unterscheidbaren Charakteren formt, das hat man in vergleichbarer Güte sonst nur noch bei Heino Jaeger gehört. Und neben alledem zeugt dieser kreative Tausendsassa auch noch Kinder wie ein alttestamentarischer Patriarch. „So, wer ist der nächste!“ Ich höre seinen Stimme, bevor ich ihn sehe. Frau Hüttersen, die Pressedame, klärt ihn auf, und schon ruft er aufgeregt nach mir. „Wo ist der Mensch von den Rolling Stones?“ Er kommt grinsend auf mich zu. „Hallo Mick!“ Ein mittelgroßer Mischlingsrüde, den er Hank ruft, rennt um ihn herum. Helge Schneider trägt Trainingshosen und Parka mit Pelzbesatz wie ein Rapper und muss jetzt erst mal zu einem Fototermin. So bekomme ich noch die Gelegenheit, die erste halbe Stunde seines Films zu sehen. Schneider ist Teddy Schu, ein erfolgloser Jazzmusiker, der als Zeitungsausträger, Fischverkäufer und als „Mann für gewisse Stunden“ arbeiten muss, um sich und seiner ebenso ignoranten wie anspruchsvollen Frau die Subsistenz zu sichern. Und gleich in der ersten Szene muss er ran, nämlich als grandios radebrechender Latin-Lover an eine vollschlanke Kittelschürze, die vor lauter Aufregung, weil sie das zum ersten Mal macht und ihr Mann ja nun nicht da ist, nur noch japsen kann. Das geht ja schon gut los!
Nach 20 Minuten stößt Schneider dazu, Hank an seiner Seite, isst ein Filetsteak, das da schon eine Weile für ihn bereitsteht, und spricht hin und wieder mit verstellter Stimme und absolut synchron einige Dialoge mit. „So, jetzt bin ich satt, wolln wa anfangen? Wird ja immer später. Mensch, ich muss nach Hause, die Eisenbahn wegbringen. Ich habe ’ne Modelleisenbahn, die macht Puff-Puff-Puff, und das ist kaputt.“ Hank legt sich ab und knurrt, während er sich den Bauch leckt.
Schneider zeigt zum Fernseher, grinst konspirativ. „Bücher sind besser wie Filme, ne? Ich sag dir auch, warum: weil man da alles schreiben kann. Beim Film kannste doch nicht alles zeigen. Das versteht doch keiner. Ich glaube, das Gehirn sieht viel mehr, als man tatsächlich zeigen kann.“ Ich erzähle ihm, dass ich seine Krimis gelesen hätte, auch den neuen, dass sie aber allesamt, auch wenn sie sprachlich avancierter und unterm Strich witziger seien, gegen die Autobiografie nicht bestehen könnten. Die Fallhöhe ist einfach größer. Während er sich bei den Krimis hinter der Kolportageform verstecken kann, gibt er hier ja tatsächlich etwas preis.
„Das ist einfach so, gegen das wahre Leben kommt nichts anderes an. Die Autobiografie kannst du vergleichen mit Bühnenauftritten. Das ist auch diese wahre Ebene. Alles andere ist nur Konserve. Was heißt nur… Es ist halt was anderes. Ich habe mich hingesetzt und gesagt, so, jetzt schreibe ich was. Es kommt dann alles auf den ersten Satz an, denn der muss immer monumental sein. ‚Zieh dich aus du alte Hippe‘ fängt zum Beispiel so an: ‚Über dem Herd ist eine kleine Lampe angebracht, damit man das Essen besser sieht Um die Lampe herum summen Wespe, viele.'“ Frau Hüttersen kommt herein, um nach dem Rechten zu sehen, gefolgt von einer Kellnerin, die uns Kaffee bringt. „Haste Nachtisch gefunden?“ ruft er der Pressedame zu. Sie nickt. „Watt denn?“ Sie lächelt und spitzt den Mund. „Surprise.“ Schneider macht sie nach. „Sürprieß!“ Er wendet sich an die Bedienung. „Und Zucker ist das hier, ne?“ Er zeigt auf die kleine Silberschale mit bunten Tütchen. Ja.“ Sie muss lachen, weil das ja nichts anderes sein kann und weil Helge Schneider so etwas sagt. „Hmmm, lecker Zucker!“ schnurrt er. „Wo waren wir stehen geblieben?“ „Beim monumentalen ersten Satz.“ ,Ja, der ist immer wichtig. Bei einem anderen Buch geht der so: ‚Aschfahl klebte der Mond am Fenster. Das Haus stand im Schatten einer großen Kastanie.'“
Schneiders Prosa ist tatsächlich nicht ganz ohne. Er sampelt Kinderslang, Lautmalereien („Krabbel, Krabbel, Poprabbel“) die mediale Nullsprache, Irrsinns-Lyrik, Kolportage-Fetzen – und das alles wird zusammengehalten von einer beflissenen Gestelztheit, wie man sie aus schlechten Schüleraufsätzen kennt Außerdem ist er ein gar nicht untalentierter Wortspieler. Er verwendet ausgelutschte Bilder und montiert sie in schiefe Zusammenhänge, verhunzt Phrasen und Sprichwörter, erfindet infantile Neuschöpfungen (also „verschnelligen“ für „beschleunigen“, „sich verschüchtern“ für „zurückhalten“ etc.), all das zumeist mit dem Zweck, der Sprache den Ernst auszutreiben und nicht zuletzt den Sinn.
„Dichtung, eine große Welt verdichtet in drei Sätzen, das ist eigentlich das, was ich mache. Auf die Schönheit der Worte kommt es mir an. Genau so ist das ja auch bei meinen Liedern. Schönheit mit wenigen Worten zu erzeugen und das Ganze dadurch unvergessen zu machen. Wie zum Beispiel ‚Katzeklo‘.“ Er lacht selbst darüber. „Hört sich jetzt banal an, aber das war eine wirkliche Eingebung. Wenn ich so eine Eingebung habe, eine durch Improvisation entstandene Eingebung, dann denke ich, aha, das akzeptiere ich jetzt als von mir erfunden. Das ist dann einfach da, das ist ein Fakt. Und so schreibe ich auch meine Bücher. Ich gehe tagelang vor der Schreibmaschine hin und her, ich gehe an ihr vorbei, und dann denke ich, jetzt musst du aber was schreiben. Und wenn ich mich hinsetze und mich konzentriere, dann soll mir das auch selber Spaß machen.“
Wie ein Generalbass wummert durch alle Romane dieser manierierte, die Gattungsgepflogenheiten um eine vielfaches übersteuernde Hardboiled-Sound. Ich frage ihn, ob er die entsprechende Literatur als Vorlage benutzt oder einfach durch langjährige Lektüre intus hat. Früher habe er die alle mal gelesen. „Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Jerry Cotton. Jerry Cotton ist gut. Fast jeder dritte Satz ist da: ‚Ich schnippte eine Camel aus der Packung.‘ Eine Wiederholung ohne Ende. Und das hasse ich ja eigentlich.“ „Phil hechtete hinter meinen Jaguar“, ergänze ich. „Genau, Phil Decker!“ Er lacht schallend. „Zu Chandler fallt mir ein Satz ein, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf, ich glaube aus ‚The Big Sleep‘ ist der: ‚Der Morgen war hell und klar. Ich hatte einen Scheuerlappen im Mund.‘ Das könnte von mir sein. Das ist ja auch schon Parodie. Chandler parodiert Hammett, ganz extrem sogar. Wie fängt mein neuer Roman an? .Der graue Beton rast durch sein Hirn. Gitterstäbe schauten ihm über die Schulter und warfen Schatten auf seine Seele.‘ Das sind so Manierismen, könnte man ja fast schon sagen.“ Er lächelt etwas verschämt, als sei es ungehörig, so etwas zu behaupten. Darauf aber scheint es ihm anzukommen, das Plotting jedenfalls nimmt er nicht sehr ernst.“Das ist auch etwas, das mich von anderen Krimi-Autoren total unterscheidet. Die machen das alles bewusst Und ich lasse mich treiben, wie im wirklichen Leben.“
Nun ist Schneider eigentlich alles andere als ein Kriminalschriftsteller. „Ich sehe mich eigentlich als Helge, der sich erdreistet, als Kriminalautor über 120 Seiten zu schreiben. Anders als wenn ich auf die Bühne gehe – das bin ich und nix weiter. Im Buch bin ich auch ich, aber hier arbeite ich mit der Idee, Krimiautor zu sein. Aber das ist etwas, was ich total gern mache. Endlich habe ich die 50 Schreibmaschinenseiten geschrieben, einen tollen Schluss gefunden, ein schönes Bild gemalt, das ist für mich ein großer persönlicher Erfolg. Dadurch hat man ja etwas für die Ewigkeit geschaffen. Mit Konzerten schafft man was anderes, das ist für den Moment.“
Wieder betritt die Kellnerin Raum „Wagner“, diesmal mit dem Überraschungs-Nachtisch. Schneider sieht ihn sich an und ruft laut: „Hank, dein Essen!“ Aber das scheint die junge Frau nicht ganz so lustig zu finden. „Bücher leben lang“, fährt er fort, „außer im Dritten Reich, da ist ja immer so viel verbrannt worden. Immerhin, meine Tante Helmi hat einen Brockhaus gerettet.“ Er löffelt seinen Nachtisch, der ihm offenbar doch zu schmecken scheint „Am meisten freue ich mich darüber, dass meine Ideen in einem Buch festgehalten sind und dann in einem Regal stehen in der Bücherei. Das ist für mich ganz wichtig. Noch toller finde ich es, wenn so ein Buch als Lehrstoff benutzt wird. Gibt es.“ Er nickt ganz ernst. „Gibt es alles.“
Ich spiele den konsternierten Bildungsbürger. „Was alles so unter Literatur firmiert heutzutage …“ Er versteht den Witz, rechtfertigt sich aber trotzdem gleich. „Ich habe mal meine Literatur verglichen mit der von bekannten Autoren, und ich muss sagen, da gibt es schon ganz schön haspelige, langweilige Sachen, Bücher mit 500 Seiten, in denen absolut nichts los ist Und da ziehe ich doch die Dichtung vor. Also ich bezeichne das, was ich mache, als Dichtung. Das ist mehr oder weniger Lyrik, so bezeichne ich das. Da müssten meine Bücher eigentlich stehen, in der Lyrik-Abteilung.“
„Im schlechtesten Fall“, werfe ich ein, „stehen sie in der kleinen Humorecke zusammen mit Karikaturbändchen und…“Lisa Fitz!“ Ja, das wäre schlecht Ich habe zum Beispiel dieses Werk von Salman Rushdie gelesen, ‚Die satanischen Verse‘, furchtbar langweilig. Das ist das Gegenteil von Schreiben, mit vielen Worten möglichst wenig zu beschreiben. Das liegt mir nicht, aber es gibt sehr viele Schriftsteller, die so sind. Das sind dann die dicken Schinken. Die Leute wollen Buchstaben lesen, zu viel Buchstabensuppe gegessen -.“ Grinsend widmet er sich wieder der Nachspeise. „Aber nicht, dass du jetzt den Eindruck kriegst, ich wäre ein Angeber, meine Bücher wären die besten, die es gibt. Damit du Bescheid weißt: Ich mache das aus Spaß, total aus Spaß.“
Ich frage ihn, ob es – abgesehen von den Krimis bei ihm weitere beeindruckende Leseerfahrungen gab, die sich niedergeschlagen haben könnten in seinem Werk.
Er lacht einmal hart auf. „Die eisernen Särge‘! Es geht da um die U-Boot-Kriege im ersten und zweiten Weltkrieg. So etwas hat sicherlich Niederschlag gefunden. Das war eine Art Logbuch, ein Tatsachenbericht von einem Kapitän Günther oder so, das war ganz interessant, sich in diese Welt mal hineinzudenken. Wenn man diese Hieroglyphen mal durchgelesen hat, hat man völlig die Atmosphäre aufgesogen, die da geherrscht hat, sechs Monate in sechzig Meter Wassertiefe zu verbringen, keine frische Luft zu kriegen, eigentlich ein Horrorbericht. Solche Tatsachenberichte haben mich immer etwas interessiert, weil diese Realität so absurd ist, jeder Krimi oder sogar ein Buch wie ‚American Psycho‘ ist dagegen Biene Maja!“
Auch in den Schneider-Krimis wird viel gemetzelt. Nicht zuletzt der Held selber ist ein rechter Schlagetot, der weiß, dass, wo gehobelt wird, auch Blut spritzt. Entsprechend filigran sind gerade die Splatter-Szenen gearbeitet, man merkt ihm den Spaß an.
„Im ersten Schneider-Buch ist es fast zu viel, im neuesten ist es romantischer, und vor allem, das wird dann hinterher auch immer wieder zurückgenommen. Dazu gehört auch, dass die Satanskralle von Singapur als netter Mensch dargestellt wird. Der kann ja nichts dafür. Das war mir besonders wichtig, und dadurch wird das ja nur noch brutaler, ne? Das war mir besonders wichtig, um dadurch auch mal zum Nachdenken anzuregen, wie solche Leute überhaupt zu Mördern werden. Die werden ja nicht so geboren.“
Ich falle darauf herein und moniere, dass das ein ganz alter Hut sei, dass man nun wirklich nicht noch mal darauf hinweisen müsse, dass Mörder die Opfer der Gesellschaft seien. „Jaja“, sagt er da verschmitzt, winkt ab und löffelt leise vor sich hinlachend weiter.
Wir reden über Gewalt in der Kunst, über Filme wie Tarrentinos „Pulp Fiction“ oder Kubricks „Gockwork Orange“, die einen ähnlich ironisch-sarkastischen Umgang mit Gewaltdarstellungen pflegen. „Clockwork Orange“ hält er durchaus für einen „Meilenstein“, „Pulp Fiction“ mag er nicht. „Und ich sag dir auch, warum: weil die Brutalität sich in Grenzen hielt. Und zwar, typisch amerikanisch, ist es dabei geblieben, einem die Birne wegzublasen. Und das ist mir zu wenig.“ Ich frage ihn, was er denn statt dessen gern noch gesehen hätte. „Na, dass die den mit einem Butterbrot aufstippen, oder zersägen und die Teile einfrieren oder durch den Wolf drehen und solche Sachen. Das wäre eine Überhöhung, und dadurch wäre das nicht so typisch amerikanisch. Das mag ich nicht, das ist mir alles viel zu realistisch. Ich würde das ohnehin nur andeuten. Gerade im Film finde ich es besser, wenn man das nicht so sieht. Das muss weiter weg sein von der Realität lyrischer. Aber auch filmischer. Zum Beispiel Fritz Lang. Da geht einer her, und dann siehst du den nicht mehr, sondern nur noch seinen Schatten, und dann siehst du plötzlich ein riesiges Messer, auch nur als Schatten, und das kriegt er in den Rücken. Das ist für mich eine filmische Sprache und total bombastisch. Wenn du so etwas direkt zeigst – nichts mehr! „Belphegor“ fallt mir dazu auch noch ein, kennste den? Mit Juliette Greco. War mal eine Fernsehserie in den 60er Jahren. Im Louvre haust ein Monster, und das heißt Belphegor. Ganz schlecht, das ist noch schlimmer als Edgar Wallace. So ein Kerl mit einer Goldmaske, taucht immer mal auf und bringt die Leute um. Man hat den nie gesehen, man sah dann immer einen Schatten verschwinden, und dann lag da jemand. Und dann hat der Kommissar immer gesagt: ‚Er hat Würgemale!‘ Haste auch nicht gesehen. So würde ich den neuen Roman verfilmen. Weiter weg. Und dann geht das auch billiger. Musst auch mal daran denken.“
Seine ästhetischen Präferenzen entstammen offenbar einer anderen Zeit Solche Anachronismen begegnen einem häufiger in Schneiders Werk. Immer wenn er zum Beispiel Alltagswelten, das Leben in der Familie beschreibt, scheint da recht eindeutig, wenn auch komisch verzerrt die eigene autoritäre, kleinbürgerliche, ziemlich spießige 5Oer-Jahre-Kindheit durchzuscheinen.
,»Ich habe diese Zeit ziemlich bewusst mitgekriegt Es war eine Schwarz-Weiß-Zeit Ich habe noch so ein paar Aufnahmen aus der Zeit Später auch Super-8-Filme, die waren farbig, und trotzem siehst du irgendwie keine Farben. Unser Haus war grau, das Dach war grau, meine Vater hatte einen mausgrauen Anzug, und dann hat der einen grauen Hut aufgehabt die Autos waren grau, es gab ja auch noch wenig Reklame, und wenn dann eben schwarz-weiß. Und in dieser Zeit fand man Leute lustig wie Ludwig Erhard oder Adenauer, als Karikaturen in der Zeitung. Das waren die einzigen Malereien in der Zeitung, und allein deshalb hat man schon gelacht bloß weil die gezeichnet waren. Diese Eindrücke haben mich natürlich geprägt Wenn ich da mal zur Bude gewackelt bin und Bonbons gekauft hab, zwei für einen Pfennig, und mein Vater hatte das gesehen, dann musste ich mit meinem Vater zur Bude zurückgehen und die beiden Bonbons zurückbringen. Dann habe ich den Pfennig zurückgekriegt, und mein Vater hat dem Typen eine Standpauke gehalten. Aus so einer Zeit stamme ich eben. Aber man merkt das ja gar nicht, das sind so Sachen, die man einfach mitnimmt. Wir hatten ja sogar einen Goldfisch in so einem Bowleglas auf dem Schrank stehen, das ist die totale Karikatur, aber wir hatten so etwas tatsächlich auf dem Schrank stehen.“
Auch seine Komik speist sich ja aus dieser Zeit, indem sie gewisse Gesten, Sprüche, Weltanschauungen etc. zitiert. Oft ist das ja geradezu Meta-Komik, sind es Witze über diesen miesen alten Witze, über den Nonsens und das Gekalauere jener Jahre. Und das macht diese Komik für viele so verstörend. Während sich beim handelsüblichen Kabarettist hinter der Pointe allemal die so gebrandmarkte schlechte Realität zeigt, ist da bei ihm nur ein weiterer Witz. Diese Komik hat keinen Standpunkt, auch keinen Gegner, sie ist sich selbst genug.
„Gar kein Boden“, nickt et, „die bodenlose Frechheit. Aber ich mache mich nicht lustig über diese schlechten Witze, ich lache nur darüber. Wenn ich eine gute Zeit habe, dann streue ich solche Pointen mal ein, ja, aber das ist auch nicht immer so. Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, eine Beschreibung von dem, was ich da mache, auf der Bühne speziell, ist total schwer. Weil das so breit gefächert ist, weil da alles mögliche vorkommen kann. Vor allem aber der Moment mit dem Publikum ist ganz wichtig. Wenn ich zum Beispiel in Baden-Baden spiele und Tony Marshall sitzt da mit seiner Familie in der ersten Reihe, und ich höre den dauernd lachen, weil ich gesagt habe, Bata Illic ist einer meiner größten Vorbilder, dann bemerke ich das und denke, oh, jetzt darfst du aber nicht seinen Namen nennen. Jetzt erwarten die Leute aber so etwas, die sehen den ja auch, also muss ich schnell ganz woanders hin, und dann kommen so Sachen zustande, die man überhaupt nicht mehr beschreiben kann. Das ist nicht ironisch, nicht witzig, das ist einfach eine Reaktion auf das, was gerade passiert ist. Dann sage ich zum Beispiel: Hier ist ja was los, da habe ich eben im Cafe 100 Omas Romme spielen sehen, und meine, da wäre die Nichte des Zaren dabei gewesen. Aber ich weiß eigentlich gar nichts über diese Stadt Und dann sage ich noch, oh, zehn Uhr dreißig, dann haben wir ja hier bald Geisterstunde. Und dann grölen die alle, und ich weiß nicht so genau, warum. Da hat der Tony mir später erzählt, um zehn Uhr dreißig sei hier wirklich niemand mehr auf der Straße, und die Nichte des Zaren hätte hier neulich ein Haus gekauft oder so etwas. Das sind totale Zufälle, und davon lebt so ein Abend. Das ist auch manchmal gar nicht so, dass etwas irgendwie witzig ist, aber die Leute lachen darüber, weil sie sich etwas anderes darunter vorstellen. Das ist auch ganz oft so, das darf man nicht unterbewerten. Das ist auch eine Sache des Lebensgefühls von den Leuten, die da sitzen. Die sehen mich einfach und denken, jetzt kommt gleich wat Lustiges. Und dann sage ich, der Papst ist gestorben, und alle: Hahahaha. Absolut unlustig. Über den Papst zu reden ist sowieso langweilig, wenn er tatsächlich tot wäre, wäre es doppelt langweilig. Warum lachen die, sag mir das mal?“,,Die haben Eintritt bezahlt und hätten einfach gern, dass es sich gelohnt hat Und je mehr Eintritt die bezahlt haben…“ – „Desto lauter lachen die, das ist mir auch schon aufgefallen.“ In seiner Autobiografie beschreibt er sich als so eine Art musikalisches Wunderkind, das aber immer Fehler macht, wenn es in ein Korsett gezwängt wird, etwa vom Blatt spielen muss. Hier hat man sozusagen den Schlüssel für das spätere Werk, denn da wird das Falschmachen geradezu zum Strukturprinzip erhoben. Im Grunde kann es bei ihm gar keine Fehler mehr geben, weil sie integraler Bestandteil des Show-Konzepts sind. ,Ja, das ist der Vorteil. Das ist das Schöne an meinem Beruf, den ich mir selber erfunden habe. Ich kann Fehler akzeptieren. Und das ist auch der Grund, warum die Konzerte immer gut besucht sind. Die Leute wissen das. Das heißt, da ist einer, der macht zwar auch jede Menge Show und so was, aber diese Show ist echt Das ist mein absoluter Vorteil gegenüber anderen Leuten, die Lampenfieber haben und ihr Programm vorher ausdenken müssen. Ein absoluter Vorteil. Ich kann jetzt also irgendwo hinfahren, mir die Stadt ankucken, alles schön aufbauen, kucken, dass die Präsentation gut ist, also Licht usw., und dann einfach auf die Bühne gehen. Vorher überlege ich mir, was ich mitnehme, aber nicht, was ich spiele. Dafür muss man das natürlich schon eine Weile machen. Inzwischen ist es so, dass ich mir mein Publikum schon in diese Richtung erzogen habe. Wenn ich die alten Sachen trotzdem bringe, dann freuen die sich total Und das sind so Lorbeeren, auf die ich mich ausruhen kann.», auf denen ich mich ausruhen kann. Ist da doch noch ein Fehler gekommen, ne?“