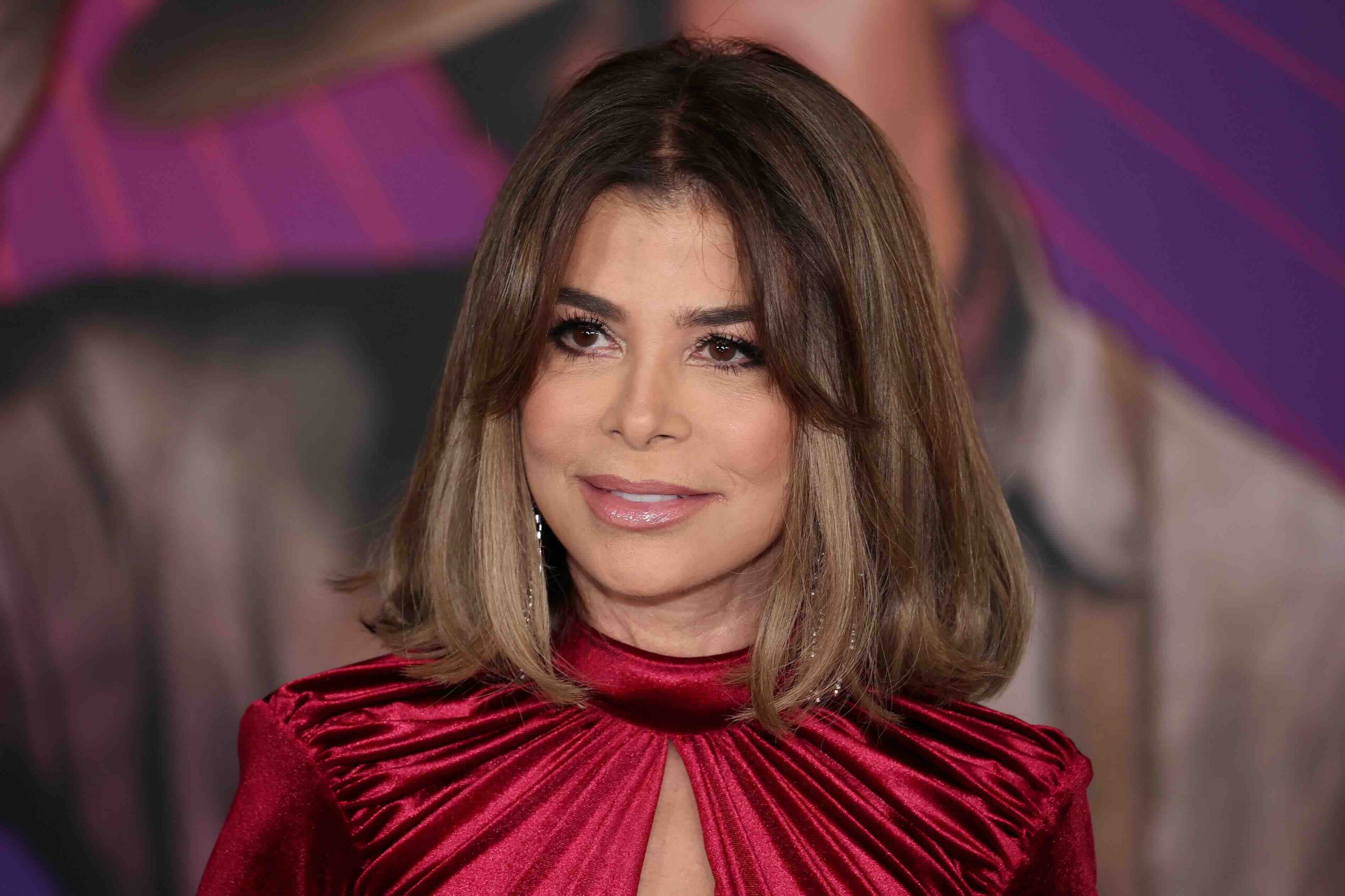Melt!: No sleep till Sunday. Der Nachbericht.
Schlaflos ist man entweder in Seattle oder auf dem Melt! Festival bei Dessau. Daniel Koch war am vergangenen Wochenende vor Ort und konnte sich kaum gegen das Tempo des Indie- und Elektrofestivals wehren. Er zeigte aber auch wenig Gegenwehr. Hier der Nachbericht.
Am Sonntagmittag plötzlich, zum ersten Mal, ein Moment der Ruhe, des Durchatmens, des Rumschluffens und des Kräftesammelns – und vor allem: des Stillsitzens. Die Besucher des Melt! Festivals, die schon auf dem Gelände sind, hauen sich in Schatten oder Sonne und lauschen den Klängen der DJs von Melanie Melancholie – die ihrem Namen alle Ehre machen und wehmütige Klänge von Postal Service und Konsorten über das Gelände wehen lassen. Fast kommt es einem so vor, als hinge ein jeder gerade seinem persönlichen Flashback nach. Was habe ich die letzten Tage so alles erlebt? Was war denn eigentlich da los?
Keine Frage, das Melt! in Gräfenhainichen bei Dessau ist eines dieser Festivals, das auf totale Reizüberflutung setzt und gar nicht Stillstehen will. Selbst wenn hier auch die klassischen Indiefestival-Bands zum Tragen kommen, funktioniert das Festival eher nach den Regeln des beatbetriebenen Clublebens: Die Konzerte beginnen am späten Nachmittag und enden – allerdings nur auf den Hauptbühnen – zu den Zeiten, in denen man sich sonst sein Butterbrot für die Arbeit schmiert. Auch optisch weiß man auf dem Melt! nicht so recht, wann sich die Augen mal ausruhen können. Die Kulisse der „Stadt aus Eisen“ Ferropolis – einer Veranstaltungsstätte inmitten riesiger alter Braunkohlebagger – ist an sich schon eindrucksvoll genug, wenn man dazwischen nun aber auch noch eine Sternenkrieg-ähnliche Light- und Lasershow inszeniert, hat sich’s was mit Augenpause.
Erst am Sonntag kommt es dann zu den beschriebenen Momenten des Innehaltens. Dieser dritte Tag, der erst seit drei Jahren genutzt wird (seitdem man 2008 Björk als Headliner bekam, die aber nur sonntags Zeit hatte), bespielt nämlich nur noch einige wenigen Bühnen und ist somit ein fast geruhsamer Ausklang des Festivalwochenendes – der sich in diesem Jahr dankenswerterweise auch mal im schönsten Sonnenschein zeigte, was nach zwei Jahren Schittwetter auch mal wieder Zeit wurde. So konnte man die (Melanie) Melancholie-Stunde in der Mittagszeit nutzen, mal kurz Revue passieren zu lassen, was denn eigentlich so los war…
Der Freitag stand ganz im Zeichen alter Bekannter – was auch einer der wenigen Kritikpunkte ist, den man dem Melt! in diesem Jahr vorwerfen konnte. Bonapartes Tanzrevue-meets-Zirkusshow-meets-Freakparade-meets-Disco-Schreddel-Punk auf der Hauptbühne wirkte paradoxerweise im Sonnenlicht ein wenig blasser als sonst, riss aber zumindest jeden mit, der sie noch nicht kannte (was im Berliner Umfeld zugegebenerweise nicht mehr sooo viele sein dürften). Ihr nächtliches Zusammentreffen mit Modeselektor an der Beach-Bühne fand da schon mehr Zulauf – führte aber dennoch zur Einsicht, dass Mr. Bonaparte und seine Mitmusiker das bis dahin gelungene Set eher zusammenschrieen als bereicherten. A propos Schreien: Das können Health aus Los Angeles bekanntlich besser. Wie sie es mit ihrer zwischen Screamo, Noise und Shoegazer-Pop lavierenden Sound allerdings hinbekommen, dass auch das Electro-Volk anspringt, wird ihr Rätsel bleiben. Kele, der Bloc Party-Sänger auf Soloausflug, brachte mit seinem zwar schnell zusammengeschusterten, aber packenden Songs das Gemini-Zelt zum Schwitzen und mit seiner nicht gerade hässlichen Aussehen sicher auch so manche Hete auf komische Gedanken. Erfreulich auch, dass der smarte Two Door Cinema Club offenbar nicht nur was für die Kleinen ist, sondern zumindest als leichte Kost zum Gut-drauf-Tanzen an einem sonnigen Festivalfreitag zu Massenaufläufen führen kann. Was Delphic im Anschluss mit Coolness made in Manchester gut weiterzuführen wussten.
Tagessieger war ein weiterer Bandsänger auf Solopfaden: Jónsi, der sonst bei Sigur Rós abwesend am Mikro seine Gitarre bogenstreicht, war beim Live-Vortrag seines wunderbaren Albums „Go“ geradezu euphorisch-exaltiert und tanzte am Ende gar in bunten Kostümen zu den aufwendigen Bühnenvisuals – dass er dabei aussah wie der Rettich aus der alten Bonduelle-Werbung. Geschenkt! The xx spalteten im Anschluss wieder die Gemüter, in dem sie das machten, was sie immer machen: Ihre ätherische, minimalistische Popmusik konzentriert und mit kühlen Visuals auf die Bühne bringen. Es bleibt ein Rätsel, warum viele noch etwas anderes erwarten und denken, dabei könne es irgendwie „abgehen“ (wie ein Nebenmann forderte). Ob’s daran liegt, das The xx-Songs gerne in schnelleren Versionen geremixt werden? Man weiß es nicht. Wohl aber, dass ein Jeder, dem die Live-Version von „VCR“ nix gibt, ein Herz aus Stein haben muss. Die Foals im Anschluss sorgten dann wieder für mehr Bewegung, mal mit ihrem fickerigen Frühwerk, wie im Hektiker „Cassius“, mal mit dem hymnischen Titeltrack ihres Albums „Total Life Forever“. Der beste Moment war dennoch ein ruhiger: „Spanish Sahara“, bedächtig in die Nacht gehaucht, zum Runterfahren der Puls-Frequenz.
Um selbige zu befeuern, wie man es auf dem Melt! zu tun pflegt, gab’s zum Abendausklang wieder viele Möglichkeiten: Booka Shade, Autokratz, Ricardo Villalobos und von fünf bis Frühstück Simian Mobile Disco – wohl der vorzeigbarste Act, für die vom Festival gelebte These, dass man es einem Indie-affinen Publikum auch mit Beats besorgen kann. Bei SMD sogar in der eigenen Bandkarriere vorgelebt, denn das Duo war ja auch mal Teil der (Indie-) Band Simian.
Nach drei Stunden Schlaf und ein paar Stunden Baggersee (immerhin ist man ja auf einer Halbinsel im selbigen) kratzte man sich ein wenig am Kopf, was denn der von Grönemeyer so hoch gelobte Schmachtbarde Philipp Poisel auf der Hauptbühne zu suchen hatte. Dann lieber die Hot Chip nacheifernden Holy Ghost! aus New York, die zwar mit computerzerfrickeltem Pop überzeugten, aber lieber einen Großteil ihrer Zeit mit dem Soundcheck vertendelten. Der Auftritt von Hurts im Anschluss bot derweil einen bizarren Anblick: Ein Sänger aus Manchester, der aussieht wie Max Raabes Zwillingsbruder (und trotz Bullenhitze ebenso gefrackt gekleidet ist), ein Keyboarder, der aussieht (und Keyboard spiel), als wäre er gern bei Depeche Mode angestellt und ein Backgroundsänger, der aufgeplustert in Bauch-rein-Brust-raus-Pose ebenfalls im Anzug die meiste Zeit stillsteht und grob geschätzt bei einer Handvoll Textzeit zu hören ist. Dennoch sind ihre bewusst pathostriefenden Songs zwischen Tears For Fears und East 17 (wahlweise Take That) so verdammt zubeißende Ohrwürmer, dass man dann doch zu gerne beim „Wonderful Life“ mitsingt. Bodenständiger und live mal wieder viel punkiger als auf Platte, ging’s bei Jamie T zu, der als Intro den wunderbaren Song „The Man’s Machine“ wählte, bei dem bekanntlich eine Ansage der Angelic Upstarts gespielt wird: „You’re the punk that I’ve been waiting for. You’re it!“ Genau so wars.
Aber man kam ja zum Tanzen her, und das ging am Samstag sehr gut bei Jamie Lidell (so fern man nicht mit offenem Munde auf die Bühne starrte), DJ Shadow, Chromeo, neuerdings ja auch vorzüglich bei Die Sterne, bei Carl Craig und bei Schlachthofbronx, zwei Münchenern, die den Spirit und den Bass des Baile Funk aus den Boxen bollern und dabei herrlich grenzdebile Ansagen ins Mikro brüllen. An der Strandbühne, mit Sand unter den Füßen und in den Schuhen funktionierte das ganz prächtig. Tausende Menschen mit in die Luft gereckten Zeigefingern, die am Ende eines Liedes in regelrechten Sandtunneln standen, waren die logische Folge. Der mit Spannung erwartete und mit großen Tönen des Künstlers angekündigte „Auftritt“ von Videoclip-Künstler Chris Cunningham („All Is Full Of Love“ von Björk und Aphex Twins „Come To Daddy“ gehen auf seine Kappe) geriet dann allerdings zur Enttäuschung. Ein DJ-VJ-Set sollte es werden, Cunningham tönte zuvor in Interviews, er wolle die optimale Verschmelzung von Sound und Bild – am Ende sah man jedoch nur perfekt ausgeleuchtetes Musikfernsehen, das erschreckend oft langweilte, und nur manchmal überzeugte, zum Beispiel als sich geisterhaft verwehte Muskelpakete zum Takt des Beats vertrimmten, oder als Cunningham ein schlafendes Kind verunstaltete und zu elektronischen Störgeräuschen Mundwinkel, Augen und Ohren in groteske Grimassen zog und zerrte. Der Künstler selbst war jedoch auf der Bühne nicht zu sehen. Oder er versteckte sich hinter seinen Leinwänden.
Der spätnächtliche Auftritt von (Modeselektor plus Apparat gleich) Moderat war dann in Sachen Beat-Tempo fast ein wenig zum Runterkommen, da einige ihrer Songs ja doch recht schwelgerisch geraten sind. Passte aber vorzüglich in die bis unter den Himmel ausgeleuchtete Nacht, die sich da unter einem Dach aus Lichtscheinwerfern ausbreitete. Und die man gefälligst im Morgengrauen mit einem Sprung in den See beendet.
Nach diesen zwei Tagen ging man den Sonntag dann also ein wenig ruhiger an und freute sich, dass das Bandangebot ein wenig überschaubarer wurde. Nach dem DJ-Einklang von Melanie Melancholie klampften die Kings Of Convenience gegen ein dauermurmelndes Publikum an, das zwar jeden Quatsch von Erlend Oye beklatschte, jeden Song mit frenetischem Jubel bedachte und trotzdem nicht die Fresse halten konnte. Wer wenig später wieder Zuppeldrang in den Zehen spürte, der wurde auf der zweitgrößten Bühne gut bei Laune gehalten, zum Beispiel bei Fred Falke, der Robyns „Dancing On My Own“ in etwas schneller remixte und seinen eigenen Remix live per Bassgitarre begleitete. Riton im Anschluss war dann der Typ für’s expressive Beinausschlagen und für die schweißtreibenden Dancemoves, bevor das englische Ex-Phantom Fake Blood an der Reihe war.
In der Zeltbühne gab’s derweil Kontrastprogramm von Fucked Up – will sagen: souveräner Auf’s-Maul-Hardcore mit einem Blick- und Dickfang von Sänger, den man mehr im Publikum sah, als auf der Bühne. Den Ausklang hier besorgten WhoMadeWho aus Dänemark, die sich dem Melt! inzwischen so verbunden sehen, dass sie ihm mit „Gigantische Stahlgiganten“ (das Ding heißt wirklich so) gar eine eigene Hyme sangen.
Massive Attack machten dann auf der Hauptbühne das Licht aus, nachdem sie sie zuvor anderhalb Stunden auf’s eindrucksvollste in selbiges getaucht hatten. Manch einer mag ihren hypnotischen TripHop-Entwurf ein wenig einlullend finden, wer sich aber auf die Kellerbässe, den dunkel grummelnden Gesang und die ambitionierte Verquickung von Pop und Politik einließ, wurde gut unterhalten – und diesmal, im Gegensatz zum Hurricane-Gig vor einigen Wochen – auch in einem passenden Rahmen, vor einem beeindruckten Publikum. Für jeden Song gab es eine eigene Text-, Visuals- und Live-Show, die zum Beispiel aus Funksprüchen aus dem Afghanistankrieg bestanden oder aus Zahlen und Fakten, die so zusammengeschnitten wurden, dass man sich so manchmal fragte: In welcher Welt leben wir eigentlich. Ach ja, für das deutsche Publikum hatten sie sogar die ganze Show übersetzten lassen – wie sie es in jedem Land tun. Dazu gab es ein Best of-Set, dass auch „Teardrops“ und „Unfinished Sympathy“ nicht verschmähte, in beiden Fällen wunderbar vorgetragen von der befreundeten Martina Topley-Bird.
Nach drei Tagen Melt! (also so gut wie immer wach), die man entgegen der Meinung von Lützenkirchen nicht „druff, druff, druff“ (der Song war 2008 die offizielle Melt!-Hymne) durchleben musste, mag sich das Wochenende hier nun recht aufgeräumt lesen – wer hin möchte, sollte sich aber dennoch vor Augen führen, dass man sich dort einem Sog aussetzt, dem man sich schwer entziehen kann. Zu Risiken und Nebenwirkungen steht der Autor dieser Zeilen gerne zur Verfügung…
Daniel Koch
Infos und Bildergalerien und dergleichen finden sich auf www.meltfestival.de.
Foto: Janina Gallert