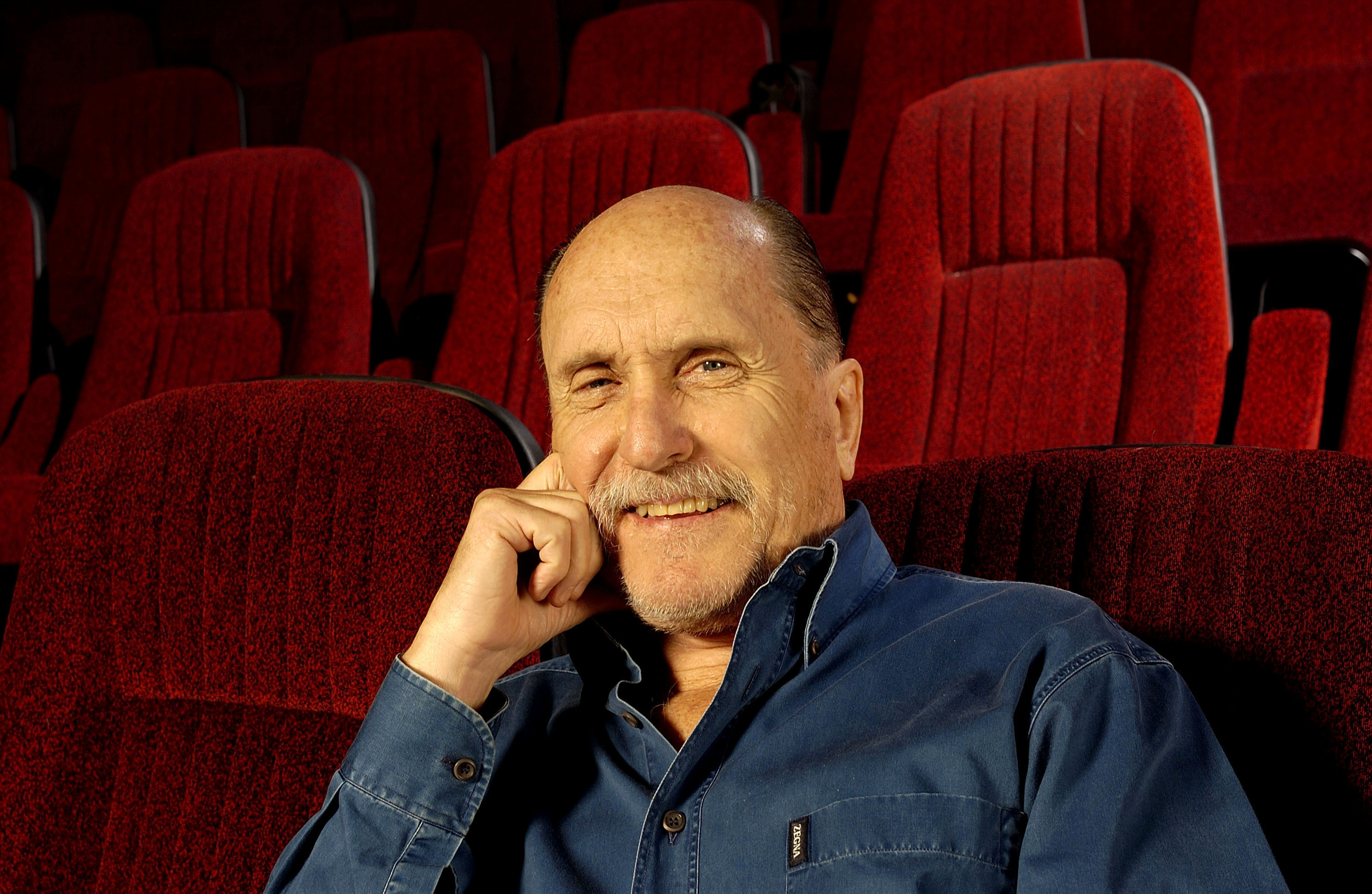John Williams: Wie ein Komponist Hollywood für immer veränderte
Rezension der John-Williams-Biografie von Tim Greiving: Analyse seines Schaffens, seiner Soundtracks und seiner Bedeutung für die Filmmusik

John Williams ist der erfolgreichste Filmkomponist aller Zeiten. Er hat fünf Oscars gewonnen, etliche Grammys, und einige seiner Scores schafften es sogar in die Top Ten der US-Billboard-Charts. Zuletzt erhielt der 93-Jährige eine besondere Ehrung, denn die Bühne der Hollywood Bowl trägt jetzt seinen Namen.
Es ist erstaunlich, dass John Williams mit „John Williams – A Composer’s Life“ (Oxford University Press) erst im hohen Alter eine umfassende Biografie erhält, aber irgendwie auch nicht erstaunlich. Er gilt als äußerst öffentlichkeitsscheu und hat nicht das beste Verhältnis zu Journalisten, von denen viele ihm Plagiarismus vorwerfen (dazu unten mehr). Tim Greiving hat den ergrauten Hünen für Gespräche getroffen und reichert seine Lebensschau mit Aus-ersters-Hand-Erzählungen von Williams an, die vielleicht eher begleitend als erhellend sind, aber zumindest Einblick in die spirituelle Ader des Komponisten bieten, der seinen Schaffensprozess auch an das Mythenkompendium „Die weiße Göttin“ anlehnt.
Dafür ist Greivings vorzügliche Musikanalyse einzelner Williams-Werke so leidenschaftlich und kenntnisreich formuliert, dass einzelne Film-Momente vor dem inneren Auge auftauchen: die Verfolgungsjagd der BMX-Räder aus „E.T.; der Abflug des UFOs aus „Unheimliche Begegnung der Dritten Art“; die Erhebung des X-Wing-Kampfflugzeugs aus den Sümpfen von Dagobah in „Das Imperium schlägt zurück“. Williams‘ Musik, im Bombastischen wie im Intimen, ist – wie Regisseur Chris Columbus sagte – „immersiv“: Sie komplettiert den Film nicht nur, sie ist ein eigener Film und versetzt Hörer in rauschhafte Zustände, in denen sie selbst zu (Action-)Figuren werden.
Analyse der Musiksprache und Werkbreite
John Williams hat seit 1954 mehr als 120 Soundtracks komponiert, Greiving bespricht nahezu alle, und die Arbeiten ab zirka 1969, ab „Goodbye, Mr. Chips“, sogar lückenlos. Mit „Das Imperium schlägt zurück“, „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ sowie „A.I. – Artificial Intelligence“ im Allgemeinen und dem daraus entnommenen Stück „The Reunion“ im Besonderen identifiziert er korrekt die wahrscheinlich wichtigsten Arbeiten (alle drei erhielten keinen Oscar).
Viele sehen John Williams als Epigonen von Wagner, Holst und Debussy. Er selbst sagt, Komposition und Arrangement von Claude Thornhills „Snowfall“ hätten ihn als Filmkomponist stärker geprägt als alles andere. Wagners Arbeiten habe er, dargeboten von einem Orchester, erstmals 1968 in Hamburg gehört – und sei beeindruckt gewesen von der geradezu religiösen Hingabe des deutschen Publikums.
Zu den weiteren überraschenden Geschichten aus John Williams’ Leben gehören private Anekdoten (er sei jungfräulich in die Ehe mit Barbara Ruick getreten) sowie die beträchtliche Zahl an Scores, die er aus Zeitgründen ablehnen musste („Die Brücke von Arnheim“) oder die ihm aufgrund seiner Zögerlichkeit wieder entzogen wurden – James Cameron habe es nicht geschätzt, dass Williams sich für „Titanic“ lediglich „interessiert“ gezeigt habe. Weitere Trivia: Nachdem er Francis Ford Coppola für „Der goldene Regenbogen“ eine Absage erteilt habe, habe der Regisseur ihn nie wieder anfragen wollen. Und angeblich habe David Lynch die Regie von „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ nicht wegen der Einbindung von Knuddel-Ewoks und Jabbas ekligen Palastwachen abgelehnt, sondern weil er nicht mit Williams und Sounddesigner Ben Burtt zusammenarbeiten wollte.
Immerhin hat John Williams, im Gegensatz zu den meisten anderen Hollywood-Komponisten, nie die Erfahrung eines vollständig abgelehnten Scores machen müssen.
Williams im Umgang mit Erfolg und Rückschlag
Williams’ Begeisterungsfähigkeit verdrängte jeden Anflug von Eitelkeit; noch im selben Jahr 1981, als er mit seinem Score für „Jäger des verlorenen Schatzes“ bei den Academy Awards gegen das neumodische und um Klassen schlechtere „Die Stunde des Siegers“ (komponiert von Vangelis) verlor, führte er dessen Titelmotiv mit dem von ihm über Jahre geleiteten Boston Pops Orchestra auf. Die Boston Pops wurden von vielen Kritikern als seicht bezeichnet. Williams blieb ihnen als künstlerischer Leiter dennoch – wie Tim Greiving rührend nachzeichnet – fast ein Jahrzehnt lang treu.
John Williams, zu Beginn seiner Karriere „Johnny Williams“, erhielt seinen ersten Oscar 1972 für die Kino-Adaption von „Fiddler on the Roof“, aber sein Leben war davor schon reich an Erlebnissen. Er spielte das Klavier bei Henry Mancinis „Peter Gunn Theme“ sowie in Hitchcocks „Die Vögel“, er arrangierte Adolph Deutschs Orchester in Billy Wilders „The Apartment“ und komponierte 1965 den kompletten Soundtrack für Frank Sinatras einzige Regiearbeit „None But The Brave“.
Paradoxerweise führt die Nähe Tim Greivings zu John Williams nicht immer zu Erklärungen seiner Person, sondern zur Manifestierung des Mythos. Die etlichen – und möglicherweise begründeten – Vorwürfe, Williams plagiiere seine Vorbilder Stravinsky, Holst und Korngold, deutlich zu hören etwa in „Star Wars“, verteidigt Greiving mit dem nicht ganz überzeugenden Argument, dass Lucas’ Sternensaga ja selbst ein Pastiche aus vergangenen Mythen sei – also sei Williams‘ Soundtrack-Arbeit eine transzendentale Hommage an Legenden.
Verglichen mit den anderen drei großen Filmmusik-Komponisten des 20. Jahrhunderts – Jerry Goldsmith, John Barry und Ennio Morricone – hat John Williams aber gerade für diese Synthesen eine Vielzahl von Preisen erhalten, muss sich der Kritik als0 stellen (Goldsmith, Barry und Morricone haben höchstens ihre eigenen Kompositionen für andere Scores weiterverwertet, wenn auch nicht im großen Stil eines James Horner).
Kritik, Plagiatsvorwürfe und ästhetische Debatten
Wer einmal den Zusammenhang zwischen Tschaikowskys Violinkonzert in D-Dur und Williams’ „Han Solo and the Princess“ oder zwischen Chopins „Marche funèbre“ und dem „Imperial March“ („the theme to end all themes“, wie Greiving humorvoll schreibt) erkannt hat, kann es nie wieder nicht heraushören. In einem aufschlussreichen Kapitel zitiert Greiving aus Gerichtsprotokollen, in denen John Williams erfolgreich eine Klage seines Kollegen Les Baxter abwehrt, der ihm vorwarf, für ein Motiv aus „E.T.“ aus dessen Stück „Joy“ abgekupfert zu haben (ein absurder Vorwurf allerdings, auch wenn Williams auf der Studioaufnahme zu hören ist).
Greivings Biografie ist allerdings auch keine Hagiografie. Zwar widerspricht er John Williams nicht, als dieser sein unterentwickeltes Leitmotiv zur „Star Wars“-Figur Kylo Ren damit rechtfertigt, dass ja dessen Charakter ebenfalls nicht fertig entwickelt sei; und den mittelmäßigen, pathetischen Score von „Amistad“ macht Greiving an der mittelmäßigen Regiearbeit Steven Spielbergs fest. Williams als gutmeinender Komponist, der Bilder nun mal nicht immer erhöhen kann.
Aber gerade das Spätwerk Williams’ untersucht Greiving zu Recht kritisch – den Verzicht des Komponisten auf erinnerungswürdige (Leit-)Motive. Williams liebt Ligeti, aber er ist kein Ligeti. Seine Arbeiten werden dann verehrt, wenn sie mitgesummt werden können. Ob hohes Alter oder die für Komponisten typische Entwicklung, sich irgendwann „leergeschrieben“ zu haben, die Ursache für weniger gelungene Scores ist, bleibt Spekulation.
Das Spätwerk und der Wandel der Filmmusik
Die zweite und vor allem dritte „Star Wars“-Trilogie sind – wie von Greiving erkannt – keine Meisterleistungen des John Williams, „The BFG“ ebenfalls nicht, ebenso wenig wie die Kompositionen für die letzten zwei Indiana-Jones-Abenteuer („Space Camp“ von 1986 ist die erste Williams-Arbeit, in der Greiving kritische Untertöne äußert). Die Beschreibungen dieser nicht mehr überzeugenden Soundtracks sind so taktvoll wie eindeutig: „nicht viel mehr als enthusiastische Tonlagenübungen“, „new restless noteyness“, Williams agiere wie ein „abstrakter Konzert-Maler“.
Nicht zuletzt erzählt Tim Greiving die traurige Geschichte einer ausgestorbenen Hollywood-Tradition. John Williams ist ein Pen-and-Paper-Komponist, der mit Ruhe und Zeit maßgeschneiderte Musik für Filmszenen schreibt. Im digitalen Zeitalter mit seinen rasanten Schnittänderungen von Blockbustern in der Postproduktion ist diese Kunst weitgehend verschwunden. Der 87-jährige Williams schien bei der Vertonung von „Der Aufstieg Skywalkers“ kaum hinterherzukommen, wenn Regisseur J.J. Abrams in der Hektik rechtzeitiger Filmherstellung im Minutentakt neue Kompositionen wünschte – im Wissen, dass der nächste Tonschnitt ein ganzes Williams-Stück zerhacken würde. Deshalb seien einige Temp-Tracks im viel gescholtenen „Star Wars“-Film erhalten geblieben, solche, die unverändert aus älteren „Star Wars“-Abenteuern stammen.
Die Zukunft
Mit 54 Oscar-Nominierungen hat John Williams einen Rekord erzielt: Kein Lebender hat mehr. Greiving weist darauf hin, dass sich Williams mit jeder weiteren Nominierung immer mehr von der Wahrscheinlichkeit entfernt, zum ersten Mal seit 1994 einen weiteren, den sechsten Academy Award zu erhalten. Da er für nahezu jeden Score nominiert wird, denken die Academy-Mitglieder, man könne bis zur nächsten Gelegenheit warten. Die wird es irgendwann nicht mehr geben.
Aber die nächste Nominierung scheint schon festzustehen. Für Steven Spielbergs noch unbetiteltes UFO-Abenteuer, das 2026 in die Kinos kommt, heißt der Komponist: John Williams. Dann wird er 94 sein.