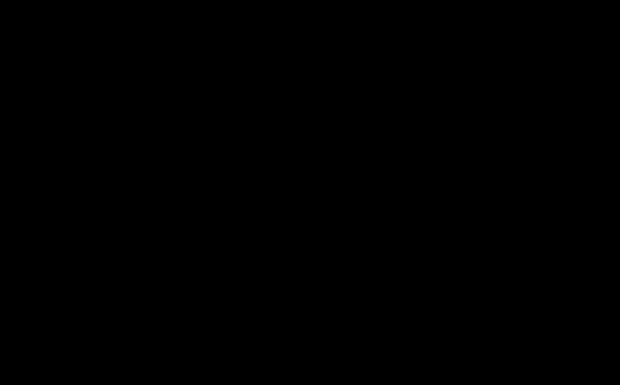Eine Mords Frau
Wie die Autorin Thea Dorn zur Meisterin im Polarisieren wurde
In der nicht enden wollenden Diskussion um modernen Feminismus und Familienfeindlichkeit hat Thea Dorn viel zu sagen -vor allem gegen Eva Herman. Ihr kühnes Plädoyer für eine „neue F-Klasse“ ist umstritten, doch die Schriftstellerin und Fernsehmoderatorin lässt sich von Kritikern nicht einschüchtern. Sie plant längst ihr nächstes Projekt:
einen Liebesroman über einen rennradfahrenden Serienmörder.
T hea Dorn fällt auf. Sie kann nicht anders. In den vergangenen Monaten war sie ständig zu sehen – in Talkshows, in ihrer eigenen SWR/3sat-Sendung „Literatur im Foyer“, im Bücherregal und wahrscheinlich in den Albträumen von Eva Herman. Thea Dorn hat rote Haare und ein anmutiges Gesicht, vor allem aber hat sie ein Talent: Sie kann ihre Gedanken sehr klar formulieren, gnadenlos klar. Sie hat etliche Krimis geschrieben, die zuerst brutal blutrünstig waren und dann subtil und noch viel gemeiner. Kein Grund, sich allzu sehr über sie aufzuregen, hätte sie dann nicht dieses Buch geschrieben: „Die neue F-Klasse -Wie die Zukunft von Frauen gemacht wird“. Eine provokante Vision, derentwegen viele sie gleich als radikale Gegenspielerin zu Hermans Heimchen-am-Herd-Thesen sahen. Was bei genauerer Betrachtung Unfug ist, denn: „Ich schreibe ja keinervor, dass sie keine Kinderkriegen soll oder wie sie leben soll. Ich bin nu r insofern Opposition, als ich jedes Wort von Frau Herman falsch finde. Ich bin nicht .anders extrem‘, ich bin sozusagen die Stimme der Vernunft.“
Eine Stimme, die Familienfundamentalisten freilich unangenehm finden. Während sich jetzt sogar die Konservative Ursula von der Leyen, als Mutter der Nation eigentlich nicht gerade der Über-Emanzipation verdächtig, dafür verteidigen muss, dass sie mehr Kinderbetreuung und Unterstützu ng für berufstätige Mütter fordert, ging Dorn schon vor Monaten gleich noch einen Schritt weiter. Sie rügte nicht nur den immer beliebter werdenden Biologismus – Männer können nun mal besser einparken, Frauen besser Windeln wechseln, alles angeboren! —, sondern auch die zunehmende Unfähigkeit der „Generation Golf“, irgendwann mal erwachsen zu werden, die Schwärmerei für Nutella, Ü-Eier und „Die drei ???“ zur Seite zu schieben und sich ein richtiges Ziel im Leben zu suchen. Das klingt hart – und es erinnert einen dann vielleicht doch manchmal an Alice Schwarzer, die Kulturrelativisten auch nicht einfach so durchkommen lässt, sondern gewisse moralische Maßstäbe einfordert. Immer für alles Verständnis zu haben, ist schließlich auch keine Toleranz, es zeugt eher von Gleichgültigkeit. Oder Orientierungslosigkeit.
Dorn geht es um nicht weniger als um die gesamtpolitische Verantwortung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen, was auch bedeutet: Je mehr Frauen sich mit der Hausfrauen-Rolle zufrieden geben, desto schwieriger wird es für die anderen. Eine Gleichung, zu der sie steht, auch wenn sie gern missverstanden wird: „Natürlich will ich keine Diktatur der F-Klasse errichten oder alle Frauen davon abhalten, zu Hause zu bleiben. Das ist ja Unsinn. Natürlich kann und darf man in einer freien Gesellschaft niemandem vorschreiben, wie er leben soll. Aber es gibt eben eine Zwickmühle: Wenn es nämlich nicht genügend Frauen gibt, die diese Freiheit und das Anders-Sein in Anspruch nehmen, dann sind solche Selbstverständlichkeiten schneller weg, als man zack sagen kann.“
Dass sie selbst auf ihre „natürliche Gabe des Gebären-Könnens“ verzichtet, macht sie schon verdächtig in einer Gesellschaft, die zwar ständig als kinderfeindlich bezeichnet wird, in der aber doch Kinderlose jenseits der 35 oft als irgendwie komisch angesehen werden. Keine Kinder zu wollen – das ist noch anstößiger, als Hunde zu hassen oder alte Leute ins Heim abzuschieben. Inakzeptabel. Fragen Sie Frank Schirrmacher.
Wer „Die neue F-Klasse“ wirklich gelesen hat und sich von Dorns forscher Art nicht gleich abschrecken ließ, der muss zugeben: Hier geht es tatsächlich nicht um die Glorifizierung des toughen Super-Power-Karriere-Weibs, sondern darum, ein Dutzend sehr verschiedener Lebenswege und Standpunkte zu zeigen – von Frauen, die nur eins gemeinsam haben: Sie schaffen was. Ob kinderlos oder nicht, aus Ost oder West, mit Mann oder ohne. Und sie weigern sich, Opfer zu sein, sie suchen Herausforderungen. Frei nach Aristoteles, den Dorn gern anführt: „Wer Sicherheit der Freiheit vorzieht, ist zu Recht ein Sklave.“
Die Idee zu einem Buch über Klasse-Frauen hatte Dorn, nachdem sie mehrere Artikel zum Bundestagswahlkampfund Phänomen Merkel geschrieben hatte, bei denen es nicht nur um die Angst vieler Politiker vor einer mächtigen Kollegin ging, sondern auch viel um die Rezeption der Kanzlerkandidatin – die permanente Fokussierung auf Frisuren, Kostüme und Handtaschen. Dorns Begeisterung für Merkel nhiss man nicht verstehen, jetzt noch weniger als vor der Wahl. Aber immerhin wagte sie es, Deutschland als Neandertal zu bezeichnen, was den Umgang mit Frauen in Führungspositionen angeht, und auf ihre pragmatische Art sah sie in Merkel eine Chance auf Besserung: „Wichtiger als Frauenpolitik ist eine Frau ganz vorn in der Politik.“
Für „Die neue F-Klasse“ wollte Dorn ein paar positive Beispiele von starken Frauen sammeln, nicht von „Frust-Uschen, bei denen die Leute sagen könnten: kein Wunder, dass die so feministisches Zeug reden!“ Sie fand Frauen wie Minenräumerin Vera Bohle oder Spitzenköchin Sarah Wiener, die früher alleinerziehende Sozialhilfeempfängerin war – es gibt kaum einen geraden Lebenslauf in ihrem Buch, aber alle erzählen voller Leidenschaft von ihren Berufen und den kleinen Fallstricken auf dem V/eg zum Erfolg. Ein Buch, das motivieren soll, nicht weniger. „Vielleicht liegt es am zarten Einsetzen des Älterwerdens – ich werde dieses Jahr 37 -, dass ich es langsam ein bisschen mühsam finde, wenn jeder wieder von vorne anfangen muss. Wenn ich an meine Unsicherheiten mit Mitte 20 denke, dann glaube ich, mir wären ein paar Sachen früher klar geworden, wenn ich dieses Buch gelesen hätte. Warum komme ich im Seminar nicht durch, obwohl ich ein o,9er-Abi habe und doch intelligent bin? Warum hört mich keiner? Weil ich zu verquast rede, weil ich nicht kompetent genug bin? Vielleicht, aber es spielt sicher noch etwas anderes mit – nämlich dass Frauen oft nicht gehört werden.“
Als Anfang März wieder mal Weltfrauentag war, behauptete Franz Josef Wagner in „Bild“, dass sich Männer nicht mehr zurechtfinden, nur noch Witzfiguren sind – und dann schloss er mit den traurigen Worten: „Die Frauen heute machen mir Angst.“ Am selben Abend sang sich Roger Cicero mit „Frauen regier’n die Welt“ zum Grand Prix nach Athen – mit einem Text über „lasziv“ blickende Damen: „Wie sie geh’n und steh’n/ Wie sie dich anseh’n/ Und schon öffnen sich Tasche und Herz/ Und dann kaufst du ’n Ring und ’n Nerz…“ Als wäre dies immer noch Frank Sinatras Welt, und wir leben nur darin. Die 50er Jahre sind offensichtlich doch nicht so lange her.
Als Dorn mit ihrem Projekt begann, kassierte sie gleich zwei Absagen: An Boxerin Regina Halmich kam sie gar nicht richtig heran, Wir sind Helden-Sängerin Judith Holofernes wollte auf keinen Fall mitmachen. Die Angst, als „Emanze“ abgestempelt zu werden, sitzt wohl immer noch tiefer, als man das bei modernen Frauen vermuten möchte. Dabei ist das Thema Feminismus noch lange nicht durch, es geht in den nächsten Monaten munter weiter. Eben hat Iris Radisch „Die Schule der Frauen. Wie wir die Familie neu erfinden“ veröffentlicht. Im April erscheint Silvana Koch-Mehrins „Schwestern. Streitschrift für einen neuen Feminismus“, im Mai Alice Schwarzers Abrechnung „Die Antwort“. Demnächst will Dorn eine Sendung machen, bei der diese Frauen im Mittelpunkt stehen.
Sicher eine angenehmere Aufgabe, als sich mit der „Tagesschau“-Blondine zu duellieren, wie sie es vor einigen Monaten im „Nachtstudio“ des ZDF tat. Dorn attackierte Herman dermaßen spitz, dass der jegliche Souveränität abhanden kam. Sie versuchte noch, mit eisernem Lächeln gegen Dorns manchmal etwas schulmeisterlichen Ton anzukommen, aber vergeblich. Wahrscheinlich lag ihr noch Dorns „taz“-Artikel über das „Eva-braun-Prinzip“ im Magen, in dem sie gewisse Ähnlichkeiten von Hermans Thesen mit der NS-Ideologie aufzeigte. Schließlich gab Herman jegliche Bemühungen um eine vernünftige Diskussion auf und sprach Dorn einfach das Recht ab, über Familienpolitik zu reden, weil sie ja selbst keine Mutter sei. Und: „Bei Ihnen ist es gut, wenn Sie keine Kinder haben!“ Nach der Sendung konsultierte Herman angeblich prompt zwei Garnituren Rechtsanwälte, die aber wohl von einer Klage abrieten. Zumindest hat Dorn nichts mehr von ihnen gehört.
Mit Kritik – wenngleich nicht solch stumpfer kennt Dorn sich schon seit einigen Jahren aus. Sie hat früh gelernt, sich durchzusetzen und ihre Meinung nicht hinter wohlfeilen Worten zu verstecken. Der Spaß am Schreiben wurde ihr allerdings nicht in die Wiege gelegt, 1970 in Offenbach. „Ich habe das früher gehasst. Es gab immer Tragödien, wenn ich Postkarten an Oma schreiben musste, das ging nur mit Bestechung. Dafür habe ich kistenweise gelesen. Ich hatte so ein Lufthansa-Stoffköfferchen, in das immer ungefähr zehn Bücher passten, das war dann meine Urlaubsration.“
Mit 16 nahm sie einmal an einem Gedicht-Wettbewerb teil, hat den Inhalt ihres Werks aber längst verdrängt. Nur so viel steht fest: „Es ging wohl um Johanna in der Gefängniszelle, nicht der klassische Dennis-liebt-mich-nicht-Herzschmerz.“ Ein früher Hinweis auf die spätere Karriere. Eigentlich wollte sie Opernsängerin werden, studierte und unterrichtete dann aber Philosophie. Und weil das offenbar nicht anstrengend genug war, schrieb sie im Sommer 1993 innerhalb weniger Monate einen Krimi, „Berliner Aufklärung“, in dem es passenderweise um Morde an der Universität geht. „Erst beim ersten Buch explodierte die Lust am Schreiben“, sagt Dorn, selbst ein bisschen erstaunt. Sie bekam dann auch gleich den Raymond-Chandler-Preis, ein paar Jahre später auch noch den Deutschen Krimipreis.
Es folgten weitere blutrünstige Werke, zwischendurch versuchte sie sich 2000 als Dramaturgin am Schauspielhaus Hannover, aber das war der Philosophin doch „zu gefühlig, das permanente Befindlichkeiten-Austauschen. Ein gewisser pragmatischvernünftiger ZugangzurWelt leuchtet mir doch sehr ein.“ Sie wollte nicht den Ausputzer spielen, sie hatte anderes vor, Größeres – und keine Angst: „Ich muss mich nicht in der zweiten Reihe verstecken. In der
ersten Reihe sieht man zwar nicht nur besser, man kriegt auch ständig eins in die Fresse. Das ist der Preis, den man zahlt. Da muss man schon gehörig einstecken können, sonst geht man kaputt. Aber ich finde es immer jammerschade, dass es so viele Frauen gibt, von denen ich denke, die könnten das, denen fehlt nur der Mut, die Ermunterung. Das war auch ein Grund, das F-Klasse-Buch zu machen.“
Inzwischen ist Thea Dorn in Gedanken schon längst bei ihrem nächsten Roman. Im Frühjahr 2008 soll er fertig sein. Ab Mai ist Sendepause, dann will sie sich zu Hause in Berlin „wegschließen“ und schreiben. „Die Idee trage ich seit dreieinhalb Jahren mit mir herum. Es ist eine Serienmörder-Geschichte, die auf einem realen Fall fußt, der in den 80er Jahren passiert ist. Ein Serienmörder auf der Flucht quer durch die Staaten. In Los Angeles entführte er eine 16-Jährige, fuhr eine Woche mit ihr durch Amerika. Während der Zeit starben drei weitere Frauen. Sie hätte mehrmals fliehen können, tat es aber nicht. Er wurde dann an der Grenze erschossen, sie bekam eine neue Identität. Mich hat die Geschichte gleich elektrisiert — und das war lange vor dem Kampusch-Fall.“
Als die entführte Natascha Kampusch nach acht Jahren in einem Keller wieder auftauchte, erschrak Dorn ein wenig, hielt dann aber an ihrer Idee fest. So viele Gemeinsamkeiten gibt es dann doch nicht zwischen der Österreicherin und ihrer halbfiktiven Romanfigur. Es soll bei Dorn auch nicht nur um das sogenannte Stockholm-Syndrom gehen, bei dem die Opfer eine emotionale Bindung an ihren Entführer entwickeln. Etwas ganz Profanes spielt eine entscheidende Rolle: der Radsport. Dorns Täter ist ein ehemaliger Profi. Sie will die Geschichte nach Europa verlegen, der Protagonist wird aber „bestimmt nicht an Jan Ullrich“ erinnern, wie die Autorin lachendversichert. Dem fehlt ja auch das Killer-Gen.
Dorn hat schon ordentlich recherchiert. Sie hat etliche Strecken mit Kombi und Rennrad abgefahren, in „blöden Etap-Hotels“ übernachtet. Zeit, dass all das zu Papier gebracht wird. Es soll kein klassischer Thriller werden, eher eine Liebesgeschichte, doch ohne Brutalität wird das nicht gehen. Die Zeiten, als sie in „Die Hirnkönigin“ lustvoll grausamste Details schilderte, sind aber vorbei. Thea Dorn will sich nicht mit sich selbst langweilen.
Ihr Leben zwischen Schreiben und Moderieren mag oft anstrengend sein, aber das sei schon in Ordnung so, findet sie. „Das ist doch auch das Faszinierende am Menschsein-je extremer Anforderungen werden, desto häufiger entdeckt man: Das kann ich ja auch noch! Wenn ich mein Arbeitspensum in den letzten Jahren anschaue, dann hätte ich da mit 25 sicher gedacht, das geht überhaupt nie. Da war ich froh, wenn ich einen Artikel im Monat geschrieben habe. Jetzt mache ich 20 Sendungen im Jahr, habe in sechs Monaten das F-Klasse-Buch geschafft, ein weiteres .Tatort‘-Drehbuch geschrieben und sitze an einem neuen Roman.“
Das prinzipielle Bejahen des Lebens und der Unabhängigkeit, die Fähigkeit, viel zu schaffen und noch mehr zu wollen – das gilt weder als besonders deutsch noch als besonders weiblich. Und diese Tatsache ringt Dorn ein süffisantes Grinsen ab. „Um es mal polemisch zu sagen: Was an Deutschen ohnehin schon nervt, ist bei Frauen oft zugespitzt und kann doppelt nerven – das übertriebene Sicherheitsbedürfnis, der Jammerton. Alle sind schuld, bloß man selber nicht.“
Thea Dorn hält sich nicht mit Jammern auf. Klar, das fiese Image nervt manchmal. Dass sie das von „Bild“ lancierte lustige Label als „Deutschlands brutalste Krimi-Autorin“ wahrscheinlich noch mit 80 haben wird – geschenkt. Sie hat sich ein dickes Fell zugelegt, und beim fünften Buch schmerzt Kritik nicht mehr so sehr, wenn man schon seit dem allerersten gewöhnt ist, ordentlich „eins auf die Nuss zu bekommen“.
Und dawären wir wieder bei der Frage: Warum macht Thea Dorn manche Menschen so aggressiv? Da ist selbst die so gescheite, so eloquente Schriftstellerin, Moderatorin und Polarisierungs-Meisterin ratlos: „Ich müsste wahrscheinlich noch nicht mal rote Haare haben, um auf viele als rotes Tuch zu wirken. Offensichtlich löse ich in sehr vielen Leuten sehr heftige Reaktionen aus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich vermute, es hat etwas damit zu tun, dass es nicht mein Ehrgeiz ist, mehrheitsfähig zu sein. Das gehört zum Luxus meines Berufs, ich bin ja keine Politikerin. Aber man fragt sich doch – und ich weiß schon, das wird jetzt zitiert -, ob man vielleicht das Merkel-Problem hat und in der medialen Wahrnehmungganz anders rüberkommt, als man möchte. Ich höre oft von Leuten: Sie sind ja ganz anders, als ich dachte! Warum haben die so ein bizarres Bild von mir – dass ich schon zum Frühstück geröstete Kinder esse und alle Männer kastrieren und in Latzhosen sperren will? Die Leute sehen immer, was sie sehen wollen.“
Ein paar Stunden nach dem Interview moderiert sie wieder „Literatur im Foyer“ in Stuttgart, Martin Walser ist zu Gast. Souverän befragt sie ihn zu seinem Lebenswerk, zu Kritikerschelte und Widerspenstigkeit. Sie zitiert noch einmal Aristoteles: Mut sei die Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Walser kann mit der Gleichung nicht viel anfangen, Thea Dorn dafür bestimmt umso mehr. Zu Feigheit hat sie nie tendiert. ¿
ie Geschichte der Doors wird oft und allzu leicht verwechselt mit einer anderen Geschichte, die parallel zu ihr verläuft. Sie erzählt von Grausamkeit, Hexerei, Drogenmissbrauch, Exhibitionismus, Gewalt, Schönheit, Sexualität, Alkoholismus, Gefängnis, schamanischen Riten, Ruhm und Tod. Es ist, zugegeben, eine gute Geschichte, aber nicht die Geschichte der Doors. Sondern eine selektive und sensationsheischende Version der Lebensgeschichte von Jim Morrison zwischen 1966 und 1971.
Die echte Geschichte der Doors ist weit weniger reißerisch. Es ist die Legende von vier jungen, seelenverwandten Musikern, die vor über 40 Jahren in Kalifornien so etwas wie ein Familienunternehmen gründeten und zu ihrem großen Erstaunen und nicht unbeträchtlichen Stolz im Jahr 2007 immer noch eine weltbekannte Marke ihr eigen nennen. Trotz des Dramas um Jim Morrisons kurzes Leben und seinen langen Tod geht es in der Geschichte der Doors nicht um Selbstzerstörung, sondern im Gegenteil um stoisches Überleben und Bewahren.
Nicht überzeugt? Gut, hier haben wir Drummer John Densmore, 62 Jahre alt, der immer noch in seiner Heimatstadt Los Angeles lebt, gerade beschlossen hat, mit seiner Band Tribaljazz „richtig ernst zu machen“, und außerdem als Schriftsteller und Schauspieler tätig ist. Oder den Keyboard-Rastelli Ray Manzarek, der mit 67 immer noch ausführlich und unterhaltsam über „den Kampf der Killer gegen die Liebenden“ und „unendliche Zen-Momente im Fluss der Zeit“ philosophiert. Während seine fünf Hühner im Napa Valley biologisch-dynamische Eier produzieren, schreibt Manzarek Bücher, macht Filme und spielt mit Sänger lan Astbury in den Fast-aber-nicht-ganz-Doors namens Riders On The Storm. Oder Gitarrist Robby Krieger, gerade 6i geworden, aus dessen Feder „Light My Fire“, „Love Her Madly“ und „Touch Me“ stammen und der heute eine Reihe anderer musikalischer Interessen (darunter auch Riders On The Storm) verfolgt.
Alle drei sind intelligente, witzige und offensichtlich unbeschädigte Männer, obwohl sie, wie jede Familie, im Laufe der Jahre einige Tragödien, Spannungen und Veränderungen durchlitten haben. Morrison war der schwierige Außenseiter, der es nie lange mit irgendwas aushielt, und von den übrigen drei Original-Doors verbindet derzeit nur zwei eine wirklich ungetrübte Freundschaft. Vor zwei Jahren verklagte Densmore seine Kollegen wegen missbräuchlicher Verwendung des Bandnamens; derzeit läuft das Berufungsverfahren. Angesichts des freundlichen Naturells aller Beteiligten und der immer noch vorhandenen Zuneigung ist jedoch zu erwarten, dass sich die Beziehungen in Zukunft wieder verbessern werden.
Die Doors als Marke zu bezeichnen, scheint irgendwie passend-nicht weil sie ihre Vergangenheit dreister vermarkten als andere Überlebende der 60er Jahre, sondern weil sie eine Band sind, die eher auf Respekt und nüchterne Anerkennung stößt als auf Liebe und überschwängliche Begeisterung.
Dafür gibt es mehrere gute Gründe. Zum einen passten die Doors schon immer nicht so recht ins Bild. Sie waren schwierig, nicht fassbar, unnahbar, prätentiös und egozentrisch, sie schrieben den Soundtrack zu den Schattenseiten der Hippie-Bewegung: die schlechten Trips, das Gefühl der Verunsicherung, die Widersprüchlichkeit und Heuchelei der Hippie-Philosophie zu Zeiten des Vietnam-Kriegs, die gefährliche, emotional destabilisierende Kehrseite der freien Liebe, der Balanceakt zwischen hehren Idealen und selbstsüchtigem Handeln.
„Wir sangen nicht über Frieden und Liebe“, bestätigt Manzarek. „Bei uns ging es um Tieferes. Mit Blümchen im Haar hatte das definitiv nichts zu tun, eher mit Freud und Jung. Wir wollten das Leben umarmen, mit der ganzen Kraft und Leidenschaft und Hingabe der Jugend. Das heißt nicht, dass man nicht bis oben hin voll ist mit Liebe, es kommt nur nicht so windelweich rüber. Wir waren gegen die Gesellschaft und gegen einen falschen Frieden, beides gleichzeitig.“
Zum anderen waren sie als Band unheimlich schwer festzunageln. Was waren sie: Blues, Pop, Rock, Jazz, Proto-Prog, Karnevalsmusik? All das und noch viel mehr. Wer waren sie? Ein Verse schmiedender Rockgott mit Lederhose und Suchtproblem, hinter dem drei harmlos wirkende Strebertypen vor sich hin schrammelten. Ganz sicher eine One-Man-Show und keine echte Band, in der vier gleichrangige Persönlichkeiten in den vier Ringecken standen, oder? Falsch. Ganz falsch. Aber ein Fehler, den man nur allzu leicht begeht.
Denn erberuht auf dem, was am unüberwindlichsten zwischen den Doors und ihrer universellen Verehrungsteht-der Tatsache, dass Jim Morrison tatsächlich die eine oder andere Tasse im Schrank fehlte. Dass er für viele von uns einmal Inbegriff von Coolness oder Objekt feuchter Teenagerträume war, ist uns heute so abgrundtief peinlich, dass unser schlechtes Gewissen uns verbietet, mit der Band noch etwas anfangen zu können. Die Worte, die uns einst wie wunderbar zweideutige Poesie in den Ohren klangen – „Forget the night/Live with us in forests of azure“ undsoweiter – entpuppten sich oft als ziemlicher Quark. L’nd die mit Staunen beobachteten Provokationen eines Rock’n’Roll-Rebellen (den Schwanz auf der Bühne rausholen, sich mit Polizisten prügeln, dauernd besoffen sein, in der Badewanne sterben) erwiesen sich in Nachhinein als traurige Manifestationen von Alkoholismus und einer schweren Persönlichkeitsstörung, die man bei einem Penner eher erwarten würde als bei einem Rockstar.
Doch wenn man den kulturellen Kontext abzieht, die Bilder, Symbole und Mythen, die Missverständnisse, Verdrehungen und den puren Schwachsinn, der die Doors umgibt, was bleibt dann übrig? Eine ganze Menge. Zum Beispiel eine exzellente Band, die in vier Jahren sechs Studioalben und ein Live-Doppelalbum produzierte und bis zu Morrisons Tod 1971 unzählige „überirdische“
;i i*.->
Konzerte gab. Die Musik der Doors zu hören, vier Jahrzehnte nach Erscheinen ihres gleichnamigen Debütalbums im Januar 1967, ist viel schöner und bewegender, als man meinen könnte. Manzarek hat Recht, wenn er behauptet, dies sei „Bauhaus-Musik, klar, unverfälscht: Keyboard auf der einen Seite, Gitarre auf der anderen, Schlagzeug in der Mitte, eine Bassline drunter und der Sänger vorne – und man kann den Text verstehen! Das ist einer der Gründe, warum unser Sound immer noch Bedeutung hat. Er ist total modern. Das ist es, was wir wollten.“
Dass der Sound der Doors schon immer wichtiger war als die Texte oder die Bühnenshow und man das ihren Alben heute noch anhört, verdanken wir vor allem dem Produzenten/Techniker-Gespann Paul Rothschild und Bruce Botnick, die immer versuchten, möglichst unsichtbar zu bleiben und die Aufnahmen nicht zu überfrachten. Botnick sorgte auch dafür, dass die Musik auf den neu aufgelegten Doors-Alben klarer und knackiger klingt als je zuvor.
Wie immer bei Bands aus den Sechzigern registriert man staunend, wie komprimiert das alles war, wie rasch die Kurve nach oben ging, wie schnell es wieder vorbei war und wie viele Jahre diese drei Männer nun bereits das Erbe jener kurzen, wilden Zeitspanne hüten und pflegen.
Der pazifische Ozean spülte die Doors 1965 an Land. Manzarek und Morrison lernten sich im Juli in Venice Beach kennen, ein paar Monate, nachdem sie dasselbe College abgeschlossen hatten, Morrison, Sohn eines strengen Marineadmirals, dessen Laufbahn der Familie zahlreiche Umzüge bescherte, war 22, Manzarek vier Jahre älter. Morrison sang ein paar frisch komponierte Stücke vor, darunter „Moonlight Drive“, „My Eyes Have Seen You“ und ,.Summer’s Almost Gone“, und wurde prompt in die Band aufgenommen, in der Ray damals mit seinem Bruder spielte und die den vollmundigen Namen Rick and The Ravens trug.
Wenig später kamen zwei von Rays Freunden aus dem Meditationskurs hinzu – Densmore und Krieger-, und damit war die Besetzung komplett. Einen Bassisten gab es nicht; stattdessen spielte Manzarek mit der linken Hand den Bass und mit der rechten die Melodie. „Wir ließen ein paar Bassisten vorspielen und erzählten ihnen, wir würden so klingen wie die Rolling Stores“, erzählt Densmore. „Damit unterschieden wir uns natürlich nicht besonders vom Rest der Welt.“
Trotz der Tatsache, dass Morrison im Laufe der Jahre mehr Zeitungsspalten gefüllt hat als jeder andere tote Rocksänger (John Lennon und Jimi Hendrix vielleicht ausgenommen) und Krieger manchmal trocken vermerkt, bis zumjahr 3000 würde möglicherweise der eine oder andere wissen, dass er „Light My Fire“ geschrieben habe, scheint keiner in der Band sonderlich mit der übermächtigen Präsenz ihres Ex-Sängers zu hadern. „Das gehört einfach dazu“, meint Krieger achselzuckend. „Es war Teil der Abmachung, und es stört mich nicht.“ Schließlich war Morrison von Anfang an ihre Fahrkarte ins Glück. Sein Aussehen, seine geheimnisvolle Aura waren das Trojanische Pferd, das es einer ziemlich ungewöhnlichen Band ermöglichte, so schnell derart erfolgreich zu werden.
„Als ich Jim Morrison am Strand sah, war ich baff, wie sehr er sich verändert hatte“, erzählt Manzarek. „Er war schon immer ganz ansehnlich gewesen, aber in den zwei Monaten hatte er über zehn Kilo abgenommen. Er lebte praktisch nur von LSD und sah großartig aus – das Kinn war kantiger und er hatte Locken wie Michelangelos David. Ich dachte: ,Die Mädchen werden diesen Typen lieben!‘ Seine Texte ¿waren toll, ich wusste sofort, was ich musikalisch damit machen konnte, und er sah genau so aus, wie man sich einen Leadsänger vorstellt. Hey, mit dein 6mnen wir es schaffen!“
Doch Morrison in der Band zu haben war laut Krieger auch ein schwieriger Balanceakt: „Wir waren ständig fast an dem Punkt, an dem es sich nicht mehr lohnte, ihn in der Band zu haben. Aber nur fast. Bei unserer zweiten Probe waren John und Ray und ich da, aber kein Jim. Als wir rumtelefonierten, stellte sich raus, dass er im Gefängnis saß, in Blythe, das liegt schon fast in Arizona. Er hatte mit ein paar Typen in einer Bar Streit angefangen und wir mussten hinfahren und ihn auslösen. Das war unsere zweite Probe. Von da an ging’s abwärts!“
i
Die Doors spielten sich durch die Clubszene in L.A. und wurden Hausband zuerst im „London Fog“, wo sie vor ein paar betrunkenen Matrosen an ihrem eigenwilligen Sound bastelten, und dann im renommierteren „Whisky A Go Go“, wo sie mit Van Morrisons Them jammten und im Sommer 1966 allmählich für Aufsehen sorgten. Das „Whisky“ ¿war auch der Ort, an dem sich „The End“ eines Nachts zu voller, ödipaler Glorie entfaltete: „Nach und nach wurde es im ganzen Laden still, alle hörten gebannt zu, was da vor ihnen entstand“, erinnert sich Manzarek – und wo Elektra-Boss Jac Holzraan zur Überzeugung gelangte, die Doors könnten ganz groß rauskommen. „Keine unserer Bands war von Anfang an,fertig‘- mit Ausnahme der Doors“, erklärt Holzman, der die Doors im August 1966 unter Vertrag nahm. „Ich schaute sie mir vier Tage nacheinander an, bevor ich auch nur Hallo sagte. So lernte ich ihr musikalisches Spektrum kennen: Jazz und Rock und Klassik. Einfach unglaublich.“
Selten klang eine Band vom Startschuss an so vollendet, so selbstbewusst und so bereit für alles, was kommen sollte. Densmore beschreibt das als „echte kleine Demokratie – wir hatten nie ein Problem damit, wer diesen Song oder jenen Text geschrieben hatte“. Die Doors waren ein Schmelztiegel, in dem alles, von Ideen, Texten und Songs bis hin zu Arrangements und Tantiemen, gleichberechtigt geteilt wurde. Musikalisch gesehen hatte jedes Bandmitglied seine Hausaufgaben gemacht und konnte eigene Zutaten in den Topf schmeißen. Densmore steuerte einen Bossanova-Beat zu „Break On Through“ bei, inspiriert von dopegeschwängerten Nächten in Venice Beach, in denen er und Manzarek Stan Getz und Joao Gilberto gehört und von Brasilien geträumt hatten. Sie klauten bei Thelonious Monk, John Coltrane und Herbie Hancock. Im Intro zu „Light My Fire“ meint man auf einmal Bach zu hören, und eine Fassung von Albinonis ,Adagio in G-Moll“, die es dann doch nicht auf „WaitingFor The Sun“schaffte, klingt wie etwas auf der zweiten Seite von Bowies „Low“.
Morrison wiederum hatte eine Menge gelesen und brachte literarische Verweise aller Art sowie einen (eher plumpen) Freudschen und Jungianischen Symbolismus ins Spiel. Ihr Debütalbum war „ein existenzieller Moment“, wie Manzarek immer noch begeistert verkündet: „Mein Gott, das erste Album war pure Magie. Wir brauchten nur zehn Tage, um das Ding aufzunehmen und abzumischen. Es ging fast wie von selbst. Aber das erste Album kann man nur einmal machen, das ist wie der erste Sex: Womj/ Die erste Eruption von Männlichkeit und Kreativität. Jim befand sich auf dem absoluten Höhepunkt – er sah nicht nur aus wie ein junger Gott, er schrieb auch so.“
Alle drei verbliebenen Bandmitglieder sind immer noch aufrührende Weise von Morrisons dichterischem Genie überzeugt. Ich bin mir da nicht so sicher. Wenn selbst Dylans diesbezügliche Qualitäten in der Diskussion stehen, sollte die Jury bei Morrison kollektiv den Daumen senken. Wenn er gut ist -wie bei „The Crystal Ship“, „Summers Almost Gone“ oder „Moonlight Drive“ – dann deshalb, weil er ein guter Texter ist, aber kein Dichter. Wenn er offenkundig versucht, einer zu sein – wie bei „Horse Latitudes“, „The WASP (Texas Radio And The Big Beat)“
oder, Gott behüte“,TheCelebrationOfTheLizard“-verwandelt er sichzumeist in einen melodramatischen, ganz und gar lächerlichen Clown.
Trotzdem wird deutlich, was er beabsichtigte. Kernziel von Morrisons künstlerischen Attacken war die Zerstörung der Höflichkeitsfassade, die uns daran hindert, unser wahres Wesen zu zeigen. Er selbst verwendete dazu Drogen und Alkohol (der leider, laut Manzarek, einen „düsteren, gehässigen, bösen Menschen“ zum Vorschein kommen ließ, und fast jeder, der ihn betrunken erlebt hat. stimmt dieser Einschätzung zu) und in seinen Texten durch die provokative Darstellung von Schmerz, Gewalt und Erotik. Etwas weniger abstrakt ausgedrückt: Seine selbst gewählte Rolle als Performer war die des unbefangenen Narren vor dem Thron der Kunst, und den darin enthaltenen Freiraum reizte er von Anfang an gefährlich aus.
Diese Mixtur verursachte Faszination und Abscheu zugleich. „Die Musik der Doors, die Thematik ihrer Songs und ihr Verhalten waren oft derart überdimensioniert, dass man sich unwohl fühlte“, meint Holzman. „Es machte die Leute nervös.“ Krieger ergänzt: „Wir kamen aus dem Weltraum und brachten etwas zum Schwingen, das tiefer ging als bei den meisten anderen Bands. Auf normale Menschen kann das verstörend wirken.“
Vielleicht erklärt sich daraus die Zurückhaltung des Publikums, die immer spürbare Restdistanz. Im Verlauf ihrer sechs Alben für Elektra, erschienen zwischen Januar 1967 und April 1971, fand keine Entwicklung im herkömmlichen Sinne statt- aber vielleicht war das auch gar nicht nötig. Nachdem sie mit dem ersten Album gleich auf Gold gestoßen waren, wurde an der Erfolgsformel nicht mehr viel geändert: Düstere, von Manzareks Orgel getragene Popsongs, dazwischen ein bis zwei lange, improvisierte Stücke und das eine oder andere, nur scheinbar ruhig vor sich hinplätschernde Intermezzo wie „Indian Summer“ oder „End Of The Night“.
Mitunter experimentierten sie mit Streichern und Bläsern, um das musikalische Spektrum zu erweitern. Das ging, wie auf „Soft Parade“, meist schief. Doch davon abgesehen verstanden die Doors ihr Geschäft. Sie waren ein Team, ergänzten sich, bliesen in dasselbe Hörn. „Ich habe nie mitgekriegt, dass sie sich im Studio gestritten oder einander angeschrieen hätten“, berichtet Bruce Bot nick. „Es ging sehr harmonisch zu. Wenn es langweilig wurde, fing Jim an zu trinken, aber er war nicht der erste Rockstar, der das so praktizierte.“
Außerhalb des Studios ging es anders zu. „Es schien, als würde Jim die ganze Sache ständig – bewusst oder unbewusst – sabotieren“, meint Krieger. Alle in der Band sind sich einig, dass die echten Höhepunkte relativ früh kamen ( !r Als der Zug den Bahnhof verließ“, in Densmores Worten), bevor Morrisons Alkoholprobleme massiv wurden. Manzarek gab Morrisons betrunkenem Alter Ego sogar einen Namen: Jimbo. „Sobald die Flasche geöffnet wurde, erschien Jimbo und du dachtest nur noch: ,Hilfe, bloß raus hier!‘. Ein ekelhafter Typ. Ich glaube nicht, dass irgendein Psychiater rausgekriegt hat, wo er herkam.“
Zwischen dem 1. März 1969, als ein paralysierter Morrison im Miami Auditorium verhaftet und später wegen Exhibitionismus verurteilt ¿wurde, und
dem letzten Gig der Doors am 12. Dezember 1970 in New Orleans, wo er mit dem Mikrofon auf die Holzbühne einhämmerte und „an Ort und Stelle einen Nervenzusammenbruch hatte“ (Manzarek), befand sich die Band ständig in den Klauen von Morrisons Alkoholsucht und kämpfte darum, bei Live-Auftritten noch zu funktionieren.
„Ich versuchte, uns für ein Jahr oder so von der Straße wegzukriegen, weil es Jim immer schlechter ging“, erklärt Densmore. „Es war toll, live zu spielen, und wir waren richtig gut, aber gegen Ende hin wurde es immer wackliger und ich konnte das nicht mehr mit ansehen. Im Studio gingen wir einfach nach Hause, wenn Jim zu abgefüllt war, aber vor tausenden von Leuten kannst du das nicht bringen.“
Nach New Orleans kamen sie noch einmal zusammen, um das Blues-Gewitter auf „Lj. Wowian“ aufzunehmen, diesmal ohne Rothchild am Ruder, was dem Album aber nicht sonderlich schadete. Veröffentlicht wurde es im April 1971 .Nicht mal drei Monate später war Morrison tot, gestorben vermutlich an einem Herzinfarkt in Paris, wohin er mit seiner Freundin Pam gefahren war, um die Akkus wieder aufzuladen.
Seine Kollegen gingen alle davon aus, dass er zurückkommen würde, doch es ist fraglich, ob die Band noch eine Zukunft vor sich hatte. Zumindest als
Live-Act schien das Ende bereits gekommen zu sein. Technisch gesehen hatte Morrison als Sänger nie sehr viel vorzuweisen gehabt – ein wildes Raubkatzen‘ knurren und ein massiger, versoffener Bariton waren seine einzigen Trümpfe -, und seine Stimme hatte gewaltig nachgelassen. Auf „L.A. Woman“ hört man, dass der Jahre lange Exzess sie schon fast zerstört hatte – ein dumpfes Grollen war alles, was noch übrig war. Paul Rothch ild riet der Band angeblich mehrmals, möglichst viel Material aufzunehmen, weil Morrison nicht mehr lange unter den Lebenden weilen würde. Botnick bestreitet das und verweist auf Pläne für ein weiteres Album, das in London oder Paris entstehen sollte. Und Manzarek beantwortet die Was-wäre-wenn-Frage auf gewohnt esoterische Weise. „AH das Zeug entstand zu unserer besten Zeit. Wer weiß, zu was wir danach in der Lage gewesen wären?“, fragt er. „Die Songs wären vielleicht nicht mehr so gut gewesen, wir hätten vielleicht nicht mehr so gut gespielt. Doch in meinem Herzen weiß ich, dass es fantastisch geworden wäre. Wenn Jim aus Paris zurückgekommen wäre, hätten wir ¿wahrscheinlich mehr Sachen wie ,Riders On The Storm‘ gemacht. Oder wie ,An American Prayer‘. Wir hätten Rezitationen verwendet, Klangeffekte, Straßenlärm, Gespräche, Musik, Texte, Gesang und Songs.“
Für die Band war es verstörend, oft aber auch belustigend, die Verwandlung ihres „witzigen, geistreichen, talentierten“ Sängers in den „betrunkenen Lizard King, den dionysischen Sybariten, den gefährlichsten, verkommensten, zügellosesten Mann in der Geschichte des Rock’n’Roll“ mitzuerleben, obwohl alle vier, mehr oder weniger, zur Kultivierung dieses Images beitrugen. Morrisons Niedergang aus der Perspektive seiner Bandgenossen zu sehen, hilft einem, aus dem überhöhten Drama wieder eine nackte, menschliche Geschichte zu machen: ein verzweifelter Alkoholiker, gerade mal Mitte 20, und seine drei jungen Arbeitskollegen, die versuchen, ihre Band am Leben zu erhalten und gleichzeitig mit einer Sucht klarzukommen, deren Wurzeln sie nicht verstehen – und die in einer Zeit, bevor Sucht adäquat behandelt wurden, auch niemanden interessierten.
„Es gab keine Entzugskliniken, wir wussten nicht, dass er Alkoholiker war“, erklärt Densmore. „Nichts konnte Jim auf seiner Höllenfahrt aufhalten. Erwusste, dass wir uns Sorgen machten. Zwei Mal wurde ein Gespräch angesetzt, zu einem davon ist er gar nicht aufgetaucht. Ich verurteile ihn dafür nicht, er war einfach der große gequälte Künstler. Gleichzeitig war er ein zerbrechlicher Mensch, der seine Freundin Pam liebte. Die Leute haben ihn auf ein furchtbar hohes Podest gestellt, dabeiwar er letztlich ein ganz normaler Typ. In der Anfangszeit fuhren wir manchmal in meinem VW herum und redeten über unsere Träume, und er war einfach nur ein College-Junge, der sich für Mädchen interessierte. Mit der Zeit habe ich gelernt zu akzeptieren, dass es sein Schicksal war, alles in eine kurze Zeitspanne zu packen – eine helle Sternschnuppe, die rasch verglühte.“
Morrisons Tod bedeutete nicht das Ende der Doors. Das Dreigestirn spielte weiter Konzerte und nahm zwei weitere Alben auf, bevor sie die Sache 1973 schließlich an den Nagel hängten und sich anderen Projekten zuwandten. Doch das Besondere an einer Band wie den Doors ist, dass sie dich nicht gehen lässt. Als mehrere Bänder entdeckt wurden, auf denen Morrison eigene Gedichte vortrug, kam die Band wieder zusammen, nahm Begleitmusik auf und veröffentlichte das Ganze 1978 unter dem Titel „An American Präger“. Im Jahr darauf verwendete Francis Ford Coppola „The End“ mit entsprechend dramatischem Effekt in „Apocalypse Now“, was zu einer Welle von Reissues und wiedererwachtem Interesse führte. An Oliver Stones Biopic „The Doors“ (1991) waren die drei als Berater beteiligt — eine eher unbefriedigende Erfahrung. „Das Ganze war ein Witz“, spottet Manzarek. „Oliver Stone in Lederhosen.“
2002 entschlossen sich Manzarek und Krieger zu einer Neuauflage der Doors mit Cult-Sänger Ian Astbury, der laut Manzarek „auch diese düstere, grüblerische, frühchristliche Keltenaura besitzt. Schamanismus, indianische Spiritualität, Buddhismus, Poesie – all die Sachen, auf die Jim stand, sind auch Ians Metier. Es hat dieselbe Kraft wie damals, aber es ist nicht Jim. Es ist Ian, wie er leibt und lebt.“
Densmore fühlte sich übergangen und ist angeblich auch kein glühender Fan von Astbury. Manzarek meint, Densmore habe David Bowie als neuen Sänger vorgeschlagen, unklar ist allerdings, ob der Duke dabei nach seiner Meinung gefragt wurde. „Solange wir niemanden von Jims Format finden, warum es noch mal versuchen?“, meint Densmore. „Schließlich war er ein Genie!“
Die übliche Mischung also aus alten Wunden, angekratzten Egos und den „Er hat dies getan, er hat jenes gesagt“-Spielchen im immer noch laufenden Rechtsstreit? Nicht ganz, denn eigentlich handelt es sich um einen Krieg, der in vielen Vorstandsetagen geführt wird: Wie soll das Familienunternehmen weitergeführt werden? Die eine Seite plädiert dafür, eine glanzvolle Tradition zu erhalten, die andere favorisiert Weiterentwicklungund die Anpassung der Marke an eine neue Zielgruppe. Beide Standpunkte sind nachvollziehbar. Und da beide Seiten immerhin der Stolz auf die Errungenschaften der Vergangenheit und die ungebrochene Liebe zu den Doors eint, könnte doch noch einiges zu erwarten sein.