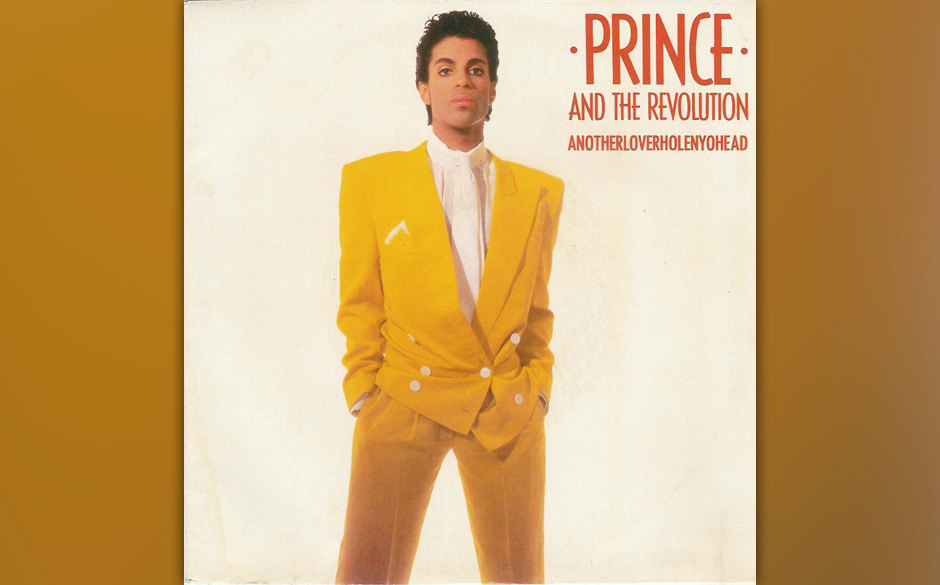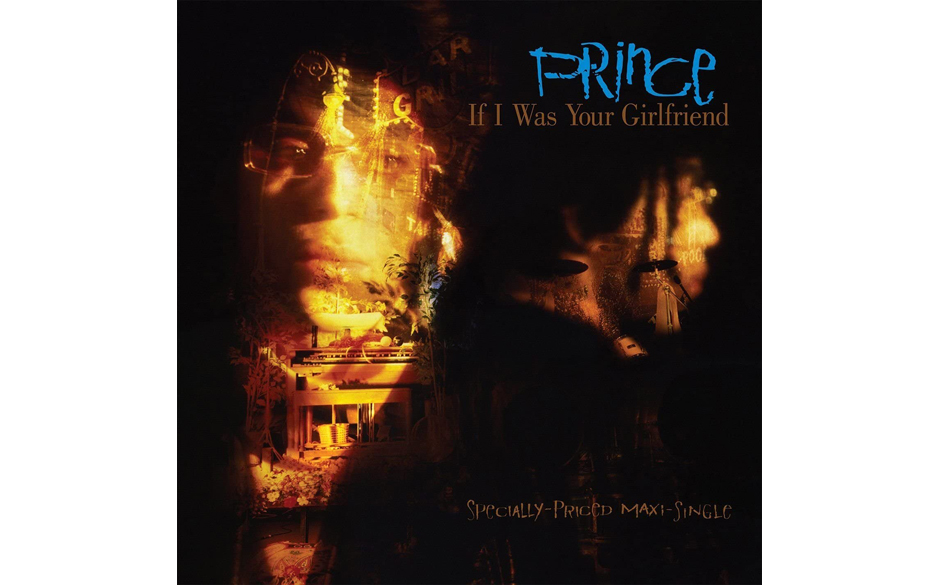Jethro Tull im Interview: „Es ist eine dunkle Energie“
Ian Anderson sprach mit ROLLING STONE über das neue Jethro-Tull-Album „Curious Ruminant“.

„Ich mag diese Energie, die in dem Moment entsteht“
Sie haben vorhin alte Demos erwähnt – sind Sie ein guter Archivar Ihres eigenen Werks mit Jethro Tull? Haben Sie Ihr Material gut organisiert und leicht zugänglich?
Wir machen eigentlich nur sehr selten Demos. Ich bevorzuge es, mit der Band zu proben und dann direkt aufzunehmen – denn sobald wir proben, tun wir das bereits mit Blick auf die spätere Aufnahme. Schon von Anfang an war es bei uns so, dass wir ein Stück so lange geprobt haben, bis wir es wirklich spielen konnten – und dann haben wir es aufgenommen.
Ich mag diese Energie, die in dem Moment entsteht. Wenn man zuerst Demos erstellt und sie dann Stück für Stück ausfeilt, verliert man oft diese Spannung, diesen Schwung. Natürlich habe ich in bestimmten Phasen einfache Demos gemacht, um sie an die Band zu schicken – nur ich mit Gitarre und Gesang, gerade genug, damit sie eine Vorstellung vom Song bekommen.
Dazu gibt es dann viele Anmerkungen zur Arrangierung, sodass wir beim ersten Zusammentreffen fast schon durchspielen können. Dann proben wir einen Tag lang – und nehmen auf. Das ist für mich ein schöner, effizienter Weg, ein Album zu machen: Jeden Tag entsteht etwas Neues, eine weitere Masteraufnahme. Später kommt vielleicht noch ein Gitarrensolo oder eine Gesangsspur dazu, aber grundsätzlich leite ich die Musik eher, als dass ich gleichzeitig singe und spiele.
Die Band kennt die Melodie, weiß, worum es geht. Ich schicke ihnen ein Demo – aber das ist wirklich nur ein Arbeitsentwurf, meist nicht einmal das ganze Lied. Vielleicht nur ein Teil, der zeigt, wie eine Strophe funktioniert oder welches Instrument wann einsetzt. Für Außenstehende würde das kaum Sinn ergeben.
Wie sieht es mit Songtexten aus – führen Sie ein Archiv ungenutzter Lyrics?
Eigentlich habe ich fast nichts aufgehoben. In den 70er- und 80er-Jahren gab es sicherlich einige Stücke, die wir geprobt und aufgenommen haben, die aber nicht ganz überzeugend waren. Das waren jedoch keine klassischen Demos, sondern vollständige Songs – nur eben nicht für eine Veröffentlichung geeignet. Manchmal wurden sie auch nur als Stereospur aufgenommen, nicht als Mehrspur, sodass sie später nicht wirklich weiterverarbeitet werden konnten.
Um sie zu veröffentlichen, hätte man sie komplett neu aufnehmen müssen. Besonders um 1981 und 1982 herum haben wir viel Material aufgenommen, das erst Jahre später – teilweise auf Nightcap oder Under Wraps – erschien. Die meisten dieser Aufnahmen wurden also erst im Nachhinein veröffentlicht, etwa in Kompilationen oder Sondereditionen. Aber grundsätzlich ziehe ich es vor, live mit der Band zu proben – so, wie wir es auch auf der Bühne spielen würden – und dann direkt aufzunehmen. Das ist für mich das Entscheidende: Musik so entstehen zu lassen, wie sie live funktioniert. „Thick as a Brick“ haben wir 1972 genau so gemacht – jeden Tag fünf Minuten Musik geprobt, nach zehn Tagen war das ganze Stück fertig. Dann sind wir ins Studio gegangen und haben es in einer Woche aufgenommen. So bleibt alles frisch, man weiß genau, was am nächsten Tag zu tun ist. Dieses Momentum, dieses Energiegefühl ist für mich essenziell beim Aufnehmen.
Das klingt, als würden Sie an den „Zauber des Moments“ glauben.
Ja, ganz genau. Ich habe schon mit anderen Musikern zusammengearbeitet, bei denen alles schon sehr weit entwickelt war und ich dann ein paar Flötenparts beigesteuert habe. Und wenn sie das Stück am Ende fertiggestellt haben, haben sie fast alles noch einmal neu aufgenommen – besonders den Gesang. Wenn ich dann die endgültige Version höre, denke ich oft: Sie haben es einfach zu oft gemacht. Sie haben den Funken verloren, der in der ersten Version noch da war. Ich glaube, genau da liegt die Gefahr: Wenn man etwas zu sehr überarbeitet, verliert es seinen Zauber. Es wird steril.

Das ist schwer zu kontrollieren, aber ich persönlich arbeite lieber zügig. Beim Gesang gebe ich mir meist etwa eine Stunde – das reicht normalerweise, um ihn weitgehend fertig zu bekommen. Wenn es in die zweite Stunde geht, verliere ich das Interesse. Für mich ist es wichtig, nicht jedes Detail vorzuplanen. Der erste Moment, in dem ich meinen Mund aufmache, um einen Song zu singen, ist oft schon der Moment, in dem die Masterspur entsteht. Zu diesem Zeitpunkt kenne ich die Melodie, der Text ist geschrieben, ich habe eine Vorstellung von der Phrasierung – aber während des Singens merke ich: Ich muss vielleicht ein Wort ändern, weil es rhythmisch nicht passt, oder die Melodie leicht anpassen, vereinfachen, vielleicht eine kleine Verzierung einbauen.
Nach einer halben bis dreiviertel Stunde weiß ich dann, wie ich den Song singen will. Danach korrigiere ich nur noch Kleinigkeiten – und dann denke ich: Das ist es. Das ist die Masterspur. Dieses schnelle Arbeiten gibt mir ein gutes Gefühl.
Manche Produzenten sagen, der beste Take ist immer Take 2 oder Take 3. Wie ist das bei Ihnen?
So arbeite ich nicht. Ich bin eher ein destruktiver Aufnahmetyp – das kommt noch aus der Zeit der analogen Tonbänder. Wenn mir etwas nicht gefiel, wurde einfach darüber aufgenommen. Die vorherige Version war dann für immer weg. Ich mag es nicht, viele Spuren zu behalten und später auszuwählen: „Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon…“ – so arbeiten viele, aber ich nicht.
Ich treffe Entscheidungen sofort. Wenn ich einen falschen Ton höre oder etwas schief klingt, halte ich an, spule zehn Sekunden zurück und nehme den Abschnitt neu auf. Ich bewahre keine Outtakes auf. Ein Outtake ist ein Outtake – und der wird gelöscht. Für immer. Diese Arbeitsweise gefällt mir, weil sie sehr fokussiert ist.
Es ist wie bei einem Ölgemälde: Wenn man einen Pinselstrich setzt, kann man ihn nicht einfach übermalen – er ist noch feucht, er verschmiert alles. Und bei Aquarell ist es sogar noch kritischer: Ein Strich bleibt, er lässt sich nicht mehr ändern. Vielleicht kann man bei Öl nach Wochen noch einmal drübergehen – aber musikalisch reizt mich das überhaupt nicht.
Würden Sie sagen, Bob Dylan macht in gewisser Weise etwas Ähnliches – dass er seine Musik live neu interpretiert?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über Bob Dylan. Sie bitten mich da um eine Interpretation seines Werks. Aber ich denke, Neuinterpretationen geschehen eher live als im Studio. Ja – live. Ich glaube, das machen wir doch alle, oder? Wir greifen auf frühe Stücke zurück und verändern etwas – manchmal nur ein bisschen, manchmal ziemlich deutlich.
Aber es geht nicht darum, die ursprüngliche Aufnahme neu einzuspielen. Platten sind ein Vermächtnis. Wenn man eine Platte macht, bleibt sie für immer. Sie ist fixiert. Man kann sie im Nachhinein nicht mehr wirklich ändern. Natürlich kann man sagen: „Hier ist eine neue Version, die klingt besser. Hört lieber die.“ Aber die Menschen kehren doch immer wieder zur Originalaufnahme zurück. Das liegt in der Natur des Hörens – das Original hat eine besondere Aura.
Es ist das, was die Leute erleben wollen. Ich weiß nicht genau, wie erfolgreich das war, als Giles Martin mit seinem Vater George zusammenarbeitete, um Sgt. Pepper neu abzumischen. Es ging dabei ja nicht darum, die Musik zu verändern, sondern sie mithilfe moderner Technik in die Gegenwart zu holen. George war zu diesem Zeitpunkt schon taub. Ich habe ihn gefragt: „Wie funktioniert das – arbeitest du da wirklich noch mit?“
Und er sagte: „Bin irgendwie dabei. Ich arbeite mit meinen Erinnerungen. Ich kann die Musik nicht mehr hören, aber ich versuche, Giles ein bisschen bei der Einordnung der Originalaufnahmen zu helfen.“ Ich war mir nicht sicher, wie ich das finden sollte … Vielleicht auch, weil ich George kurz darauf etwas besser kannte – er starb ja bald danach. Aber ich hatte das Gefühl: Es würde mir schwerfallen, mir die überarbeitete Version von Sgt. Pepper anzuhören.
Ich wollte nicht dastehen und denken: „Ach, das Original war besser.“ Vielleicht klingt die neue Fassung technisch besser – aber es ist eben nicht die Originalaufnahme. Und ich wollte dieses Gefühl vermeiden. Deshalb habe ich bewusst nicht hineingehört. Vielleicht sollte ich es irgendwann tun. Es ist ein bedeutender Teil der Beatles-Geschichte – und, was noch wichtiger ist, ein bedeutender Teil der Beatles-Musik.
(auf nächster Seite weiterlesen)