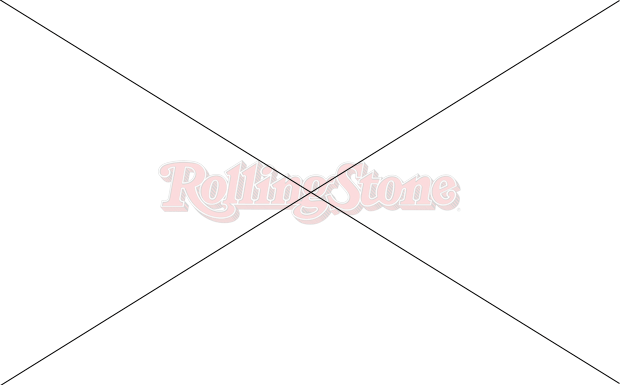Mit Melodien, die sie selbst glücklich machen, will SHERYL CROW über die Zusammenbrüche und Beziehungssorgen der vergangenen Jahre hinwegkommen
Es ist still im Berliner Grand Hyatt Hotel, viel zu still. Das seltsam leere Foyer der Luxusherberge am Potsdamer Platz eröffnet sich beim Eintreten als monolithischer Kubus, dessen ins Nichts flüchtende Linien vor allem eins suggerieren: Verschwiegenheit. Einmal durch die Seitentüren verschwunden, kann sich der nun nur noch für Eingeweihte auffindbare Besucher seiner Anonymität sicher sein. Gäste? Haben wir nicht.
Auf dem langen, verwirrenden Weg ins Innere der Festung erscheint der Ort für ein Gespräch mit Sheryl Crow gerade richtig. Viel Nebulöses ist schon wieder geredet worden von der Befindlichkeit der widersprüchlichen, offenbar oft unglücklichen Sängerin, die im Vorfeld zum neuen Album “ C’mon, C’mon“ wieder einmal das Gleichgewicht verlor und in einem Gewühl aus kreativer Frustration sowie dem obligaten Beziehungsterror einen weiteren Zusammenbruch erlitt. All das weiß man – und auch wieder nicht. Crow, in langen, vermutlich oft schmerzhaften Prozessen zum Medienprofi US-amerikanischer Fasson geworden, degradiert jedes Interview zur Farce, indem sie mit gut organisierten Manövern und wohl platzierter Desinformation jeder irgendwie bedenklichen Frage ausweicht und Persönliches hinter vorformulierten Antworten und einem freilich charmanten Lächeln verbirgt.
Indes, es dauert eine Wfeile, bis man das begreift. Crow, ganz in Jeans und schön wie auf den Bildern, antwortet stets ohne Zögern und scheinbar entsprechend der gestellten Frage, schafft es aber in wenigen Sätzen, jede drohende Untiefe zu umschiffen und sich auf Unverfängliches, gedruckt gut Klingendes zu beschränken. „Natürlich formt immer in erster Linie dein privates Leben deine Kunst“, sagt sie auf die Frage nach dem Auslöser der letzten Seelenkrise. „Mir ging’s während der Aufnahmen zum neuen Album lange nicht gut, und dann gelingt einem auch die Musik nur schwer. Außerdem musste ich nach den anstrengenden letzten Jahren meine Haltung zur Arbeit neu bewerten. Ich neige dazu, meine Kunst mit meinem Leben zu verwechseln, und das ist ungesund. Es war schließlich meine Freundin Chrissie Hynde, die mir den Kopf gewaschen und eine Auszeit verordnet hat.“
Gerade vor einer Auszeit hatte die mittlerweile 40-jährige Crow eine Heidenangst. Der durchschnittliche Musikkonsument sei zwischen 13 und 25, sagt sie, und mit ein bisschen Pech sei vielleicht bald keiner mehr da, der ihre eher altbackene Musik hören wolle. Da könne man ja nicht guten Gewissens pausieren. „Natürlich ging’s in der Musikbranche schon immer in erster Linie um Marketing“, konzediert sie mit einem Seufzen, „aber das, was sich da in den letzten Jahre entwickelt hat, ist sicher eine völlig neue Dimension.“
Irgendwo in diesem Dreieck aus Seelenfrust, Medienschelte und kreativer Neuorientierung siedelt Crow ihr viertes Album an. Klassischen amerikanischen Rock wollte sie machen, wie den Sound von Steve Miller, The James Gang und Heart, der in ihren Teenage-Jahren aus den Boxen ihres Autoradios kam. „Es geht auf diesem Album viel um den Verlust von Unschuld“, erklärt sie, „ich habe mich nach Musik gesehnt, die etwas ausstrahlt von der großäugigen Naivität, mit der ich als Jugendlicher die Welt, das Leben und schließlich auch meine Stars bewundert habe. Das alles ist mittlerweile hässlich entzaubert und gar nicht mehr geheimnisvoll.“ Crow, im Studio unterstützt von einer ganzen Armada hochkarätiger Kollegen und Kolleginnen, reiht auf „C’mon, C’mon“ Rockriff an Rockriff, dass ihr alter Held Keith Richards sich freuen dürfe, singt nach Leibeskräften erbaulich, und natürlich sind Songs wie „Soak Up The Sun“ auch alsself-fulfillingprophecies gedacht, die jenseits des musikalischen Kehraus der letzten Jahre die Sonne mit Gewalt ins eigene Gemüt bugsieren sollen. „Ich vermisse diesen großen Chorus, den es früher bei so vielen Songs gab“, sagt sie fast entschuldigend. „Melodien, die ich mir selbst vorsingen kann und die mich glücklich machen. Und da sie sonst keiner schreibt, muss ich halt wohl selbst ran.“