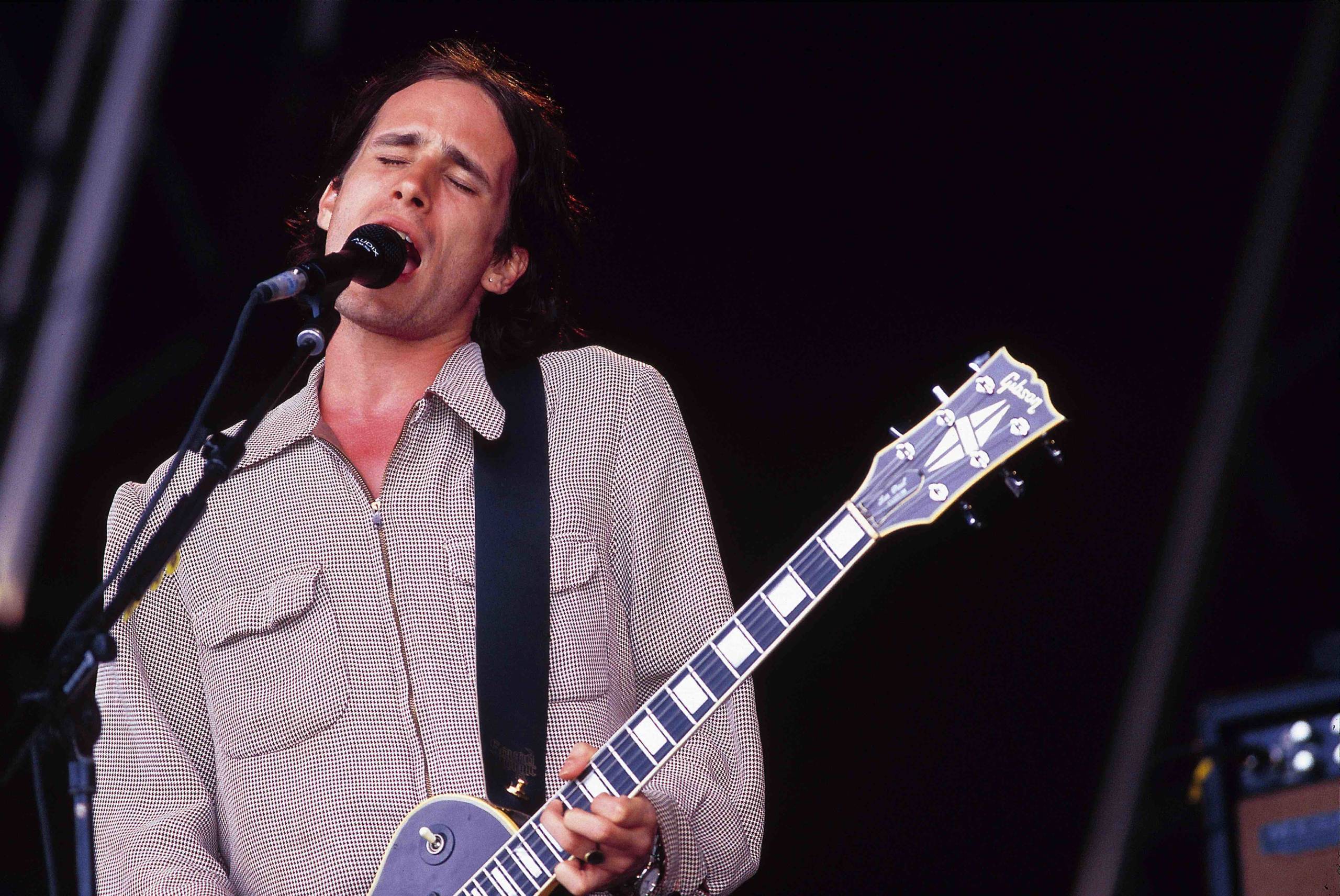Mein Leben mit den Süßstoff-Melodien der Pet Shop Boys
Neil Tennant und Chris Lowe gelingt mit ihrer Musik und ihrem Auftreten die Einlösung aller Versprechen, die von der Popmusik je gemacht wurden.

Frage nie einen DJ auf Hochzeiten, warum er einen bestimmten Song nicht spielt. Du wirst immer die Antwort bekommen, dass er genau weiß, was er da tut. Und das stimmt auch. Wer einen Playlist-Manager bei solchen Veranstaltungen beobachtet, erkennt, dass sein Wirken im Wesentlichen darin besteht, zu wissen, in welche emotionale Richtung sich die Feiernden gerade bewegen. Wer diese Leistung verkennt, beobachte einmal, was passiert, wenn man im falschen Moment „Dance Me To The End of Love“ spielt. Ein jegliches hat seine Zeit, auch auf Hochzeiten.
Gewünscht hatte ich mir eigentlich einen bestimmten Song der Pet Shop Boys, aber ich bekam ihn nicht. Der Einsatz anderer Songs verfehlte, soweit ich das beurteilen kann, seine Wirkung zwar nicht. Aber ich war dennoch traurig. Ein schöner Moment wird durch die Musik der Pet Shop Boys stets noch etwas schöner.
Seit vielen Jahren begleiten mich Neil Tennant und Chris Lowe durchs Leben wie gute Freunde, die stets da sind. Nicht immer haben sie einen passenden Rat parat, aber stets einen anderen Blick auf die Dinge. Ihre Süßstoff-Melodien sind in schlechten Zeiten ein durchschlagendes Nahrungsergänzungsmittel. Wer kann sich „Go West“ entziehen? Wer fühlt sich nicht für vier Minuten in eine andere Zeitdimension versetzt, wenn „West End Girls“ ansetzt? Und dann entdeckt man dieses Duo eigentlich erst so richtig, wenn man einmal alle ihre Hits weglässt. Und das sind viele! Sie hätten zuletzt auf ihrer Best-of-Tour doppelt so viele Stücke spielen können.
Musik für die Massen? Ja, aber…
Die Pet Shop Boys, das macht es so einfach, sind für jeden da. Sie sind die Einlösung aller Versprechen, die von der Popmusik je gemacht wurden. Ihre Songs wollen zugleich ein warmer Mantel für die existenziell Frierenden sein, aber auch Bohemiens zum Tanzen bringen, deren Musikgeschmack sich ansonsten auf fünf Platten aus Vaters Fundus beschränkt. Ihre Lieder haben ein fast erotisches Spannungsverhältnis zwischen glanzpolierten Emotionen und intellektueller Distanz. Grandiosität und Künstlichkeit sind bei ihnen Teil eines von Camp und Ironie befeuerten Welttheaters, in dem die Melancholie des Großstadtlebens ebenso Anklang findet wie queeres Begehren.
Kurz: Tennant und Lowe machen Musik für Menschen, die sich verletzt fühlen, aber elegant genug sind, es nicht zu zeigen. Wie beispielhaft in „Being Boring“. Eine Oscar-Wilde-Erzählung mit Chrom lackiert. Stille Tränen. Es geht also bei den Pet Shop Boys sogar noch darum, WARUM es Menschen gibt, die diese Songs nötig haben.
Wer das Vergnügen hat, die beiden Musiker zu sprechen, erlebt zwei würdevoll in die Jahre gekommene britische Gentlemen in Hoodies, die höflich und charmant dazu einladen, an einem zuvor gar nicht beigewohnten, aber wohl schon seit langer Zeit mindestens zu zweit geführten Salon-Gespräch teilzunehmen. Bevor die erste Frage über die Lippen kommt, fragen die Herren ihrerseits, wo der Interviewer wohnt. Tempelhof. Gleich platzen sie heraus mit Erinnerungen an Flüge zum ehemaligen Flughafen dort. Das sei jetzt ja ein Erlebnisspielplatz für Erwachsene, die nicht erwachsen werden wollen, ergänzen sie.
So nimmt man Platz in einem dieser Gespräche mit den Pet Shop Boys. Recht eigentlich sind auch diese eine Kunstform für sich, eine notwendige Ergänzung zu ihrem vielfach verschlungenen Werk. Seit 1981 führen Tennant/Lowe einen Dialog, mal mit Gästen, mal ohne. Wenn es je eine musikalische Entsprechung des schönen britischen Lexikonbegriffs „Sophisticated“ gegeben hat, dann ist es die Musik, aber auch das Auftreten der Pet Shop Boys.
Grandiose Songs reihen sich an furchtbare Songs
Man erlebt auch die Neugier zweier Künstler, die ihr Werk seit der ersten geschriebenen Nummer „Jealousy“ immer weiter verfeinert, zerkleinert und neu mit Klebstoff zusammengesetzt haben. Es spricht Bände, dass dieses kleine, 1982 improvisierte Melodram über verletzte Gefühle erst 1990 erschien, auf „Behaviour“, ihrem vielleicht empfindsamsten, auf jeden Fall aber sehnsüchtigsten Album. Es war das erste, bei dem sie auch Gitarren zuließen. Ein jegliches hat seine Zeit, auch für die Pet Shop Boys.
„How I Learned To Hate Rock’n’Roll“. In den 80ern war das so eine Einstellung. Manche haben sie weitergetragen, andere sind schwach geworden. Man muss sie nicht teilen, um dem Sound dieser Band zu folgen. Übrigens ist dies auch der Titel einer der vielen scheußlichen Nummern, die Tennant/Lowe nebenher produziert haben. Immer weiter, um keinen Remix verlegen. Als sie mit „Where The Streets Have No Name (I Can’t Take My Eyes Off You)“ U2 und Frankie Valli vermählten, fragte nicht nur Bono: „What Have We Done To Deserve This?“
Wie bei allen Künstlern, denen es nicht um das perfekte Werk, sondern um die Möglichkeiten des Ausdrückens geht, ist das hinzunehmen. Es gibt Nummern der Pet Shop Boys, die möchte ich kein zweites Mal hören. Bei anderen Liedern, wie etwa „Left To My Own Devices“, vernehme ich hingegen bei jedem neuen Durchgang weitere Nuancen. Wie schreibt man Zeilen wie „I was faced with a choice at a difficult age/Would I write a book? Or should I take to the stage?/But in the back of my head I heard distant feet/Che Guevara and Debussy to a disco beat“, und warum stellt man ein solches Dramolett an den Anfang einer Platte, die „Introspective“ heißt? Die Pet Shop Boys sind eine Band für Menschen, die gerne Fragen stellen. Es ist nicht wichtig, ob man Debussy kennt, aber es hilft.
Das erste Mal, dass ich bewusst einen Song des Duos wahrnahm, war an einem Ort, der ganz sicher nicht für ihre Musik gebaut wurde, aber auch dort mühelos Einzug erhielt. Ich besuchte mit meinem Vater im Olympiastadion in Berlin ein Spiel von Hertha BSC. Damals befand sich der Verein wie derzeit lediglich in der 2. Liga, spielte aber noch unansehnlicher als heute. Ich hatte noch nicht das Interesse am Fußball entwickelt, das mein Vater mitbrachte, der selbst Gefallen an den ödesten Grätschereien entwickeln kann, also sprang ich aus Langeweile in der Halbzeit über die unzähligen freien Bänke. Ein spontanes Vergnügen, das ich schlagartig einstellte, als ich aus den Stadionlautsprechern erstmals „It’s A Sin“ hörte. Die Gänsehaut, die mich als Teil der opernhaften Synth-Flächen und des monumentalen Marschgesangs traf, wollte danach nie mehr vergehen.
Wie unpassend mag diese öffentliche Beichte katholischer Schuldsozialisation in einer Sportkathedrale wirken? Doch halt, es ist ja nicht nur ein biographisches Musikstück mit gewaltigem Rhythmus („It’s A Sin will anklagen – und benutzt Pop als Waffe), es ist viel mehr. Die Worte des Songs funktionieren wie ein Stempel. Der Chor will nicht verbinden, er exekutiert. Man tanzt zu dem Lied, aber unter Zwang. Plötzlich findet sich doch eine Nähe zu dem, was dort in einem Stadion mit den Athleten und vor allem den Zuschauern passiert.
Wer die Pet Shop Boys hört, also nicht nur nebenbei beim Besuch in einem Einkaufstempel oder im Autoradio – auch wenn das genau die Art ist, wie diese Songs zunächst konsumiert werden wollen – , der verliert sich schnell in ihnen. Weil da stets ein Funkeln ist: eine versteckt anmutende Bedeutungsbene, ein schiefer Beat, eine verstolperte Gesangslinie, ein unerhörtes Produktionsdetail. Man kann diese Musik wie Gebrauchsmusik hören, nur für einen Augenblick gedacht (eben eine Hochzeit!). Oder man nimmt sie als Kompass für die Auswüchse der Popmusik, die von den beiden Musikern genauso geprägt wie geistreich begleitet wurde.
Kontrolliertes Drama
Es fällt auch nicht schwer, sich in diesem Irrgarten der Zeichen und Anspielungen zu verlieren. Die Pet Shop Boys sind immer schon ihre eigenen Interpreten gewesen. Vielleicht ist das auch ein Stück weit Eitelkeit. Der ehemalige Kritiker Tennant weiß ja, was es heißt, leidenschaftlich etwas abzulehnen. Die Band hat ihre Alben mehrfach wieder neu aufgelegt und zu mustergültigen Versuchsanordnungen ihres musikalischen Schaffens gemacht. Man bekommt die Hits, aber auch den Ausstoß und Überschuss. Dazu zu jedem Song Hintergrundgeschichten, rabiate oder augenzwinkernde Urteile und Texte Schwarz auf Weiß, die sich womöglich sträuben, Literatur zu sein, aber als poetische Funkenflüge vor allem davon leben, WIE sie von Neil Tennant gesungen werden.
Diese Stimme ist ein Argument für sich. Sie ist natürlich kein Naturereignis, sondern wie alles bei diesem Duo bewusst konstruiert. Sie erinnert an Nachrichtensprecher und Tonlagen aus Chansons. Tennant bleibt meist in einer komfortablen Baritonlage. Er vermeidet große Sprünge und Pathos-Register. Hohe Töne werden nicht heroisch gesungen, sondern eher leicht, fast dünn oder ironisch genommen. Heraus kommt eine Marzipanmischung aus Monumentalem und Intimität. Natürlich ist das auch sehr britisch, ein kontrolliertes Drama.
Kollege Sassan Niasseri hat einmal gesagt, dass die Pet Shop Boys zwar große Songs haben, aber kein einziges großes Album. Ich finde jedoch, dass es einige gibt, die nah dran sind. „Yes“ zum Beispiel, das einen unwiderstehlichen Hang zu vorpreschenden Hymnen hat. Und mit „Love etc.“ einen Song, den man mit in den Urlaub nehmen will. Man wird so schnell niemanden finden, mit dem man sich einig wird über das, was bei dem Duo am Besten oder Schlechtesten ist. Ihre Kunst ist ja auch eine des Ausprobierens und Neumischens; Atmosphärisches wird über Endgültiges gestellt. Zu besichtigen sein wird das bald auch in „Pet Shop Boys Volume“, einem Buch, das alle visuellen Eindrücke versammelt, die zum Gesamtwerk der Musiker dazugehören. Man hört, sieht, riecht, schmeckt und fühlt die Pet Shop Boys.
Mir ging es im Leben bisher oft so, dass ich vor allem dann von etwas verstanden habe, wenn ich es immer wieder über einen bestimmten Gegenstand diskutieren kann. Um dem Kino näher zu kommen, eignet sich etwa ein niemals enden wollendes Gespräch über die Filme von Alfred Hitchcock. Francois Truffaut spiegelte mit seinem Titel „Wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock?“ für den berühmten Interviewband mit Hitch genau diese Methode. Und so frage ich mich und andere, die dieses Spiel ebenfalls betreiben, oft, wie sie das gemacht haben, die Pet Shop Boys. Oder: Wie sich das anfühlt, Pet-Shop-Boys-Musik. Irgendwie führen diese Gedanken stets zu der Frage, was die Pop-Maschine von Tennant und Lowe antreibt.
Ganz einfach: Ihre Musik ist der strahlende Atomkern aller Entwürfe von Popmusik. Nicht mehr und nicht weniger.
An dieser Stelle schreibt ROLLING-STONE-Autor Marc Vetter über seine persönlichen Erfahrungen mit Popkultur. Zuletzt erschienen auch: